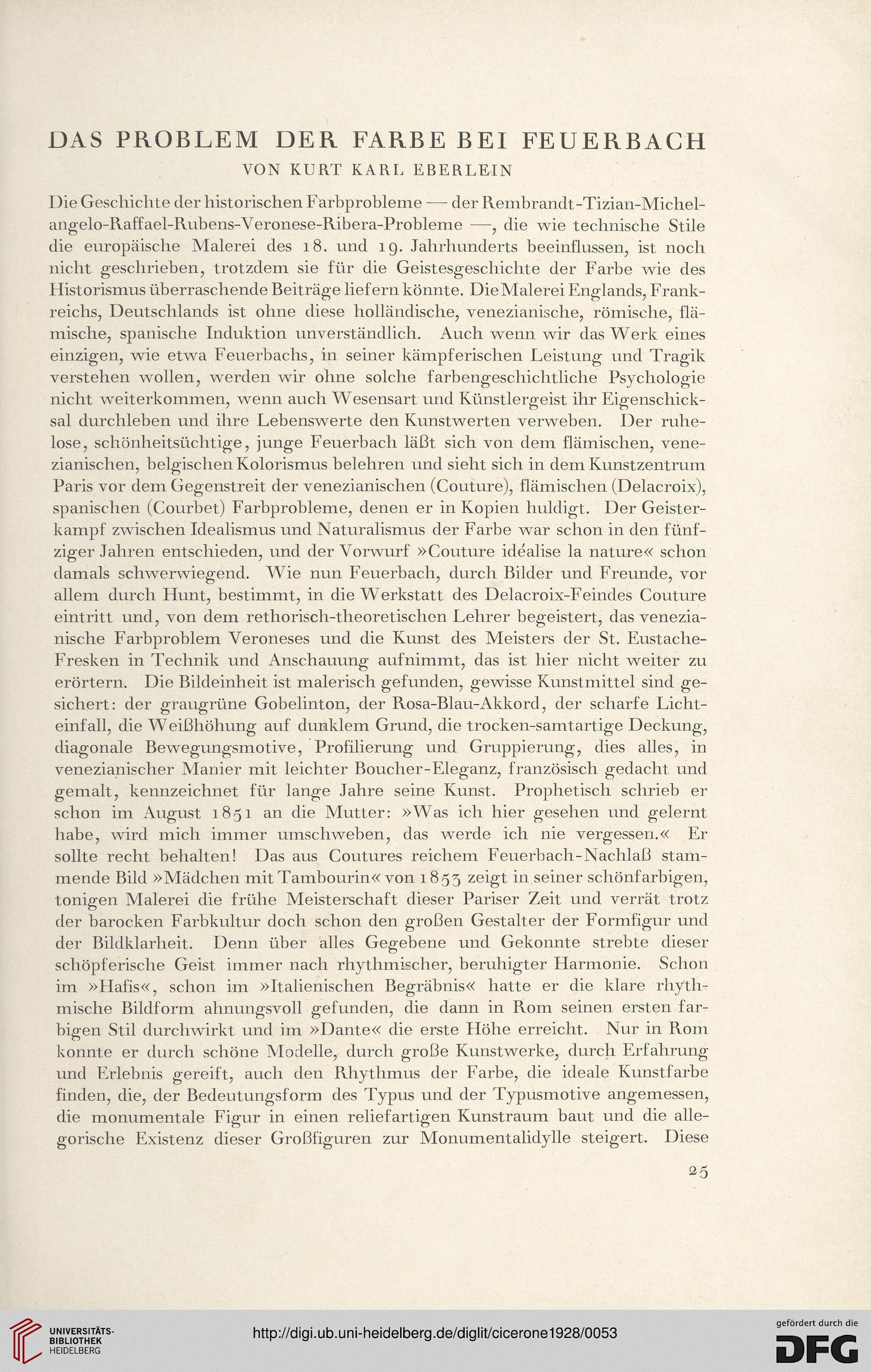DAS PROBLEM DER FARBE BEI FEUERBACH
VON KURT KARL EBERLEIN
Die Geschichte der historischen Farbprobleme — der Rembrandt-Tizian-Michel-
angelo-Raffael-Rubens-Veronese-Ribera-Probleme —, die wie technische Stile
die europäische Malerei des 18. und 19. Jahrhunderts beeinflussen, ist noch
nicht geschrieben, trotzdem sie für die Geistesgeschichte der Farbe wie des
Historismus überraschende Beiträge liefern könnte. DieMalerei Englands, Frank-
reichs, Deutschlands ist ohne diese holländische, venezianische, römische, flä-
mische, spanische Induktion unverständlich. Auch wenn wir das Werk eines
einzigen, wie etwa Feuerbachs, in seiner kämpferischen Leistung und Tragik
verstehen wollen, werden wir ohne solche farbengeschichtliche Psychologie
nicht weiterkommen, wenn auch Wesensart und Künstlergeist ihr Eigenschick-
sal durchleben und ihre Lebenswerte den Kunstwerten verweben. Der ruhe-
lose, schönheitsüchtige, junge Feuerbach läßt sich von dem flämischen, vene-
zianischen, belgischen Kolorismus belehren und sieht sich in dem Kunstzentrum
Paris vor dem Gegenstreit der venezianischen (Couture), flämischen (Delacroix),
spanischen (Courbet) Farbprobleme, denen er in Kopien huldigt. Der Geister-
kampf zwischen Idealismus und Naturalismus der Farbe war schon in den fünf-
ziger Jahren entschieden, und der Vorwurf »Couture idealise la nature« schon
damals schwerwiegend. Wie nun Feuerbach, durch Bilder und Freunde, vor
allem durch Hunt, bestimmt, in die Werkstatt des Delacroix-Feindes Couture
eintritt und, von dem rethorisch-theoretischen Lehrer begeistert, das venezia-
nische Farbproblem Veroneses und die Kunst des Meisters der St. Eustache-
Fresken in Technik und Anschauung aufnimmt, das ist hier nicht weiter zu
erörtern. Die Bildeinheit ist malerisch gefunden, gewisse Kunstmittel sind ge-
sichert: der graugrüne Gobelinton, der Rosa-Blau-Akkord, der scharfe Licht-
einfall, die Weißhöhung auf dunklem Grund, die trocken-samtartige Deckung,
diagonale Bewegungsmotive, Profilierung und Gruppierung, dies alles, in
venezianischer Manier mit leichter Boucher-Eleganz, französisch gedacht und
gemalt, kennzeichnet für lange Jahre seine Kunst. Prophetisch schrieb er
schon im August 1851 an die Mutter: »Was ich hier gesehen und gelernt
habe, wird mich immer umschweben, das werde ich nie vergessen.« Er
sollte recht behalten! Das aus Coutures reichem Feuerbach-Nachlaß stam-
mende Bild »Mädchen mit Tambourin« von 1855 zeigt in seiner schönfarbigen,
tonigen Malerei die frühe Meisterschaft dieser Pariser Zeit und verrät trotz
der barocken Farbkultur doch schon den großen Gestalter der Formfigur und
der Bildklarheit. Denn über alles Gegebene und Gekonnte strebte dieser
schöpferische Geist immer nach rhythmischer, beruhigter Harmonie. Schon
im »Hafis«, schon im »Italienischen Begräbnis« hatte er die klare rhyth-
mische Bildform ahnungsvoll gefunden, die dann in Rom seinen ersten far-
bigen Stil durchwirkt und im »Dante« die erste Höhe erreicht. Nur in Rom
konnte er durch schöne Modelle, durch große Kunstwerke, durch Erfahrung
und Erlebnis gereift, auch den Rhythmus der Farbe, die ideale Kunstfarbe
finden, die, der Bedeutungsform des Typus und der Typusmotive angemessen,
die monumentale Figur in einen reliefartigen Kunstraum baut und die alle-
gorische Existenz dieser Großfiguren zur Monumentalidylle steigert. Diese
25
VON KURT KARL EBERLEIN
Die Geschichte der historischen Farbprobleme — der Rembrandt-Tizian-Michel-
angelo-Raffael-Rubens-Veronese-Ribera-Probleme —, die wie technische Stile
die europäische Malerei des 18. und 19. Jahrhunderts beeinflussen, ist noch
nicht geschrieben, trotzdem sie für die Geistesgeschichte der Farbe wie des
Historismus überraschende Beiträge liefern könnte. DieMalerei Englands, Frank-
reichs, Deutschlands ist ohne diese holländische, venezianische, römische, flä-
mische, spanische Induktion unverständlich. Auch wenn wir das Werk eines
einzigen, wie etwa Feuerbachs, in seiner kämpferischen Leistung und Tragik
verstehen wollen, werden wir ohne solche farbengeschichtliche Psychologie
nicht weiterkommen, wenn auch Wesensart und Künstlergeist ihr Eigenschick-
sal durchleben und ihre Lebenswerte den Kunstwerten verweben. Der ruhe-
lose, schönheitsüchtige, junge Feuerbach läßt sich von dem flämischen, vene-
zianischen, belgischen Kolorismus belehren und sieht sich in dem Kunstzentrum
Paris vor dem Gegenstreit der venezianischen (Couture), flämischen (Delacroix),
spanischen (Courbet) Farbprobleme, denen er in Kopien huldigt. Der Geister-
kampf zwischen Idealismus und Naturalismus der Farbe war schon in den fünf-
ziger Jahren entschieden, und der Vorwurf »Couture idealise la nature« schon
damals schwerwiegend. Wie nun Feuerbach, durch Bilder und Freunde, vor
allem durch Hunt, bestimmt, in die Werkstatt des Delacroix-Feindes Couture
eintritt und, von dem rethorisch-theoretischen Lehrer begeistert, das venezia-
nische Farbproblem Veroneses und die Kunst des Meisters der St. Eustache-
Fresken in Technik und Anschauung aufnimmt, das ist hier nicht weiter zu
erörtern. Die Bildeinheit ist malerisch gefunden, gewisse Kunstmittel sind ge-
sichert: der graugrüne Gobelinton, der Rosa-Blau-Akkord, der scharfe Licht-
einfall, die Weißhöhung auf dunklem Grund, die trocken-samtartige Deckung,
diagonale Bewegungsmotive, Profilierung und Gruppierung, dies alles, in
venezianischer Manier mit leichter Boucher-Eleganz, französisch gedacht und
gemalt, kennzeichnet für lange Jahre seine Kunst. Prophetisch schrieb er
schon im August 1851 an die Mutter: »Was ich hier gesehen und gelernt
habe, wird mich immer umschweben, das werde ich nie vergessen.« Er
sollte recht behalten! Das aus Coutures reichem Feuerbach-Nachlaß stam-
mende Bild »Mädchen mit Tambourin« von 1855 zeigt in seiner schönfarbigen,
tonigen Malerei die frühe Meisterschaft dieser Pariser Zeit und verrät trotz
der barocken Farbkultur doch schon den großen Gestalter der Formfigur und
der Bildklarheit. Denn über alles Gegebene und Gekonnte strebte dieser
schöpferische Geist immer nach rhythmischer, beruhigter Harmonie. Schon
im »Hafis«, schon im »Italienischen Begräbnis« hatte er die klare rhyth-
mische Bildform ahnungsvoll gefunden, die dann in Rom seinen ersten far-
bigen Stil durchwirkt und im »Dante« die erste Höhe erreicht. Nur in Rom
konnte er durch schöne Modelle, durch große Kunstwerke, durch Erfahrung
und Erlebnis gereift, auch den Rhythmus der Farbe, die ideale Kunstfarbe
finden, die, der Bedeutungsform des Typus und der Typusmotive angemessen,
die monumentale Figur in einen reliefartigen Kunstraum baut und die alle-
gorische Existenz dieser Großfiguren zur Monumentalidylle steigert. Diese
25