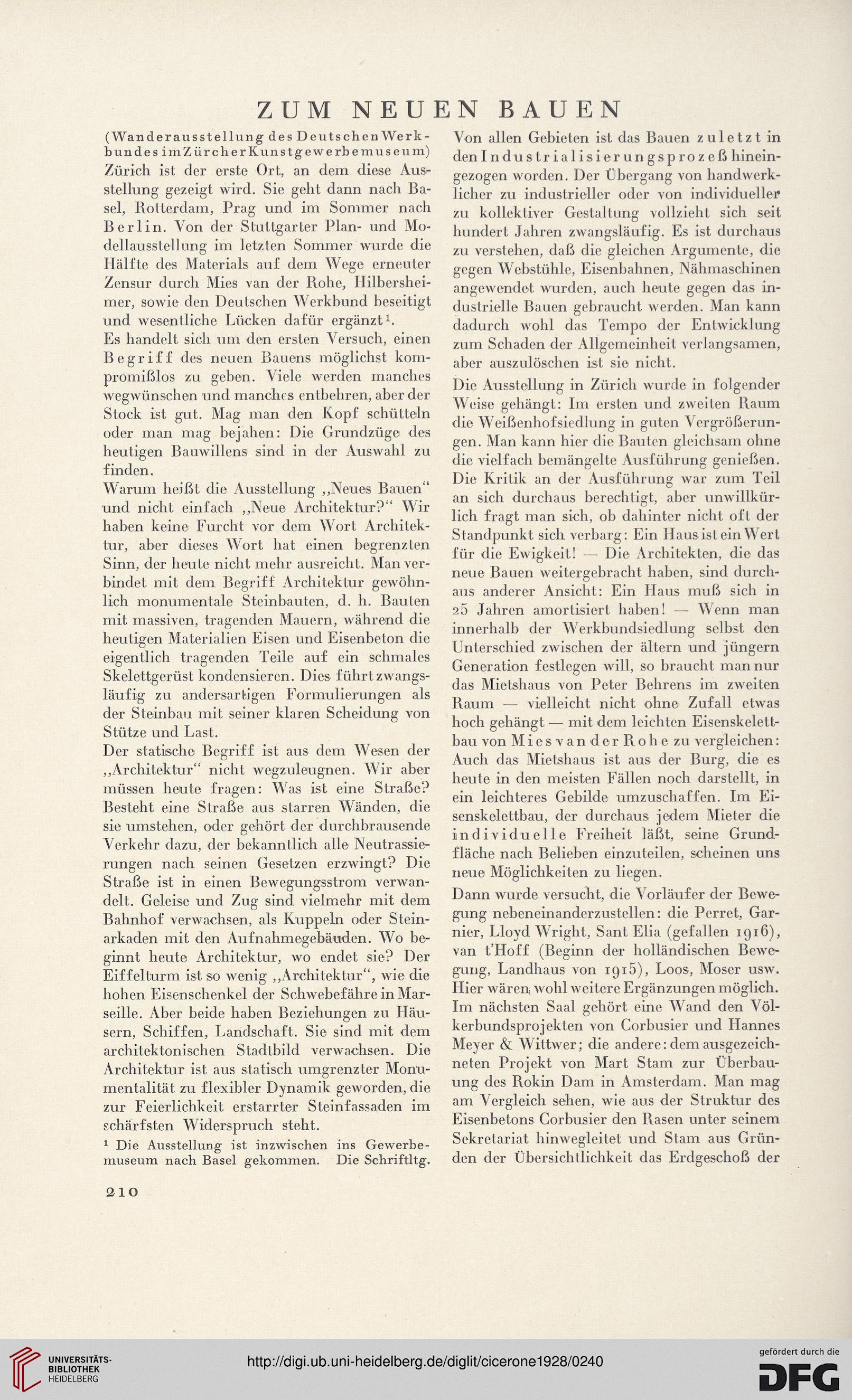ZUM NEUEN BAUEN
(Wanderausstellung des DeutschenWerk-
bundes imZürcherKunstgewerbemuseum)
Zürich ist der erste Ort, an dem diese Aus-
stellung gezeigt wird. Sie geht dann nach Ba-
sel, Rotterdam, Prag und im Sommer nach
Berlin. Von der Stuttgarter Plan- und Mo-
dellausstellung im letzten Sommer wurde die
Hälfte des Materials auf dem Wege erneuter
Zensur durch Mies van der Rohe, Hilbershei-
mer, sowie den Deutschen Werkbund beseitigt
und wesentliche Lücken dafür ergänzt1.
Es handelt sich um den ersten Versuch, einen
Begriff des neuen Bauens möglichst kom-
promißlos zu geben. Viele werden manches
wegwünschen und manches entbehren, aber der
Stock ist gut. Mag man den Kopf schütteln
oder man mag bejahen: Die Grundzüge des
heutigen Bauwillens sind in der Auswahl zu
finden.
Warum heißt die Ausstellung „Neues Bauen“
und nicht einfach „Neue Architektur?“ Wir
haben keine Furcht vor dem Wort Architek-
tur, aber dieses Wort hat einen begrenzten
Sinn, der heute nicht mehr ausreicht. Man ver-
bindet mit dem Begriff Architektur gewöhn-
lich monumentale Steinbauten, d. li. Bauten
mit massiven, tragenden Mauern, während die
heutigen Materialien Eisen und Eisenbeton die
eigentlich tragenden Teile auf ein schmales
Skelettgerüst kondensieren. Dies führt zwangs-
läufig zu andersartigen Formulierungen als
der Steinbau mit seiner klaren Scheidung von
Stütze und Last.
Der statische Begriff ist aus dem Wesen der
„Architektur“ nicht wegzuleugnen. Wir aber
müssen heute fragen: Was ist eine Straße?
Besteht eine Straße aus starren Wänden, die
sie umstehen, oder gehört der durchbrausende
Verkehr dazu, der bekanntlich alle Neutrassie-
rungen nach seinen Gesetzen erzwingt? Die
Straße ist in einen Bewegungsstrom verwan-
delt. Geleise und Zug sind vielmehr mit dem
Bahnhof verwachsen, als Kuppeln oder Stein-
arkaden mit den Aufnahmegebäuden. Wo be-
ginnt heute Architektur, wo endet sie? Der
Eiffelturm ist so wenig „Architektur“, wie die
hohen Eisenschenkel der Schwebefähre in Mar-
seille. Aber beide haben Beziehungen zu Häu-
sern, Schiffen, Landschaft. Sie sind mit dem
architektonischen Stadtbild verwachsen. Die
Architektur ist aus statisch umgrenzter Monu-
mentalität zu flexibler Dynamik geworden, die
zur Feierlichkeit erstarrter Steinfassaden im
schärfsten Widerspruch steht.
1 Die Ausstellung ist inzwischen ins Gewerbe-
museum nach Basel gekommen. Die Schriftltg.
Von allen Gebieten ist das Bauen zuletzt in
den Industrialisierungsprozeß hinein-
gezogen worden. Der Übergang von handwerk-
licher zu industrieller oder von individuellei’
zu kollektiver Gestaltung vollzieht sich seit
hundert Jahren zwangsläufig. Es ist durchaus
zu verstehen, daß die gleichen Argumente, die
gegen Webstühle, Eisenbahnen, Nähmaschinen
angewendet wurden, auch heute gegen das in-
dustrielle Bauen gebraucht werden. Man kann
dadurch wohl das Tempo der Entwicklung
zum Schaden der Allgemeinheit verlangsamen,
aber auszulöschen ist sie nicht.
Die Ausstellung in Zürich wurde in folgender
Weise gehängt: Im ersten und zweiten Raum
die Weißenhofsiedlung in guten Vergrößerun-
gen. Man kann hier die Bauten gleichsam ohne
die vielfach bemängelte Ausführung genießen.
Die Kritik an der Ausführung war zum Teil
an sich durchaus berechtigt, aber unwillkür-
lich fragt man sich, oh dahinter nicht oft der
Standpunkt sich verbarg: Ein Haus ist ein Wert
für die Ewigkeit! — Die Architekten, die das
neue Bauen weitergebracht haben, sind durch-
aus anderer Ansicht: Ein Haus muß sich in
25 Jahren amortisiert haben! — Wenn man
innerhalb der Werkbundsiedlung selbst den
Unterschied zwischen der ältern und jüngern
Generation festlegen will, so braucht man nur
das Mietshaus von Peter Behrens im zweiten
Raum — vielleicht nicht ohne Zufall etwas
hoch gehängt — mit dem leichten Eisenskelett-
bau von Miesvan der Rohe zu vergleichen:
Auch das Mietshaus ist aus der Burg, die es
heute in den meisten Fällen noch darstellt, in
ein leichteres Gebilde umzuschaffen. Im Ei-
senskelettbau, der durchaus jedem Mieter die
individuelle Freiheit läßt, seine Grund-
fläche nach Belieben einzuteilen, scheinen uns
neue Möglichkeiten zu liegen.
Dann wurde versucht, die Vorläufer der Bewe-
gung nebeneinanderzustellen: die Perret, Gar-
nier, Lloyd Wright, Sant Elia (gefallen 1916),
van t’Hoff (Beginn der holländischen Bewe-
gung, Landhaus von igiö), Loos, Moser usw.
Hier wären, wohl weitere Ergänzungen möglich.
Im nächsten Saal gehört eine Wand den Völ-
kerbundsprojekten von Corbusier und Hannes
Meyer & Wittwer; die andere: dem ausgezeich-
neten Projekt von Mart Stam zur Überbau-
ung des Rokin Dam in Amsterdam. Man mag
am Vergleich sehen, wie aus der Struktur des
Eisenbetons Corbusier den R.asen unter seinem
Sekretariat hinwegleitet und Stam aus Grün-
den der Übersichtlichkeit das Erdgeschoß der
210
(Wanderausstellung des DeutschenWerk-
bundes imZürcherKunstgewerbemuseum)
Zürich ist der erste Ort, an dem diese Aus-
stellung gezeigt wird. Sie geht dann nach Ba-
sel, Rotterdam, Prag und im Sommer nach
Berlin. Von der Stuttgarter Plan- und Mo-
dellausstellung im letzten Sommer wurde die
Hälfte des Materials auf dem Wege erneuter
Zensur durch Mies van der Rohe, Hilbershei-
mer, sowie den Deutschen Werkbund beseitigt
und wesentliche Lücken dafür ergänzt1.
Es handelt sich um den ersten Versuch, einen
Begriff des neuen Bauens möglichst kom-
promißlos zu geben. Viele werden manches
wegwünschen und manches entbehren, aber der
Stock ist gut. Mag man den Kopf schütteln
oder man mag bejahen: Die Grundzüge des
heutigen Bauwillens sind in der Auswahl zu
finden.
Warum heißt die Ausstellung „Neues Bauen“
und nicht einfach „Neue Architektur?“ Wir
haben keine Furcht vor dem Wort Architek-
tur, aber dieses Wort hat einen begrenzten
Sinn, der heute nicht mehr ausreicht. Man ver-
bindet mit dem Begriff Architektur gewöhn-
lich monumentale Steinbauten, d. li. Bauten
mit massiven, tragenden Mauern, während die
heutigen Materialien Eisen und Eisenbeton die
eigentlich tragenden Teile auf ein schmales
Skelettgerüst kondensieren. Dies führt zwangs-
läufig zu andersartigen Formulierungen als
der Steinbau mit seiner klaren Scheidung von
Stütze und Last.
Der statische Begriff ist aus dem Wesen der
„Architektur“ nicht wegzuleugnen. Wir aber
müssen heute fragen: Was ist eine Straße?
Besteht eine Straße aus starren Wänden, die
sie umstehen, oder gehört der durchbrausende
Verkehr dazu, der bekanntlich alle Neutrassie-
rungen nach seinen Gesetzen erzwingt? Die
Straße ist in einen Bewegungsstrom verwan-
delt. Geleise und Zug sind vielmehr mit dem
Bahnhof verwachsen, als Kuppeln oder Stein-
arkaden mit den Aufnahmegebäuden. Wo be-
ginnt heute Architektur, wo endet sie? Der
Eiffelturm ist so wenig „Architektur“, wie die
hohen Eisenschenkel der Schwebefähre in Mar-
seille. Aber beide haben Beziehungen zu Häu-
sern, Schiffen, Landschaft. Sie sind mit dem
architektonischen Stadtbild verwachsen. Die
Architektur ist aus statisch umgrenzter Monu-
mentalität zu flexibler Dynamik geworden, die
zur Feierlichkeit erstarrter Steinfassaden im
schärfsten Widerspruch steht.
1 Die Ausstellung ist inzwischen ins Gewerbe-
museum nach Basel gekommen. Die Schriftltg.
Von allen Gebieten ist das Bauen zuletzt in
den Industrialisierungsprozeß hinein-
gezogen worden. Der Übergang von handwerk-
licher zu industrieller oder von individuellei’
zu kollektiver Gestaltung vollzieht sich seit
hundert Jahren zwangsläufig. Es ist durchaus
zu verstehen, daß die gleichen Argumente, die
gegen Webstühle, Eisenbahnen, Nähmaschinen
angewendet wurden, auch heute gegen das in-
dustrielle Bauen gebraucht werden. Man kann
dadurch wohl das Tempo der Entwicklung
zum Schaden der Allgemeinheit verlangsamen,
aber auszulöschen ist sie nicht.
Die Ausstellung in Zürich wurde in folgender
Weise gehängt: Im ersten und zweiten Raum
die Weißenhofsiedlung in guten Vergrößerun-
gen. Man kann hier die Bauten gleichsam ohne
die vielfach bemängelte Ausführung genießen.
Die Kritik an der Ausführung war zum Teil
an sich durchaus berechtigt, aber unwillkür-
lich fragt man sich, oh dahinter nicht oft der
Standpunkt sich verbarg: Ein Haus ist ein Wert
für die Ewigkeit! — Die Architekten, die das
neue Bauen weitergebracht haben, sind durch-
aus anderer Ansicht: Ein Haus muß sich in
25 Jahren amortisiert haben! — Wenn man
innerhalb der Werkbundsiedlung selbst den
Unterschied zwischen der ältern und jüngern
Generation festlegen will, so braucht man nur
das Mietshaus von Peter Behrens im zweiten
Raum — vielleicht nicht ohne Zufall etwas
hoch gehängt — mit dem leichten Eisenskelett-
bau von Miesvan der Rohe zu vergleichen:
Auch das Mietshaus ist aus der Burg, die es
heute in den meisten Fällen noch darstellt, in
ein leichteres Gebilde umzuschaffen. Im Ei-
senskelettbau, der durchaus jedem Mieter die
individuelle Freiheit läßt, seine Grund-
fläche nach Belieben einzuteilen, scheinen uns
neue Möglichkeiten zu liegen.
Dann wurde versucht, die Vorläufer der Bewe-
gung nebeneinanderzustellen: die Perret, Gar-
nier, Lloyd Wright, Sant Elia (gefallen 1916),
van t’Hoff (Beginn der holländischen Bewe-
gung, Landhaus von igiö), Loos, Moser usw.
Hier wären, wohl weitere Ergänzungen möglich.
Im nächsten Saal gehört eine Wand den Völ-
kerbundsprojekten von Corbusier und Hannes
Meyer & Wittwer; die andere: dem ausgezeich-
neten Projekt von Mart Stam zur Überbau-
ung des Rokin Dam in Amsterdam. Man mag
am Vergleich sehen, wie aus der Struktur des
Eisenbetons Corbusier den R.asen unter seinem
Sekretariat hinwegleitet und Stam aus Grün-
den der Übersichtlichkeit das Erdgeschoß der
210