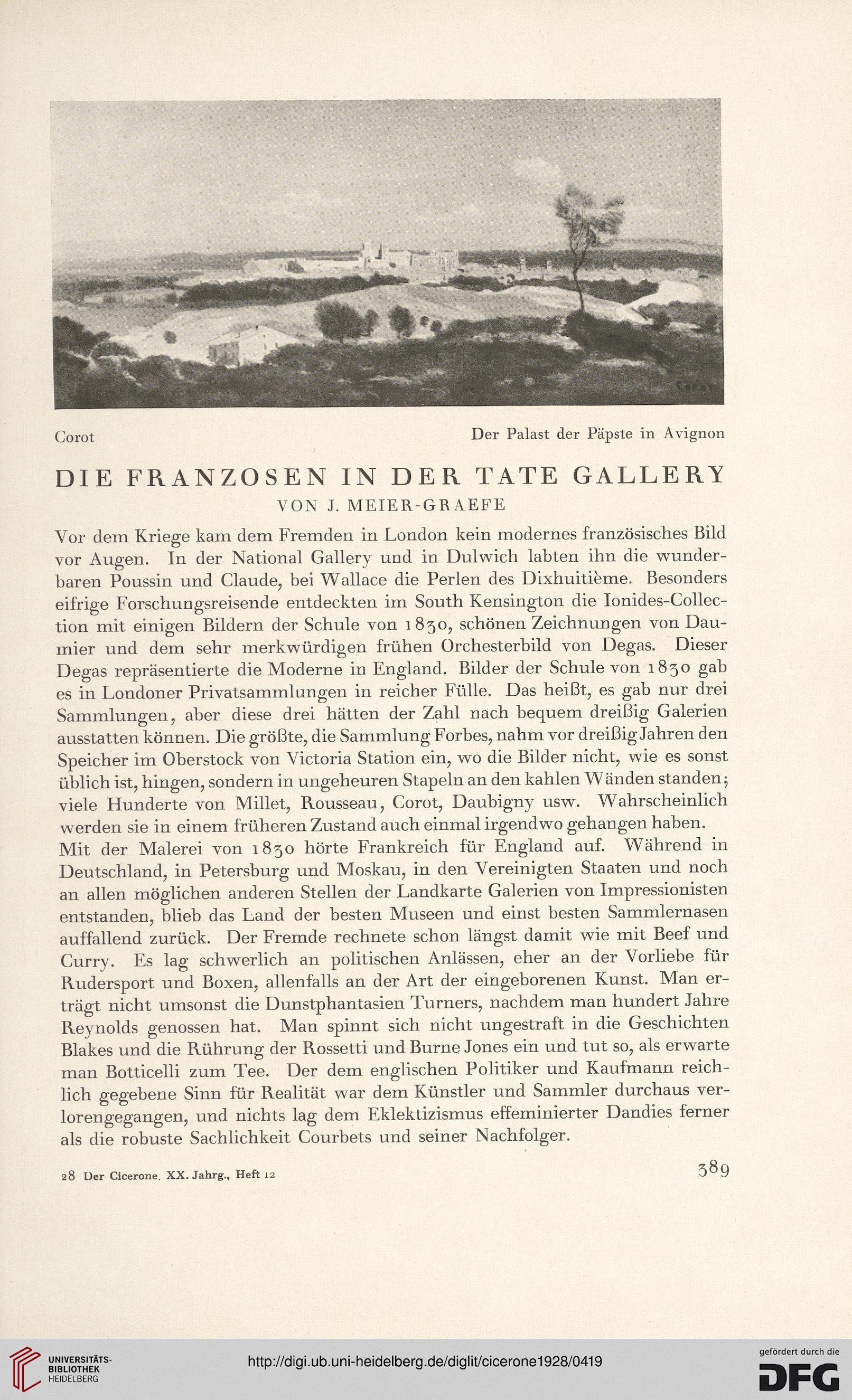Corot Der Palast der Päpste in Avignon
DIE FRANZOSEN IN DER TATE GALLERY
VON J. MEIER-GR AEFE
Vor dem Kriege kam dem Fremden in London kein modernes französisches Bild
vor Augen. In der National Gallery und in Dulwich labten ihn die wunder-
baren Poussin und Claude, bei Wallace die Perlen des Dixhuitieme. Besonders
eifrige Forschungsreisende entdeckten im South Kensington die Ionides-Collec-
tion mit einigen Bildern der Schule von 1850, schönen Zeichnungen von Dau-
mier und dem sehr merkwürdigen frühen Orchesterbild von Degas. Dieser
Degas repräsentierte die Moderne in England. Bilder der Schule von 1850 gab
es in Londoner Privatsammlungen in reicher Fülle. Das heißt, es gab nur drei
Sammlungen, aber diese drei hätten der Zahl nach bequem dreißig Galerien
ausstatten können. Die größte, die Sammlung Forhes, nahm vor dreißig Jahren den
Speicher im Oberstock von Victoria Station ein, wo die Bilder nicht, wie es sonst
üblich ist, hingen, sondern in ungeheuren Stapeln an den kahlen Wänden standen;
viele Hunderte von Millet, Rousseau, Corot, Daubigny usw. Wahrscheinlich
werden sie in einem früheren Zustand auch einmal irgendwo gehangen haben.
Mit der Malerei von 1850 hörte Frankreich für England auf. Während in
Deutschland, in Petersburg und Moskau, in den Vereinigten Staaten und noch
an allen möglichen anderen Stellen der Landkarte Galerien von Impressionisten
entstanden, blieb das Land der besten Museen und einst besten Sammlernasen
auffallend zurück. Der Fremde rechnete schon längst damit wie mit Beef und
Curry. Es lag schwerlich an politischen Anlässen, eher an der Vorliebe für
Rudersport und Boxen, allenfalls an der Art der eingeborenen Kunst. Man er-
trägt nicht umsonst die Dunstphantasien Turners, nachdem man hundert Jahre
Reynolds genossen hat. Man spinnt sich nicht ungestraft in die Geschichten
Blakes und die Rührung der Rossetti und Burne Jones ein und tut so, als erwarte
man Botticelli zum Tee. Der dem englischen Politiker und Kaufmann reich-
lich gegebene Sinn für Realität war dem Künstler und Sammler durchaus ver-
lorengegangen, und nichts lag dem Eklektizismus effeminierter Dandies ferner
als die robuste Sachlichkeit Courbets und seiner Nachfolger.
28 Der Cicerone. XX. Jahrg., Heft 12
389