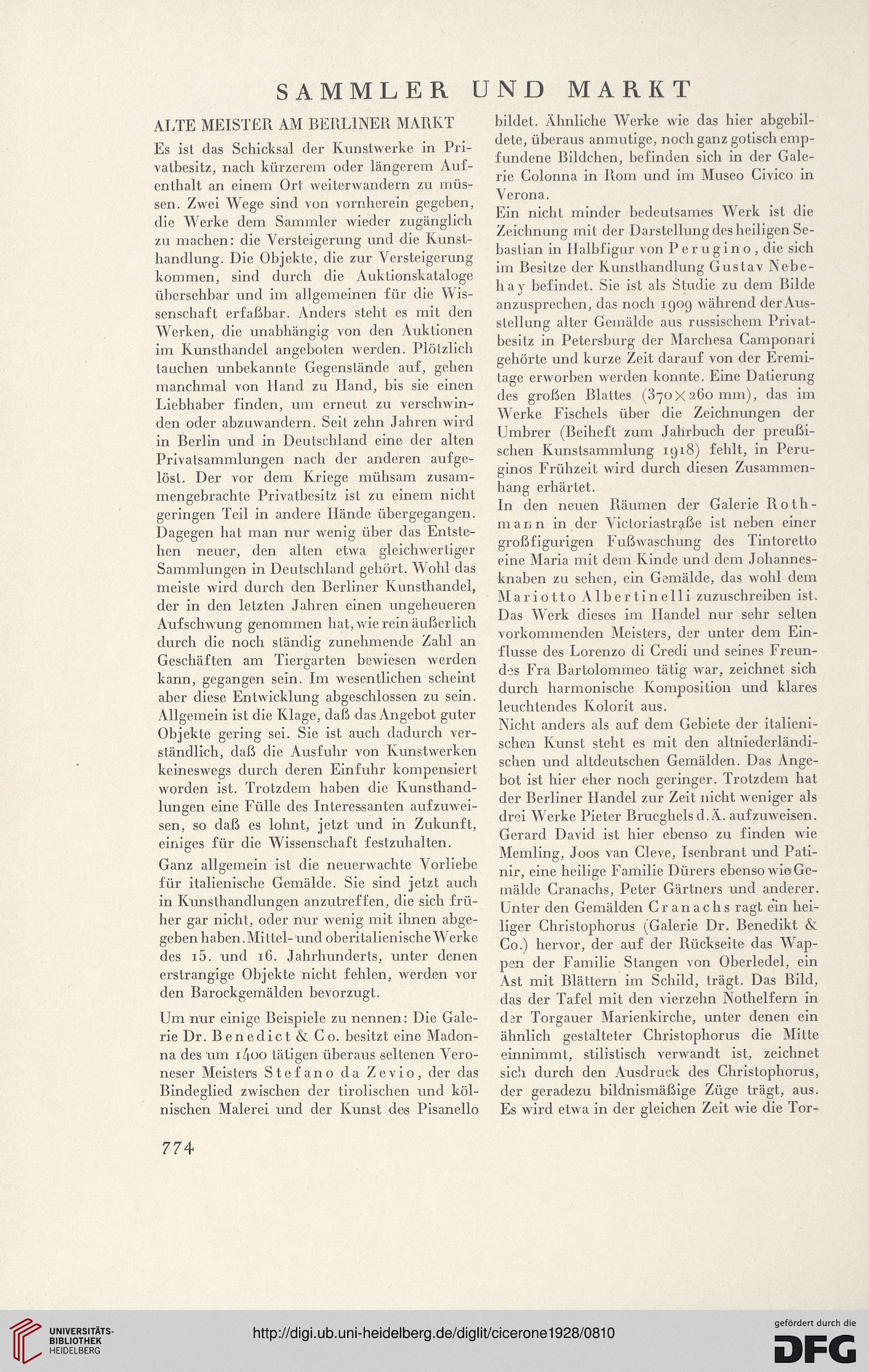SAMMLER UND MARKT
ALTE MEISTER AM BERLINER MARKT
Es ist das Schicksal der Kunstwerke in Pri-
vatbesitz. nach kürzerem oder längerem Auf-
enthalt an einem Ort weiterwandern zu müs-
sen. Zwei Wege sind von vornherein gegeben,
die Werke dem Sammler wieder zugänglich
zu machen: die Versteigerung und die Kunst-
handlung. Die Objekte, die zur Versteigerung
kommen, sind durch die Auktionskataloge
übersehbar und im allgemeinen für die Wis-
senschaft erfaßbar. Anders stellt es mit den
Werken, die unabhängig von den Auktionen
im Kunsthandel angeboten werden. Plötzlich
tauchen unbekannte Gegenstände auf, gehen
manchmal von Hand zu Hand, bis sie einen
Liebhaber finden, um erneut zu verschwind
den oder abzuwandern. Seit zehn Jahren wird
in Berlin und in Deutschland eine der alten
Privatsammlungen nach der anderen aufge-
löst. Der vor dem Kriege mühsam zusam-
mengebrachte Privatbesitz ist zu einem nicht
geringen Teil in andere Hände übergegangen.
Dagegen hat man nur wrenig über das Entste-
hen neuer, den alten etwa gleichwertiger
Sammlungen in Deutschland gehört. Wohl das
meiste wird durch den Berliner Kunsthandel,
der in den letzten Jahren einen ungeheueren
Aufschwung genommen hat, wie rein äußerlich
durch die noch ständig zunehmende Zahl an
Geschäften am Tiergarten bewiesen werden
kann, gegangen sein. Im wesentlichen scheint
aber diese Entwicklung abgeschlossen zu sein.
Allgemein ist die Klage, daß das Angebot guter
Objekte gering sei. Sie ist auch dadurch ver-
ständlich, daß die Ausfuhr von Kunstwerken
keineswegs durch deren Einfuhr kompensiert
worden ist. Trotzdem haben die Kunsthand-
lungen eine Fülle des Interessanten aufzuwei-
sen, so daß es lohnt, jetzt und in Zukunft,
einiges für die Wissenschaft festzuhalten.
Ganz allgemein ist die neuer wachte Vorliebe
für italienische Gemälde. Sie sind jetzt auch
in Kunsthandlungen anzutreffen, die sich frü-
her gar nicht, oder nur wenig mit ihnen abge-
geben haben. Mittel-und oberitalienische Werke
des i5. und 16. Jahrhunderts, unter denen
erstrangige Objekte nicht fehlen, werden vor
den Barockgemälden bevorzugt.
Um nur einige Beispiele zu nennen: Die Gale-
rie Dr. Benedict & Co. besitzt eine Madon-
na des um 1400 tätigen überaus seltenen Vero-
neser Meisters Stefano da Zevio, der das
Bindeglied zwischen der tirolischen und köl-
nischen Malerei und der Kunst des Pisanello
bildet. Ähnliche Werke wie das hier abgebil-
dete, überaus anmutige, noch ganz gotisch emp-
fundene Bildchen, befinden sich in der Gale-
rie Colonna in Rom und im Museo Civico in
Verona.
Ein nicht minder bedeutsames Werk ist die
Zeichnung mit der Darstellung des heiligen Se-
bastian in Halbfigur von P e r u g i n 0 , die sich
im Besitze der Kunsthandlung Gustav Nebe-
hay befindet. Sie ist als Studie zu dem Bilde
anzusprechen, das noch 1909 während der Aus-
stellung alter Gemälde aus russischem Privat-
besitz in Petersburg der Marchesa Camponari
gehörte und kurze Zeit darauf von der Eremi-
tage erworben werden konnte. Eine Datierung
des großen Blattes (370x260 mm), das im
Werke Fischeis über die Zeichnungen der
Umbrer (Beiheft zum Jahrbuch der preußi-
schen Kunstsammlung 1918) fehlt, in Peru-
ginos Frühzeit wird durch diesen Zusammen-
hang erhärtet.
In den neuen Räumen der Galerie Roth-
mann in der Victoriastraße ist neben einer
großfigurigen Fußwaschung des Tintoretto
eine Maria mit dem Kinde und dem Johannes-
knaben zu sehen, ein Gemälde, das wohl dem
Mariotto Albertinelli zuzuschreiben ist.
Das Werk dieses im Handel nur sehr selten
vorkommenden Meisters, der unter dem Ein-
flüsse des Lorenzo di Credi und seines Freun-
des Fra Bariolommeo tätig war, zeichnet sich
durch harmonische Komposition und klares
leuchtendes Kolorit aus.
Nicht anders als auf dem Gebiete der italieni-
schen Kunst steht es mit den altniederländi-
schen und altdeutschen Gemälden. Das Ange-
bot ist hier eher noch geringer. Trotzdem hat
der Berliner Handel zur Zeit nicht weniger als
drei Werke Pieter Brucghels d.Ä. aufzuweisen.
Gerard David ist hier ebenso zu finden wie
Memling, Joos van Cleve, Isenbrant und Pati-
nir, eine heilige Familie Dürers ebenso wie Ge-
mälde Cranachs, Peter Gärtners und anderer.
Unter den Gemälden Cranachs ragt ein hei-
liger Christophorus (Galerie Dr. Benedikt &
Co.) hervor, der auf der Rückseite das Wap-
pen der Familie Stangen von Oberledel, ein
Ast mit Blättern im Schild, trägt. Das Bild,
das der Tafel mit den vierzehn Nothelfern in
der Torgauer Marienkirche, unter denen ein
ähnlich gestalteter Christophorus die Mitte
einnimmt, stilistisch verwandt ist, zeichnet
sich durch den Ausdruck des Christophorus,
der geradezu bildnismäßige Züge trägt, aus.
Es wird etwa in der gleichen Zeit wie die Tor-
774
ALTE MEISTER AM BERLINER MARKT
Es ist das Schicksal der Kunstwerke in Pri-
vatbesitz. nach kürzerem oder längerem Auf-
enthalt an einem Ort weiterwandern zu müs-
sen. Zwei Wege sind von vornherein gegeben,
die Werke dem Sammler wieder zugänglich
zu machen: die Versteigerung und die Kunst-
handlung. Die Objekte, die zur Versteigerung
kommen, sind durch die Auktionskataloge
übersehbar und im allgemeinen für die Wis-
senschaft erfaßbar. Anders stellt es mit den
Werken, die unabhängig von den Auktionen
im Kunsthandel angeboten werden. Plötzlich
tauchen unbekannte Gegenstände auf, gehen
manchmal von Hand zu Hand, bis sie einen
Liebhaber finden, um erneut zu verschwind
den oder abzuwandern. Seit zehn Jahren wird
in Berlin und in Deutschland eine der alten
Privatsammlungen nach der anderen aufge-
löst. Der vor dem Kriege mühsam zusam-
mengebrachte Privatbesitz ist zu einem nicht
geringen Teil in andere Hände übergegangen.
Dagegen hat man nur wrenig über das Entste-
hen neuer, den alten etwa gleichwertiger
Sammlungen in Deutschland gehört. Wohl das
meiste wird durch den Berliner Kunsthandel,
der in den letzten Jahren einen ungeheueren
Aufschwung genommen hat, wie rein äußerlich
durch die noch ständig zunehmende Zahl an
Geschäften am Tiergarten bewiesen werden
kann, gegangen sein. Im wesentlichen scheint
aber diese Entwicklung abgeschlossen zu sein.
Allgemein ist die Klage, daß das Angebot guter
Objekte gering sei. Sie ist auch dadurch ver-
ständlich, daß die Ausfuhr von Kunstwerken
keineswegs durch deren Einfuhr kompensiert
worden ist. Trotzdem haben die Kunsthand-
lungen eine Fülle des Interessanten aufzuwei-
sen, so daß es lohnt, jetzt und in Zukunft,
einiges für die Wissenschaft festzuhalten.
Ganz allgemein ist die neuer wachte Vorliebe
für italienische Gemälde. Sie sind jetzt auch
in Kunsthandlungen anzutreffen, die sich frü-
her gar nicht, oder nur wenig mit ihnen abge-
geben haben. Mittel-und oberitalienische Werke
des i5. und 16. Jahrhunderts, unter denen
erstrangige Objekte nicht fehlen, werden vor
den Barockgemälden bevorzugt.
Um nur einige Beispiele zu nennen: Die Gale-
rie Dr. Benedict & Co. besitzt eine Madon-
na des um 1400 tätigen überaus seltenen Vero-
neser Meisters Stefano da Zevio, der das
Bindeglied zwischen der tirolischen und köl-
nischen Malerei und der Kunst des Pisanello
bildet. Ähnliche Werke wie das hier abgebil-
dete, überaus anmutige, noch ganz gotisch emp-
fundene Bildchen, befinden sich in der Gale-
rie Colonna in Rom und im Museo Civico in
Verona.
Ein nicht minder bedeutsames Werk ist die
Zeichnung mit der Darstellung des heiligen Se-
bastian in Halbfigur von P e r u g i n 0 , die sich
im Besitze der Kunsthandlung Gustav Nebe-
hay befindet. Sie ist als Studie zu dem Bilde
anzusprechen, das noch 1909 während der Aus-
stellung alter Gemälde aus russischem Privat-
besitz in Petersburg der Marchesa Camponari
gehörte und kurze Zeit darauf von der Eremi-
tage erworben werden konnte. Eine Datierung
des großen Blattes (370x260 mm), das im
Werke Fischeis über die Zeichnungen der
Umbrer (Beiheft zum Jahrbuch der preußi-
schen Kunstsammlung 1918) fehlt, in Peru-
ginos Frühzeit wird durch diesen Zusammen-
hang erhärtet.
In den neuen Räumen der Galerie Roth-
mann in der Victoriastraße ist neben einer
großfigurigen Fußwaschung des Tintoretto
eine Maria mit dem Kinde und dem Johannes-
knaben zu sehen, ein Gemälde, das wohl dem
Mariotto Albertinelli zuzuschreiben ist.
Das Werk dieses im Handel nur sehr selten
vorkommenden Meisters, der unter dem Ein-
flüsse des Lorenzo di Credi und seines Freun-
des Fra Bariolommeo tätig war, zeichnet sich
durch harmonische Komposition und klares
leuchtendes Kolorit aus.
Nicht anders als auf dem Gebiete der italieni-
schen Kunst steht es mit den altniederländi-
schen und altdeutschen Gemälden. Das Ange-
bot ist hier eher noch geringer. Trotzdem hat
der Berliner Handel zur Zeit nicht weniger als
drei Werke Pieter Brucghels d.Ä. aufzuweisen.
Gerard David ist hier ebenso zu finden wie
Memling, Joos van Cleve, Isenbrant und Pati-
nir, eine heilige Familie Dürers ebenso wie Ge-
mälde Cranachs, Peter Gärtners und anderer.
Unter den Gemälden Cranachs ragt ein hei-
liger Christophorus (Galerie Dr. Benedikt &
Co.) hervor, der auf der Rückseite das Wap-
pen der Familie Stangen von Oberledel, ein
Ast mit Blättern im Schild, trägt. Das Bild,
das der Tafel mit den vierzehn Nothelfern in
der Torgauer Marienkirche, unter denen ein
ähnlich gestalteter Christophorus die Mitte
einnimmt, stilistisch verwandt ist, zeichnet
sich durch den Ausdruck des Christophorus,
der geradezu bildnismäßige Züge trägt, aus.
Es wird etwa in der gleichen Zeit wie die Tor-
774