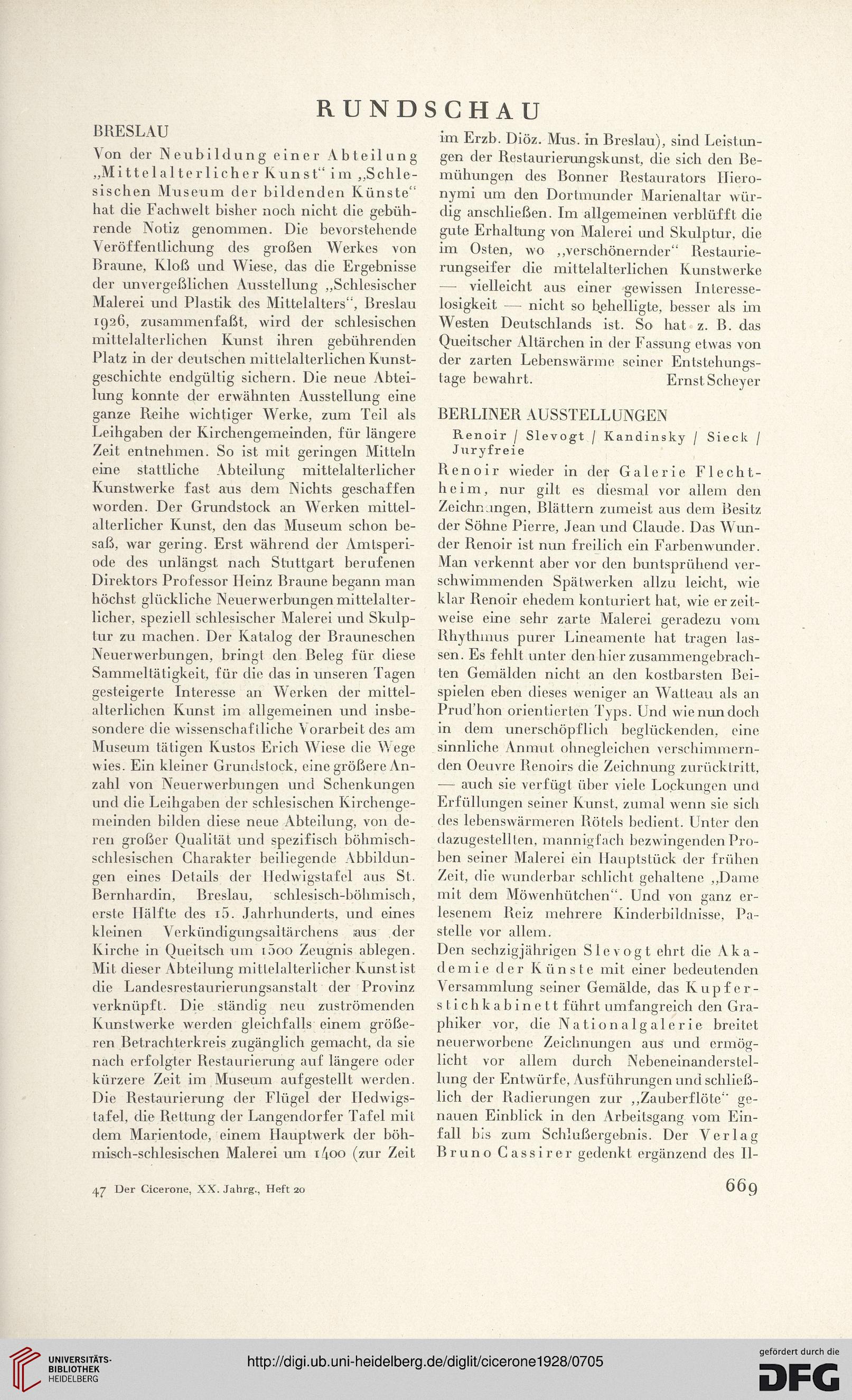RUND
BRESLAU
Von der Neubildung einer Abteilung
„Mittelalterlicher Kunst“ im „Schle-
sischen Museum der bildenden Künste“
hat die Fachwelt bisher noch nicht die gebüh-
rende Notiz genommen. Die bevorstehende
Veröffentlichung des großen Werkes von
Braune, Kloß und Wiese, das die Ergebnisse
der unvergeßlichen Ausstellung „Schlesischer
Malerei und Plastik des Mittelalters“, Breslau
1926, zusammenfaßt, wird der schlesischen
mittelalterlichen Kunst ihren gebührenden
Platz in der deutschen mittelalterlichen Kunst-
geschichte endgültig sichern. Die neue Abtei-
lung konnte der erwähnten Ausstellung eine
ganze Reihe wichtiger Werke, zum Teil als
Leihgaben der Kirchengemeinden, für längere
Zeit entnehmen. So ist mit geringen Mitteln
eine stattliche Abteilung mittelalterlicher
Kunstwerke fast aus dem Nichts geschaffen
worden. Der Grundstock an Werken mittel-
alterlicher Kunst, den das Museum schon be-
saß, war gering. Erst während der Amtsperi-
ode des unlängst nach Stuttgart berufenen
Direktors Professor Heinz Braune begann man
höchst glückliche Neuerwerbungen mittelalter-
licher, speziell schlesischer Malerei und Skulp-
tur zu machen. Der Katalog der Brauneschen
Neuerwerbungen, bringt den Beleg für diese
Sammeltätigkeit, für die das in unseren Tagen
gesteigerte Interesse an Werken der mittel-
alterlichen Kunst im allgemeinen und insbe-
sondere die wissenschaftliche Vorarbeit des am
Museum tätigen Kustos Erich Wiese die Wege
wies. Ein kleiner Grundstock, eine größere An-
zahl von Neuerwerbungen und Schenkungen
und die Leihgaben der schlesischen Kirchenge-
meinden bilden diese neue Abteilung, von de-
ren großer Qualität und spezifisch böhmisch-
schlesischen Charakter beiliegende Abbildun-
gen eines Details der Hedwigstafel aus St.
Bernhardin, Breslau, schlesisch-böhmisch,
erste Hälfte des i5. Jahrhunderts, und eines
kleinen Verkündigungsaltärchens ®us der
Kirche in Queitsch um 1000 Zeugnis ablegen.
Mit dieser Abteilung mittelalterlicher Kunst ist
die Landesrestaurierungsanstalt der Provinz
verknüpft. Die ständig neu zuströmenden
Kunstwerke werden gleichfalls einem größe-
ren Betrachterkreis zugänglich gemacht, da sie
nach erfolgter Restaurierung auf längere oder
kürzere Zeit im Museum auf gestellt werden.
Die Restaurierung der Flügel der Hedwigs-
tafel, die Rettung der Langendorfer Tafel mit
dem Marientode, einem Hauptwerk der böh-
misch-schlesischen Malerei um i.4oo (zur Zeit
CHAU
im Erzb. Diöz. Mus. in Breslau), sind Leistun-
gen der Restaurierungskunst, die sich den Be-
mühungen des Bonner Restaurators lliero-
nymi um den Dortmunder Marienaltar wür-
dig anschließen. Im allgemeinen verblüfft die
gute Erhaltung von Malerei und Skulptur, die
im Osten, wo „verschönernder“ Restaurie-
rungseifer die mittelalterlichen Kunstwerke
— vielleicht aus einer gewissen Interesse-
losigkeit — nicht so behelligte, besser als im
Westen Deutschlands ist. So hat z. B. das
Queitscher Altärchen in der Fassung etwas von
der zarten Lebenswärme seiner Entstehungs-
tage bewahrt. Ernst Scheyer
BERLINER AUSSTELLUNGEN
Renoir / Slevogt / Kandinsky / Sieck /
Juryfreie
Pienoir wieder in der Galerie Flecht-
heim, nur gilt es diesmal vor allem den
Zeichnungen, Blättern zumeist aus dem Besitz
der Söhne Pierre, Jean und Claude. Das Wun-
der Renoir ist nun freilich ein Farbenwunder.
Man verkennt aber vor den buntsprühend ver-
schwimmenden Spätwerken allzu leicht, wie
klar Renoir ehedem konturiert hat, wie er zeit-
weise eine sehr zarte Malerei geradezu vom
Rhythmus purer Lineamente hat tragen las-
sen. Es fehlt unter den hier zusammengebrach-
ten Gemälden nicht an den kostbarsten Bei-
spielen eben dieses weniger an Watteau als an
Prud’hon orientierten Typs. Und wie nun doch
in dem unerschöpflich beglückenden, eine
sinnliche Anmut ohnegleichen verschimmern-
den Oeuvre Renoirs die Zeichnung zurücktritt,
— auch sie verfügt über viele Lockungen und
Erfüllungen seiner Kunst, zumal wenn sie sich
des lebenswärmeren Rötels bedient. Unter den
dazugestellten, mannigfach bezwingenden Pro-
ben seiner Malerei ein Hauptstück der frühen
Zeit, die wunderbar schlicht gehaltene „Dame
mit dem Möwenhütchen“. Und von ganz er-
lesenem Reiz mehrere Kinderbildnisse, Pa-
stelle vor allem.
Den sechzigjährigen Slevogt ehrt die Aka-
demie der Künste mit einer bedeutenden
Versammlung seiner Gemälde, das Kupfer-
stichkabinett führt umfangreich den Gra-
phiker vor, die Nationalgalerie breitet
neu erworbene Zeichnungen aus und ermög-
licht vor allem durch Nebeneinanders tel-
lung der Entwürfe, Ausführungen und schließ-
lich der Radierungen zur „Zauberflöte“ ge-
nauen Einblick in den Arbeitsgang vom Ein-
fall bis zum Schlußergebnis. Der Verlag
Bruno Cassirer gedenkt ergänzend des II-
669
47 Der Cicerone, XX. Jahrg., Heft 20
BRESLAU
Von der Neubildung einer Abteilung
„Mittelalterlicher Kunst“ im „Schle-
sischen Museum der bildenden Künste“
hat die Fachwelt bisher noch nicht die gebüh-
rende Notiz genommen. Die bevorstehende
Veröffentlichung des großen Werkes von
Braune, Kloß und Wiese, das die Ergebnisse
der unvergeßlichen Ausstellung „Schlesischer
Malerei und Plastik des Mittelalters“, Breslau
1926, zusammenfaßt, wird der schlesischen
mittelalterlichen Kunst ihren gebührenden
Platz in der deutschen mittelalterlichen Kunst-
geschichte endgültig sichern. Die neue Abtei-
lung konnte der erwähnten Ausstellung eine
ganze Reihe wichtiger Werke, zum Teil als
Leihgaben der Kirchengemeinden, für längere
Zeit entnehmen. So ist mit geringen Mitteln
eine stattliche Abteilung mittelalterlicher
Kunstwerke fast aus dem Nichts geschaffen
worden. Der Grundstock an Werken mittel-
alterlicher Kunst, den das Museum schon be-
saß, war gering. Erst während der Amtsperi-
ode des unlängst nach Stuttgart berufenen
Direktors Professor Heinz Braune begann man
höchst glückliche Neuerwerbungen mittelalter-
licher, speziell schlesischer Malerei und Skulp-
tur zu machen. Der Katalog der Brauneschen
Neuerwerbungen, bringt den Beleg für diese
Sammeltätigkeit, für die das in unseren Tagen
gesteigerte Interesse an Werken der mittel-
alterlichen Kunst im allgemeinen und insbe-
sondere die wissenschaftliche Vorarbeit des am
Museum tätigen Kustos Erich Wiese die Wege
wies. Ein kleiner Grundstock, eine größere An-
zahl von Neuerwerbungen und Schenkungen
und die Leihgaben der schlesischen Kirchenge-
meinden bilden diese neue Abteilung, von de-
ren großer Qualität und spezifisch böhmisch-
schlesischen Charakter beiliegende Abbildun-
gen eines Details der Hedwigstafel aus St.
Bernhardin, Breslau, schlesisch-böhmisch,
erste Hälfte des i5. Jahrhunderts, und eines
kleinen Verkündigungsaltärchens ®us der
Kirche in Queitsch um 1000 Zeugnis ablegen.
Mit dieser Abteilung mittelalterlicher Kunst ist
die Landesrestaurierungsanstalt der Provinz
verknüpft. Die ständig neu zuströmenden
Kunstwerke werden gleichfalls einem größe-
ren Betrachterkreis zugänglich gemacht, da sie
nach erfolgter Restaurierung auf längere oder
kürzere Zeit im Museum auf gestellt werden.
Die Restaurierung der Flügel der Hedwigs-
tafel, die Rettung der Langendorfer Tafel mit
dem Marientode, einem Hauptwerk der böh-
misch-schlesischen Malerei um i.4oo (zur Zeit
CHAU
im Erzb. Diöz. Mus. in Breslau), sind Leistun-
gen der Restaurierungskunst, die sich den Be-
mühungen des Bonner Restaurators lliero-
nymi um den Dortmunder Marienaltar wür-
dig anschließen. Im allgemeinen verblüfft die
gute Erhaltung von Malerei und Skulptur, die
im Osten, wo „verschönernder“ Restaurie-
rungseifer die mittelalterlichen Kunstwerke
— vielleicht aus einer gewissen Interesse-
losigkeit — nicht so behelligte, besser als im
Westen Deutschlands ist. So hat z. B. das
Queitscher Altärchen in der Fassung etwas von
der zarten Lebenswärme seiner Entstehungs-
tage bewahrt. Ernst Scheyer
BERLINER AUSSTELLUNGEN
Renoir / Slevogt / Kandinsky / Sieck /
Juryfreie
Pienoir wieder in der Galerie Flecht-
heim, nur gilt es diesmal vor allem den
Zeichnungen, Blättern zumeist aus dem Besitz
der Söhne Pierre, Jean und Claude. Das Wun-
der Renoir ist nun freilich ein Farbenwunder.
Man verkennt aber vor den buntsprühend ver-
schwimmenden Spätwerken allzu leicht, wie
klar Renoir ehedem konturiert hat, wie er zeit-
weise eine sehr zarte Malerei geradezu vom
Rhythmus purer Lineamente hat tragen las-
sen. Es fehlt unter den hier zusammengebrach-
ten Gemälden nicht an den kostbarsten Bei-
spielen eben dieses weniger an Watteau als an
Prud’hon orientierten Typs. Und wie nun doch
in dem unerschöpflich beglückenden, eine
sinnliche Anmut ohnegleichen verschimmern-
den Oeuvre Renoirs die Zeichnung zurücktritt,
— auch sie verfügt über viele Lockungen und
Erfüllungen seiner Kunst, zumal wenn sie sich
des lebenswärmeren Rötels bedient. Unter den
dazugestellten, mannigfach bezwingenden Pro-
ben seiner Malerei ein Hauptstück der frühen
Zeit, die wunderbar schlicht gehaltene „Dame
mit dem Möwenhütchen“. Und von ganz er-
lesenem Reiz mehrere Kinderbildnisse, Pa-
stelle vor allem.
Den sechzigjährigen Slevogt ehrt die Aka-
demie der Künste mit einer bedeutenden
Versammlung seiner Gemälde, das Kupfer-
stichkabinett führt umfangreich den Gra-
phiker vor, die Nationalgalerie breitet
neu erworbene Zeichnungen aus und ermög-
licht vor allem durch Nebeneinanders tel-
lung der Entwürfe, Ausführungen und schließ-
lich der Radierungen zur „Zauberflöte“ ge-
nauen Einblick in den Arbeitsgang vom Ein-
fall bis zum Schlußergebnis. Der Verlag
Bruno Cassirer gedenkt ergänzend des II-
669
47 Der Cicerone, XX. Jahrg., Heft 20