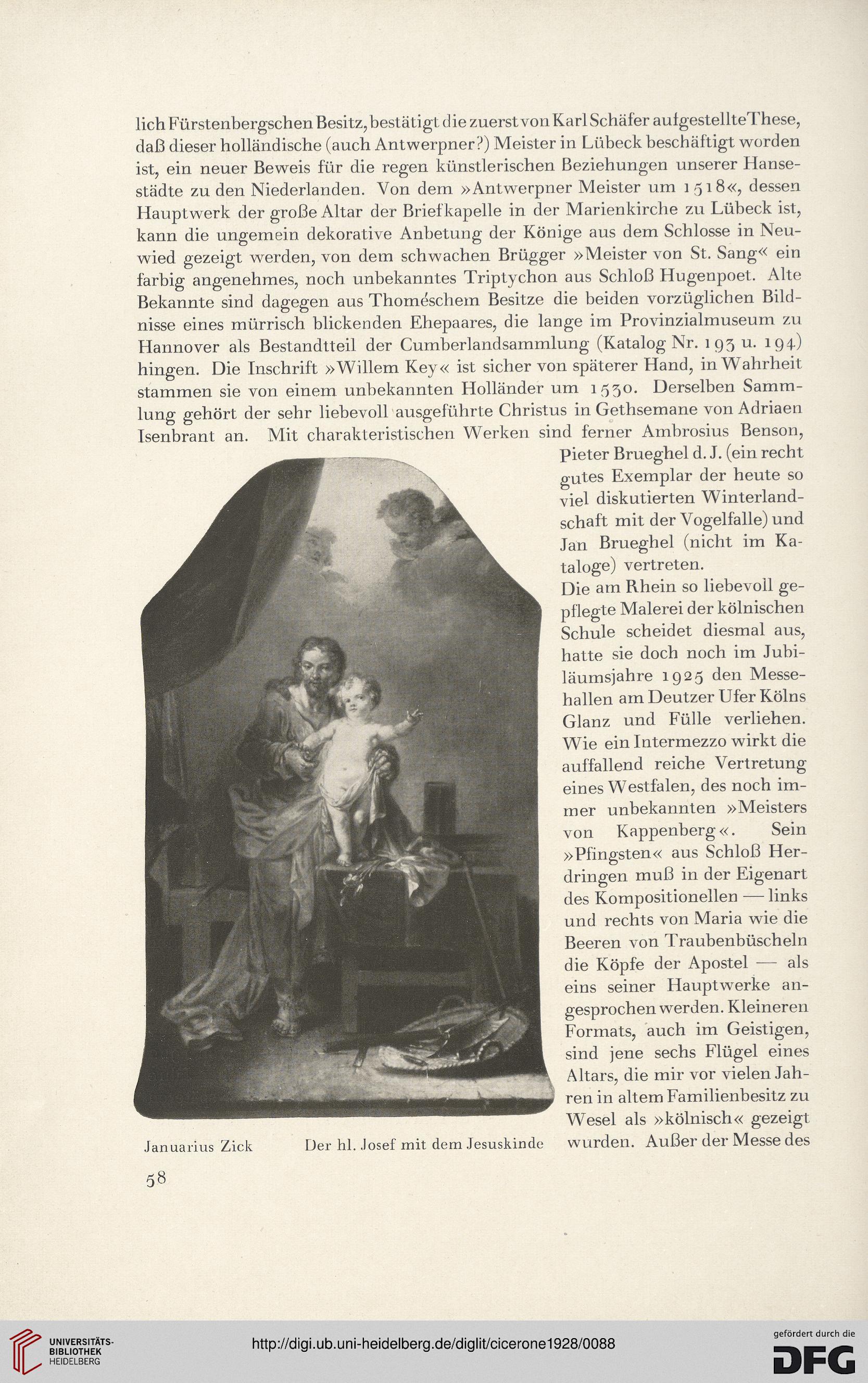Der Cicerone: Halbmonatsschrift für die Interessen des Kunstforschers & Sammlers — 20.1928
Cite this page
Please cite this page by using the following URL/DOI:
https://doi.org/10.11588/diglit.41322#0088
DOI issue:
Heft 2
DOI article:Cohen, Walter: Alte Malerei aus rheinisch-westfälischem Privatbesitz: zur Ausstellung in Düsseldorf
DOI Page / Citation link:https://doi.org/10.11588/diglit.41322#0088
lieh Fürstenbergschen Besitz, bestätigt die zuerst von Karl Schäfer aufgestellteThese,
daß dieser holländische (auch Antwerpner?) Meister in Lübeck beschäftigt worden
ist, ein neuer Beweis für die regen künstlerischen Beziehungen unserer Hanse-
städte zu den Niederlanden. Von dem »Antwerpner Meister um i 518«, dessen
Hauptwerk der große Altar der Brief kapelle in der Marienkirche zu Lübeck ist,
kann die ungemein dekorative Anbetung der Könige aus dem Schlosse in Neu-
wied gezeigt werden, von dem schwachen Brügger »Meister von St. Sang« ein
farbig angenehmes, noch unbekanntes Triptychon aus Schloß Hugenpoet. Alte
Bekannte sind dagegen aus Thomeschem Besitze die beiden vorzüglichen Bild-
nisse eines mürrisch blickenden Ehepaares, die lange im Provinzialmuseum zu
Hannover als Bestandtteil der Cumberlandsammlung (Katalog Nr. 195 u. 194)
hingen. Die Inschrift »Willem Key« ist sicher von späterer Hand, in Wahrheit
stammen sie von einem unbekannten Holländer um 1530. Derselben Samm-
lung gehört der sehr liebevoll ausgeführte Christus in Gethsemane von Adriaen
Isenbrant an. Mit charakteristischen Werken sind ferner Ambrosius Benson,
Januarius Zick Der hl. Josef
mit dem Jesuskinde
Pieter Brueghel d. J. (ein recht
gutes Exemplar der heute so
viel diskutierten Winterland-
schaft mit der Vogelfalle) und
Jan Brueghel (nicht im Ka-
taloge) vertreten.
Die am Rhein so liebevoll ge-
pflegte Malerei der kölnischen
Schule scheidet diesmal aus,
hatte sie doch noch im Jubi-
läumsjahre 1925 den Messe-
hallen am Deutzer Ufer Kölns
Glanz und Fülle verliehen.
Wie ein Intermezzo wirkt die
auffallend reiche Vertretung
eines Westfalen, des noch im-
mer unbekannten »Meisters
von Kappenberg«. Sein
»Pfingsten« aus Schloß Her-
dringen muß in der Eigenart
des Kompositionellen — links
und rechts von Maria wie die
Beeren von Traubenbüscheln
die Köpfe der Apostel -— als
eins seiner Hauptwerke an-
gesprochen werden. Kleineren
Formats, auch im Geistigen,
sind jene sechs Flügel eines
Altars, die mir vor vielen Jah-
ren in altem Familienbesitz zu
Wesel als »kölnisch« gezeigt
wurden. Außer der Messe des