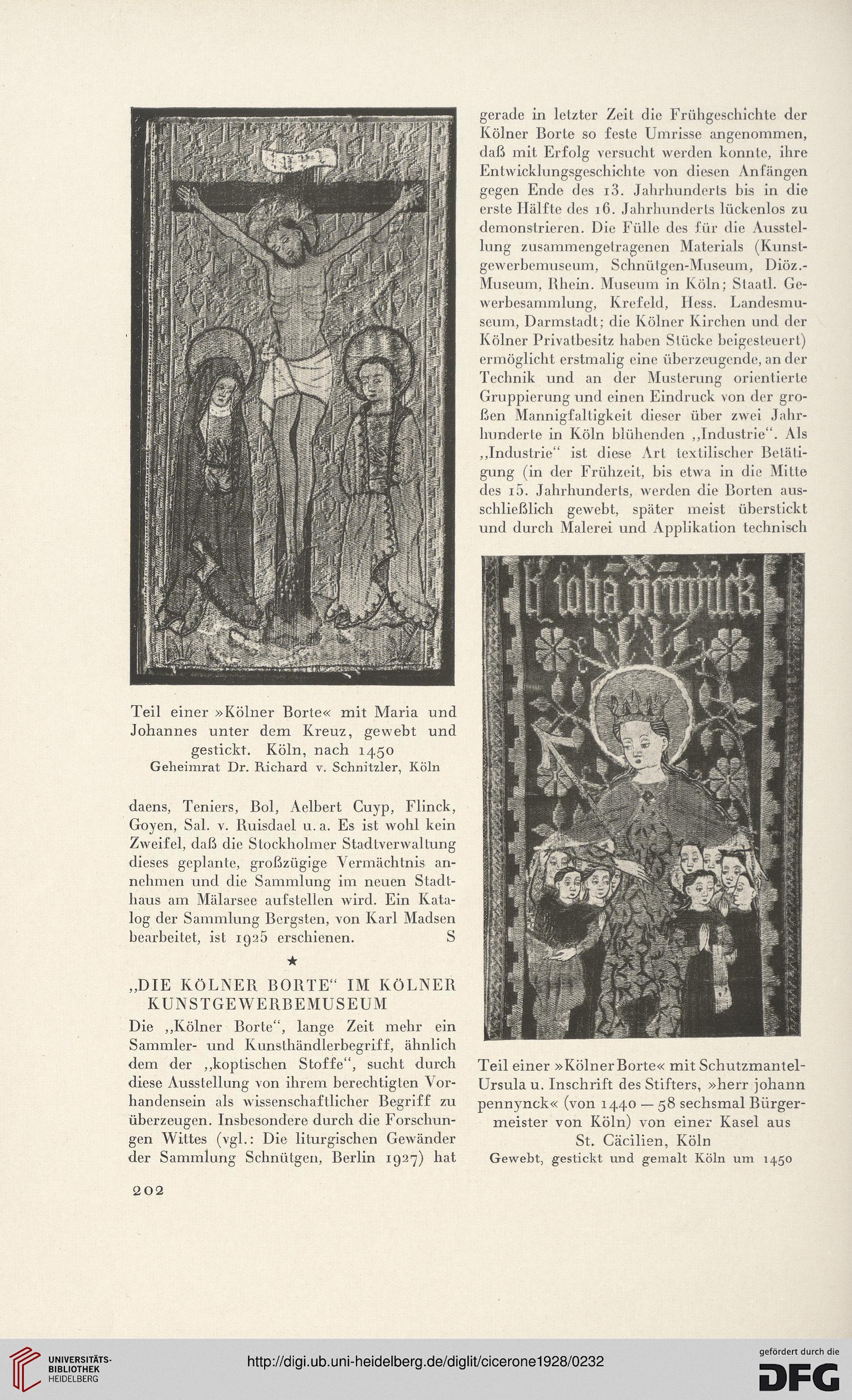Der Cicerone: Halbmonatsschrift für die Interessen des Kunstforschers & Sammlers — 20.1928
Zitieren dieser Seite
Bitte zitieren Sie diese Seite, indem Sie folgende Adresse (URL)/folgende DOI benutzen:
https://doi.org/10.11588/diglit.41322#0232
DOI Heft:
Heft 6
DOI Artikel:Rundschau
DOI Seite / Zitierlink:https://doi.org/10.11588/diglit.41322#0232
Teil einer »Kölner Borte« mit Maria und
Johannes unter dem Kreuz, gewebt und
gestickt. Köln, nach 1450
Geheimrat Dr. Richard v. Schnitzler, Köln
daens, Teniers, Bol, Aelbert Cuyp, Flinck,
Goyen, Sal. v. Ruisdael u.a. Es ist wohl kein
Zweifel, daß die Stockholmer Stadtverwaltung
dieses geplante, großzügige Vermächtnis an-
nehmen und die Sammlung im neuen Stadt-
haus am Mälarsee aufstellen wird. Ein Kata-
log der Sammlung Bcrgsten, von Karl Madsen
bearbeitet, ist 1926 erschienen. S
★
„DIE KÖLNER BORTE“ IM KÖLNER
KUNSTGEWERBEMUSEUM
Die „Kölner Borte“, lange Zeit mehr ein
Sammler- und Kunsthändlerbegriff, ähnlich
dem der „koptischen Stoffe“, sucht durch
diese Ausstellung von ihrem berechtigten Vor-
handensein als wissenschaftlicher Begriff zu
überzeugen. Insbesondere durch die Forschun-
gen Wittes (vgl.: Die liturgischen Gewänder
der Sammlung Schnütgen, Berlin 1927) hat
gerade in letzter Zeit die Frühgeschichte der
Kölner Borte so feste Umrisse angenommen,
daß mit Erfolg versucht werden konnte, ihre
Entwicklungsgeschichte von diesen Anfängen
gegen Ende des i3. Jahrhunderts bis in die
erste Hälfte des 16. Jahrhunderts lückenlos zu
demonstrieren. Die Fülle des für die Ausstel-
lung zusammengetragenen Materials (Kunst-
gewerbemuseum, Schnütgen-Museum, Diöz.-
Museum, Rhein. Museum in Köln; Staatl. Ge-
werbesammlung, Krefeld, Hess. Landesmu-
seum, Darmstadt; die Kölner Kirchen und der
Kölner Privatbesitz haben Stücke beigesteuert)
ermöglicht erstmalig eine überzeugende, an der
Technik und an der Musterung orientierte
Gruppierung und einen Eindruck von der gro-
ßen Mannigfaltigkeit dieser über zwei Jahr-
hunderte in Köln blühenden „Industrie“. Als
„Industrie“ ist diese Art iextilischer Betäti-
gung (in der Frühzeit, bis etwa in die Mitte
des i5. Jahrhunderts, werden die Borten aus-
schließlich gewebt, später meist überstickt
und durch Malerei und Applikation technisch
Teil einer »Kölner Borte« mit Schutzmantel-
Ursula u. Inschrift des Stifters, »herr johann
pennynck« (von 1440 — 58 sechsmal Bürger-
meister von Köln) von einer Kasel aus
St. Cäcilien, Köln
Gewebt, gestickt und gemalt Köln um 1450
202