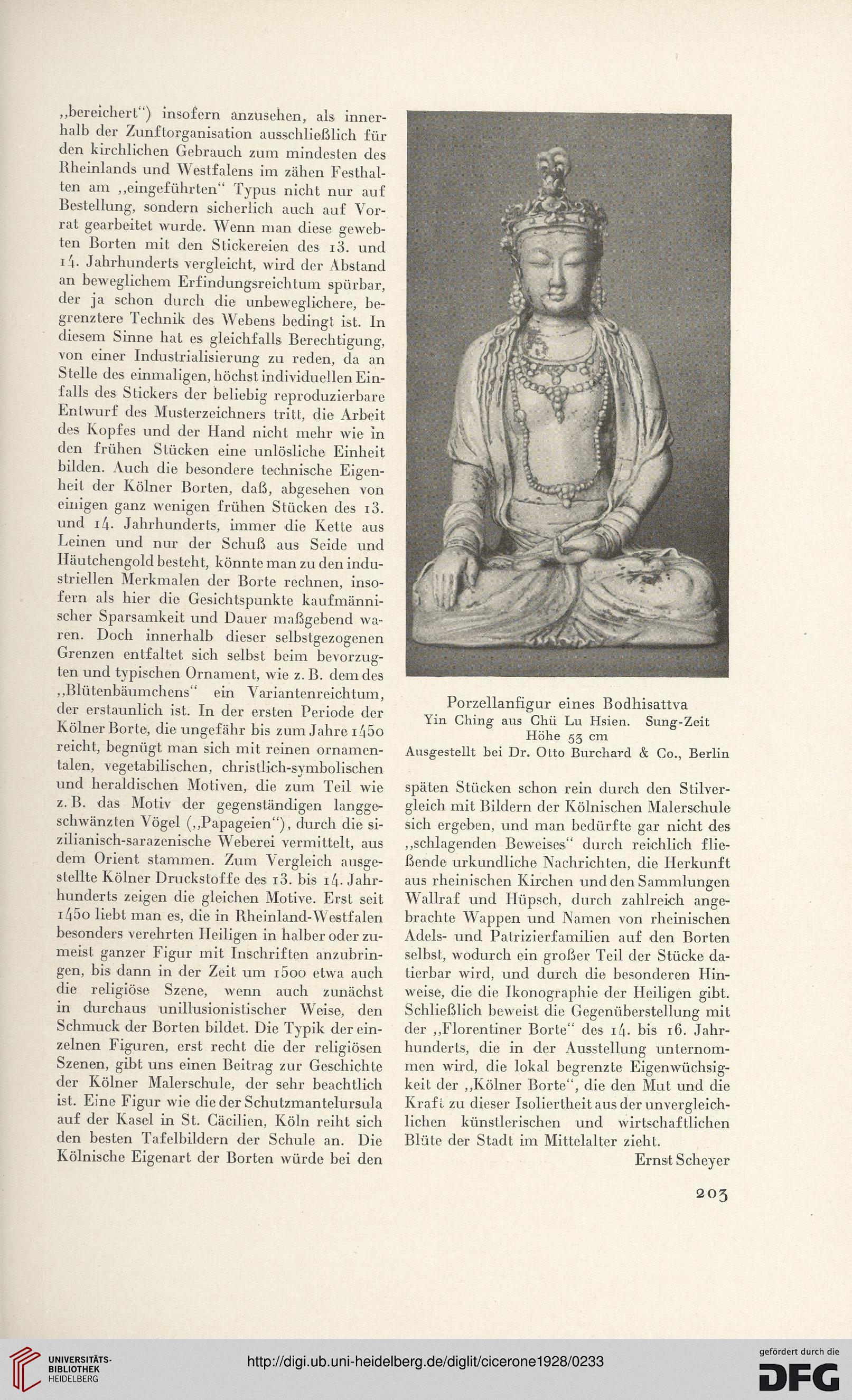„bereichert“) insofern anzusehen, als inner-
halb der Zunftorganisation ausschließlich für
den kirchlichen Gebrauch zum mindesten des
Rheinlands und Westfalens im zähen Festhal-
ten am „eingeführten“ Typus nicht nur auf
Bestellung, sondern sicherlich auch auf Vor-
rat gearbeitet wurde. Wenn man diese geweb-
ten Borten mit den Stickereien des i3. und
i4- Jahrhunderts vergleicht, wird der Abstand
an beweglichem Erfindungsreichtum spürbar,
der ja schon durch die unbeweglichere, be-
grenztere Technik des Webens bedingt ist. In
diesem Sinne hat es gleichfalls Berechtigung,
von einer Industrialisierung zu reden, da an
Stelle des einmaligen, höchst individuellen Ein-
falls des Stickers der beliebig reproduzierbare
Entwurf des Musterzeichners tritt, die Arbeit
des Kopfes und der Hand nicht mehr wie In
den frühen Stücken eine unlösliche Einheit
bilden. Auch die besondere technische Eigen-
heit der Kölner Borten, daß, abgesehen von
einigen ganz wenigen frühen Stücken des i3.
und i4. Jahrhunderts, immer die Kette aus
Leinen und nur der Schuß aus Seide und
Iläutchengold besteht, könnte man zu den indu-
striellen Merkmalen der Borte rechnen, inso-
fern als hier die Gesichtspunkte kaufmänni-
scher Sparsamkeit und Dauer maßgebend wa-
ren. Doch innerhalb dieser selbstgezogenen
Grenzen entfaltet sich selbst beim bevorzug-
ten und typischen Ornament, wie z. B. dem des
„Blütenbäumchens“ ein Variantenreichtum,
der erstaunlich ist. In der ersten Periode der
Kölner Borte, die ungefähr bis zum Jahre i45o
reicht, begnügt man sich mit reinen ornamen-
talen, vegetabilischen, christlich-symbolischen
und heraldischen Motiven, die zum Teil wie
z.B. das Motiv der gegenständigen langge-
schwänzten Vögel („Papageien“), durch die si-
zilianisch-sarazenische Weberei vermittelt, aus
dem Orient stammen. Zum Vergleich ausge-
stellte Kölner Druckstoffe des i3. bis i4. Jahr-
hunderts zeigen die gleichen Motive. Erst seit
i45o liebt man es, die in Rheinland-Westfalen
besonders verehrten Heiligen in halber oder zu-
meist. ganzer Figur mit Inschriften anzubrin-
gen, bis dann in der Zeit um i5oo etwa auch
die religiöse Szene, wenn auch zunächst
in durchaus unillusionistischer Weise, den
Schmuck der Borten bildet. Die Typik der ein-
zelnen Figuren, erst recht die der religiösen
Szenen, gibt uns einen Beitrag zur Geschichte
der Kölner Malerschule, der sehr beachtlich
ist. Eine Figur wie die der Schutzmantelursula
auf der Kasel in St. Cäcilien, Köln reiht sich
den besten Tafelbildern der Schule an. Die
Kölnische Eigenart der Borten würde bei den
Porzellanfigur eines Bodhisattva
Yin Ching aus Chü Lu Hsien. Sung-Zeit
Höhe 53 cm
Ausgestellt hei Dr. Otto Burchard & Co., Berlin
späten Stücken schon rein durch den Stilver-
gleich mit Bildern der Kölnischen Malerschule
sich ergeben, und man bedürfte gar nicht des
„schlagenden Beweises“ durch reichlich flie-
ßende urkundliche Nachrichten, die Herkunft
aus rheinischen Kirchen und den Sammlungen
Wallraf und Hüpsch, durch zahlreich ange-
brachte Wappen und Namen von rheinischen
Adels- und Patrizierfamilien auf den Borten
selbst, wodurch ein großer Teil der Stücke da-
tierbar wird, und durch die besonderen Hin-
weise, die die Ikonographie der Heiligen gibt.
Schließlich beweist die Gegenüberstellung mit
der „Florentiner Borte“ des i4- bis 16. Jahr-
hunderts, die in der Ausstellung unternom-
men wird, die lokal begrenzte Eigenwüchsig-
keit der „Kölner Borte“, die den Mut und die
Kraft zu dieser Isoliertheit aus der unvergleich-
lichen künstlerischen und wirtschaftlichen
Blüte der Stadt im Mittelalter zieht.
Ernst Scheyer
203
halb der Zunftorganisation ausschließlich für
den kirchlichen Gebrauch zum mindesten des
Rheinlands und Westfalens im zähen Festhal-
ten am „eingeführten“ Typus nicht nur auf
Bestellung, sondern sicherlich auch auf Vor-
rat gearbeitet wurde. Wenn man diese geweb-
ten Borten mit den Stickereien des i3. und
i4- Jahrhunderts vergleicht, wird der Abstand
an beweglichem Erfindungsreichtum spürbar,
der ja schon durch die unbeweglichere, be-
grenztere Technik des Webens bedingt ist. In
diesem Sinne hat es gleichfalls Berechtigung,
von einer Industrialisierung zu reden, da an
Stelle des einmaligen, höchst individuellen Ein-
falls des Stickers der beliebig reproduzierbare
Entwurf des Musterzeichners tritt, die Arbeit
des Kopfes und der Hand nicht mehr wie In
den frühen Stücken eine unlösliche Einheit
bilden. Auch die besondere technische Eigen-
heit der Kölner Borten, daß, abgesehen von
einigen ganz wenigen frühen Stücken des i3.
und i4. Jahrhunderts, immer die Kette aus
Leinen und nur der Schuß aus Seide und
Iläutchengold besteht, könnte man zu den indu-
striellen Merkmalen der Borte rechnen, inso-
fern als hier die Gesichtspunkte kaufmänni-
scher Sparsamkeit und Dauer maßgebend wa-
ren. Doch innerhalb dieser selbstgezogenen
Grenzen entfaltet sich selbst beim bevorzug-
ten und typischen Ornament, wie z. B. dem des
„Blütenbäumchens“ ein Variantenreichtum,
der erstaunlich ist. In der ersten Periode der
Kölner Borte, die ungefähr bis zum Jahre i45o
reicht, begnügt man sich mit reinen ornamen-
talen, vegetabilischen, christlich-symbolischen
und heraldischen Motiven, die zum Teil wie
z.B. das Motiv der gegenständigen langge-
schwänzten Vögel („Papageien“), durch die si-
zilianisch-sarazenische Weberei vermittelt, aus
dem Orient stammen. Zum Vergleich ausge-
stellte Kölner Druckstoffe des i3. bis i4. Jahr-
hunderts zeigen die gleichen Motive. Erst seit
i45o liebt man es, die in Rheinland-Westfalen
besonders verehrten Heiligen in halber oder zu-
meist. ganzer Figur mit Inschriften anzubrin-
gen, bis dann in der Zeit um i5oo etwa auch
die religiöse Szene, wenn auch zunächst
in durchaus unillusionistischer Weise, den
Schmuck der Borten bildet. Die Typik der ein-
zelnen Figuren, erst recht die der religiösen
Szenen, gibt uns einen Beitrag zur Geschichte
der Kölner Malerschule, der sehr beachtlich
ist. Eine Figur wie die der Schutzmantelursula
auf der Kasel in St. Cäcilien, Köln reiht sich
den besten Tafelbildern der Schule an. Die
Kölnische Eigenart der Borten würde bei den
Porzellanfigur eines Bodhisattva
Yin Ching aus Chü Lu Hsien. Sung-Zeit
Höhe 53 cm
Ausgestellt hei Dr. Otto Burchard & Co., Berlin
späten Stücken schon rein durch den Stilver-
gleich mit Bildern der Kölnischen Malerschule
sich ergeben, und man bedürfte gar nicht des
„schlagenden Beweises“ durch reichlich flie-
ßende urkundliche Nachrichten, die Herkunft
aus rheinischen Kirchen und den Sammlungen
Wallraf und Hüpsch, durch zahlreich ange-
brachte Wappen und Namen von rheinischen
Adels- und Patrizierfamilien auf den Borten
selbst, wodurch ein großer Teil der Stücke da-
tierbar wird, und durch die besonderen Hin-
weise, die die Ikonographie der Heiligen gibt.
Schließlich beweist die Gegenüberstellung mit
der „Florentiner Borte“ des i4- bis 16. Jahr-
hunderts, die in der Ausstellung unternom-
men wird, die lokal begrenzte Eigenwüchsig-
keit der „Kölner Borte“, die den Mut und die
Kraft zu dieser Isoliertheit aus der unvergleich-
lichen künstlerischen und wirtschaftlichen
Blüte der Stadt im Mittelalter zieht.
Ernst Scheyer
203