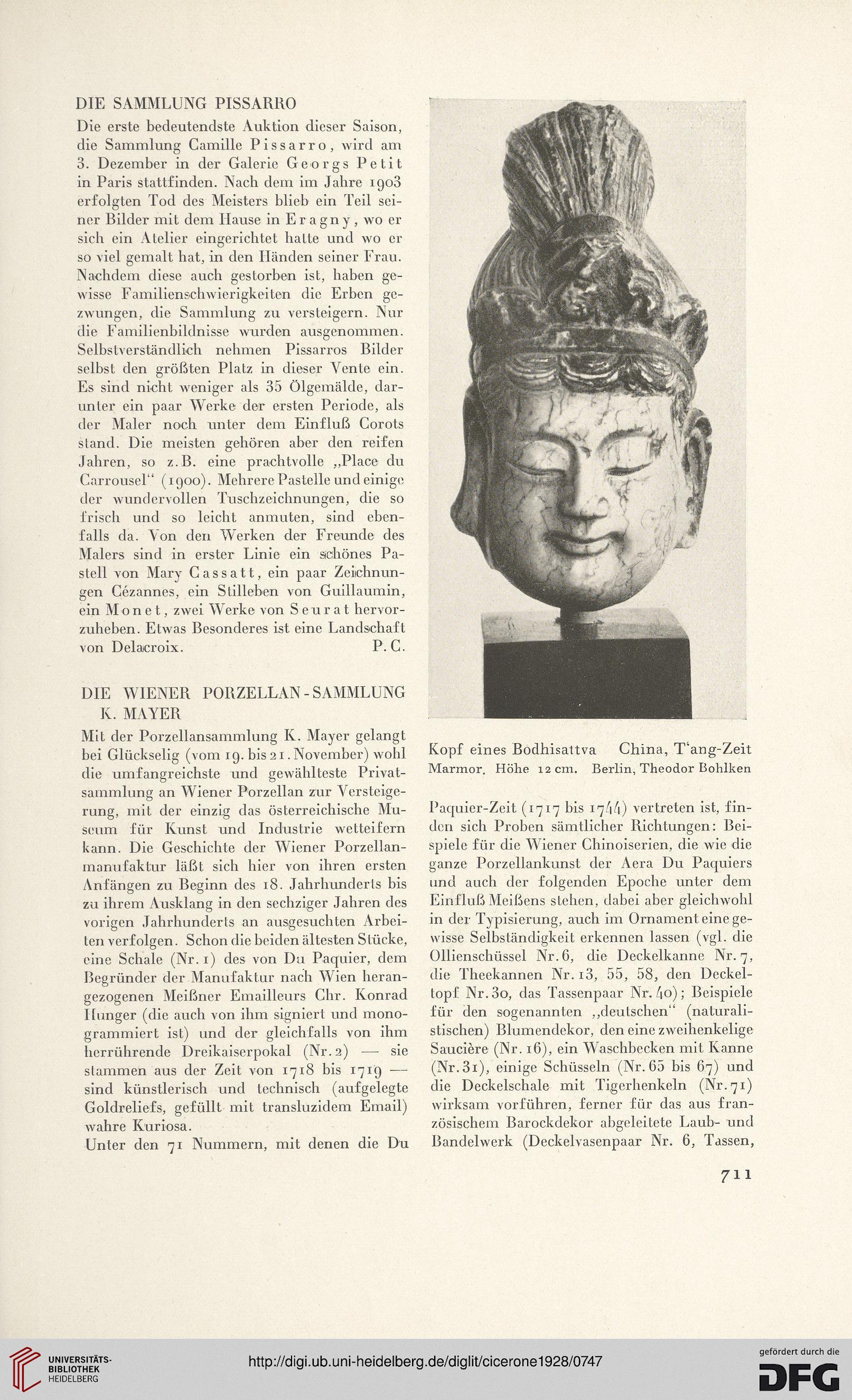DIE SAMMLUNG PISSARRO
Die erste bedeutendste Auktion dieser Saison,
die Sammlung Camille Pissarro, wird am
3. Dezember in der Galerie Georgs Petit
in Paris stattfinden. Nach dem im Jahre 1900
erfolgten Tod des Meisters blieb ein Teil sei-
ner Rüder mit dem Hause in E r a g n y , wo er
sich ein Atelier eingerichtet halte und wo er
so viel gemalt hat, in den Händen seiner Frau.
Nachdem diese auch gestorben ist, haben ge-
wisse Familienschwierigkeiten die Erben ge-
zwungen, die Sammlung zu versteigern. Nur
die Familienbildnisse wurden ausgenommen.
Selbstverständlich nehmen Pissarros Rüder
selbst den größten Platz in dieser Vente ein.
Es sind nicht weniger als 35 Ölgemälde, dar-
unter ein paar Werke der ersten Periode, als
der Maler noch unter dem Einfluß Corots
stand. Die meisten gehören aber den reifen
Jahren, so z.B. eine prachtvolle „Place du
Carrousel“ (1900). Mehrere Pastelle und einige
der wundervollen Tuschzeichnungen, die so
frisch und so leicht anmuten, sind eben-
falls da. Von den Werken der Freunde des
Malers sind in erster Linie ein schönes Pa-
stell von Mary Cassatt, ein paar Zeichnun-
gen Cezannes, ein Stilleben von Guillaumin,
ein Monet, zwei Werke von S eu r a t hervor-
zuheben. Etwas Besonderes ist eine Landschaft
von Delacroix. P. C.
DIE WIENER PORZELLAN-SAMMLUNG
K. MAYER
Mit der Porzellansammlung Iv. Mayer gelangt
bei Glückselig (vom 19. bis 21. November) wohl
die umfangreichste und gewählteste Privat-
sammlung an Wiener Porzellan zur Versteige-
rung, mit der einzig das österreichische Mu-
seum für Kunst und Industrie wetteifern
kann. Die Geschichte der Wiener Porzellan-
manufaktur läßt sich hier von ihren ersten
Anfängen zu Beginn des 18. Jahrhunderts bis
zu ihrem Ausklang in den sechziger Jahren des
vorigen Jahrhunderts an ausgesuchten Arbei-
ten verfolgen. Schon die beiden ältesten S lücke,
eine Schale (Nr. 1) des von Du Paquier, dem
Begründer der Manufaktur nach Wien heran-
gezogenen Meißner Emailleurs Chr. Konrad
Hunger (die auch von ihm signiert und mono-
grammiert ist) und der gleichfalls von ihm
herrührende Dreikaiserpokal (Nr. 2) —- sie
stammen aus der Zeit von 1718 bis 1719 —
sind künstlerisch und technisch (aufgelegte
Goldreliefs, gefüllt mit transluzidem Email)
wahre Kuriosa.
Unter den 71 Nummern, mit denen die Du
Kopf eines Bodhisattva China, T‘ang-Zeit
Marmor. Höhe 12 cm. Berlin, Theodor Bohlken
Paquier-Zeit (1717 bis 17/14) vertreten ist, fin-
den sich Proben sämtlicher Richtungen: Bei-
spiele für die Wiener Chinoiserien, die wie die
ganze Porzellankunst der Aera Du Paquiers
und auch der folgenden Epoche unter dem
Einfluß Meißens stehen, dabei aber gleichwohl
in der Typisierung, auch im Ornament eine ge-
wisse Selbständigkeit erkennen lassen (vgl. die
Ollienschüssel Nr. 6, die Deckelkanne Nr. 7,
die Theekannen Nr. i3, 55, 58, den Deckel-
topf Nr.3o, das Tassenpaar Nr. 4o); Beispiele
für den sogenannten „deutschen“ (naturali-
stischen) Blumendekor, den eine zweihenkelige
Sauciere (Nr. 16), ein Waschbecken mit Kanne
(Nr.3i), einige Schüsseln (Nr. 65 bis 67) und
die Deckelschale mit Tigerhenkeln (Nr. 71)
wirksam vorführen, ferner für das aus fran-
zösischem Barockdekor abgeleitete Laub- und
Bandelwerk (Deckelvasenpaar Nr. 6, Tassen,
711
Die erste bedeutendste Auktion dieser Saison,
die Sammlung Camille Pissarro, wird am
3. Dezember in der Galerie Georgs Petit
in Paris stattfinden. Nach dem im Jahre 1900
erfolgten Tod des Meisters blieb ein Teil sei-
ner Rüder mit dem Hause in E r a g n y , wo er
sich ein Atelier eingerichtet halte und wo er
so viel gemalt hat, in den Händen seiner Frau.
Nachdem diese auch gestorben ist, haben ge-
wisse Familienschwierigkeiten die Erben ge-
zwungen, die Sammlung zu versteigern. Nur
die Familienbildnisse wurden ausgenommen.
Selbstverständlich nehmen Pissarros Rüder
selbst den größten Platz in dieser Vente ein.
Es sind nicht weniger als 35 Ölgemälde, dar-
unter ein paar Werke der ersten Periode, als
der Maler noch unter dem Einfluß Corots
stand. Die meisten gehören aber den reifen
Jahren, so z.B. eine prachtvolle „Place du
Carrousel“ (1900). Mehrere Pastelle und einige
der wundervollen Tuschzeichnungen, die so
frisch und so leicht anmuten, sind eben-
falls da. Von den Werken der Freunde des
Malers sind in erster Linie ein schönes Pa-
stell von Mary Cassatt, ein paar Zeichnun-
gen Cezannes, ein Stilleben von Guillaumin,
ein Monet, zwei Werke von S eu r a t hervor-
zuheben. Etwas Besonderes ist eine Landschaft
von Delacroix. P. C.
DIE WIENER PORZELLAN-SAMMLUNG
K. MAYER
Mit der Porzellansammlung Iv. Mayer gelangt
bei Glückselig (vom 19. bis 21. November) wohl
die umfangreichste und gewählteste Privat-
sammlung an Wiener Porzellan zur Versteige-
rung, mit der einzig das österreichische Mu-
seum für Kunst und Industrie wetteifern
kann. Die Geschichte der Wiener Porzellan-
manufaktur läßt sich hier von ihren ersten
Anfängen zu Beginn des 18. Jahrhunderts bis
zu ihrem Ausklang in den sechziger Jahren des
vorigen Jahrhunderts an ausgesuchten Arbei-
ten verfolgen. Schon die beiden ältesten S lücke,
eine Schale (Nr. 1) des von Du Paquier, dem
Begründer der Manufaktur nach Wien heran-
gezogenen Meißner Emailleurs Chr. Konrad
Hunger (die auch von ihm signiert und mono-
grammiert ist) und der gleichfalls von ihm
herrührende Dreikaiserpokal (Nr. 2) —- sie
stammen aus der Zeit von 1718 bis 1719 —
sind künstlerisch und technisch (aufgelegte
Goldreliefs, gefüllt mit transluzidem Email)
wahre Kuriosa.
Unter den 71 Nummern, mit denen die Du
Kopf eines Bodhisattva China, T‘ang-Zeit
Marmor. Höhe 12 cm. Berlin, Theodor Bohlken
Paquier-Zeit (1717 bis 17/14) vertreten ist, fin-
den sich Proben sämtlicher Richtungen: Bei-
spiele für die Wiener Chinoiserien, die wie die
ganze Porzellankunst der Aera Du Paquiers
und auch der folgenden Epoche unter dem
Einfluß Meißens stehen, dabei aber gleichwohl
in der Typisierung, auch im Ornament eine ge-
wisse Selbständigkeit erkennen lassen (vgl. die
Ollienschüssel Nr. 6, die Deckelkanne Nr. 7,
die Theekannen Nr. i3, 55, 58, den Deckel-
topf Nr.3o, das Tassenpaar Nr. 4o); Beispiele
für den sogenannten „deutschen“ (naturali-
stischen) Blumendekor, den eine zweihenkelige
Sauciere (Nr. 16), ein Waschbecken mit Kanne
(Nr.3i), einige Schüsseln (Nr. 65 bis 67) und
die Deckelschale mit Tigerhenkeln (Nr. 71)
wirksam vorführen, ferner für das aus fran-
zösischem Barockdekor abgeleitete Laub- und
Bandelwerk (Deckelvasenpaar Nr. 6, Tassen,
711