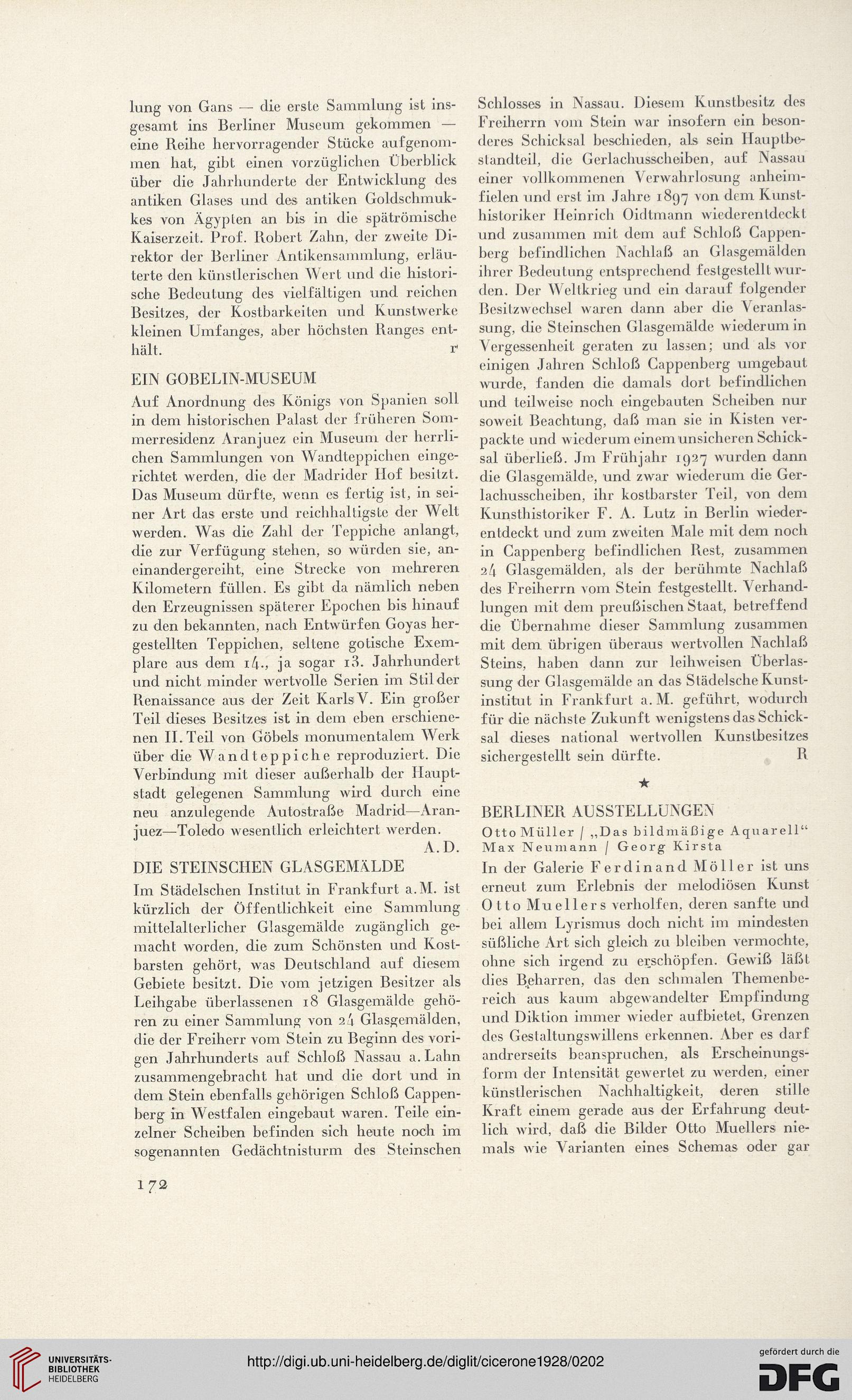lung von Gans — die erste Sammlung ist ins-
gesamt ins Berliner Museum gekommen —
eine Reihe hervorragender Stücke aufgenom-
men hat, gibt einen vorzüglichen Überblick
über die Jahrhunderte der Entwicklung des
antiken Glases und des antiken Goldschmuk-
kes von Ägypten an bis in die spätrömische
Kaiserzeit. Prof. Robert Zahn, der zweite Di-
rektor der Berliner Antikensammlung, erläu-
terte den künstlerischen Wert und die histori-
sche Bedeutung des vielfältigen und reichen
Besitzes, der Kostbarkeiten und Kunstwerke
kleinen Umfanges, aber höchsten Ranges ent-
hält. r
EIN GOBELIN-MUSEUM
Auf Anordnung des Königs von Spanien soll
in dem historischen Palast der früheren Som-
merresidenz Aranjuez ein Museum der herrli-
chen Sammlungen von Wandteppichen einge-
richtet werden, die der Madrider Hof besitzt.
Das Museum dürfte, wenn es fertig ist, in sei-
ner Art das erste und reichhaltigste der Welt
werden. Was die Zahl der Teppiche anlangt,
die zur Verfügung stehen, so würden sie, an-
einandergereiht, eine Strecke von mehreren
Kilometern füllen. Es gibt da nämlich neben
den Erzeugnissen späterer Epochen bis hinauf
zu den bekannten, nach Entwürfen Goyas her-
gestellten Teppichen, seltene gotische Exem-
plare aus dem i4-, ja sogar i3. Jahrhundert
und nicht minder wertvolle Serien im Stil der
Renaissance aus der Zeit Karls V. Ein großer
Teil dieses Besitzes ist in dem eben erschiene-
nen II. Teil von Göbels monumentalem Werk
über die Wandteppiche reproduziert. Die
Verbindung mit dieser außerhalb der Haupt-
stadt gelegenen Sammlung wird durch eine
neu anzulegende Autostraße Madrid—Aran-
juez—Toledo wesentlich erleichtert werden.
A.D.
DIE STEINSCHEN GLASGEMÄLDE
Im Städelschen Institut in Frankfurt a.M. ist
kürzlich der Öffentlichkeit eine Sammlung
mittelalterlicher Glasgemälde zugänglich ge-
macht worden, die zum Schönsten und Kost-
barsten gehört, was Deutschland auf diesem
Gebiete besitzt. Die vom jetzigen Besitzer als
Leihgabe überlassenen 18 Glasgemälde gehö-
ren zu einer Sammlung von 2-4 Glasgemälden,
die der Freiherr vom Stein zu Beginn des vori-
gen Jahrhunderts auf Schloß Nassau a.Lahn
zusammengebracht hat und die dort und in
dem Stein ebenfalls gehörigen Schloß Cappen-
berg in Westfalen eingebaut waren. Teile ein-
zelner Scheiben befinden sich heute noch im
sogenannten Gedächtnisturm des Steinschen
Schlosses in Nassau. Diesem Kunstbesitz des
Freiherrn vom Stein war insofern ein beson-
deres Schicksal beschieden, als sein Hauptbe-
standteil, die Gerlachusscheiben, auf Nassau
einer vollkommenen Verwahrlosung anheim-
fielen und erst im Jahre 1897 von dem Kunst-
historiker Heinrich Oidtmann wiederentdeckt
und zusammen mit dem auf Schloß Cappen-
berg befindlichen Nachlaß an Glasgemälden
ihrer Bedeutung entsprechend fest gestellt wur-
den. Der Weltkrieg und ein darauf folgender
Besitzwechsel waren dann aber die Veranlas-
sung, die Steinschen Glasgemälde wiederum in
Vergessenheit geraten zu lassen; und als vor
einigen Jahren Schloß Cappenberg umgebaut
wurde, fanden die damals dort befindlichen
und teilweise noch eingebauten Scheiben nur
soweit Beachtung, daß man sie in Kisten ver-
packte und wiederum einem unsicheren Schick-
sal überließ. Jm Frühjahr 1927 wurden dann
die Glasgemälde, und zwar wiederum die Ger-
lachusscheiben, ihr kostbarster Teil, von dem
Kunsthistoriker F. A. Lutz in Berlin wieder-
entdeckt und zum zweiten Male mit dem noch
in Cappenberg befindlichen Rest, zusammen
2/; Glasgemälden, als der berühmte Nachlaß
des Freiherrn vom Stein festgestellt. Verhand-
lungen mit dem preußischen Staat, betreffend
die Übernahme dieser Sammlung zusammen
mit dem übrigen überaus wertvollen Nachlaß
Steins, haben dann zur leihweisen Überlas-
sung der Glasgemälde an das Städelsche Kunst-
institut in Frankfurt a. M. geführt, wodurch
für die nächste Zukunft wenigstens das Schick-
sal dieses national wertvollen Kunstbesitzes
sichergestellt sein dürfte. R
★
BERLINER AUSSTELLUNGEN
OttoMüller / „Das bildmäßige Aquarell“
Max Neumann / Georg Kirsta
In der Galerie Ferdinand Möller ist uns
erneut zum Erlebnis der melodiösen Kunst
Otto Muellers verholfen, deren sanfte und
bei allem Lyrismus doch nicht im mindesten
süßliche Art sich gleich zu bleiben vermochte,
ohne sich irgend zu erschöpfen. Gewiß läßt
dies Bpharren, das den schmalen Themenbe-
reich aus kaum abgewandelter Empfindung
und Diktion immer wieder aufbietet, Grenzen
des Gestaltungswillens erkennen. Aber es darf
andrerseits beanspruchen, als Erscheinungs-
form der Intensität gewertet zu werden, einer
künstlerischen Nachhaltigkeit, deren stille
Kraft einem gerade aus der Erfahrung deut-
lich wird, daß die Bilder Otto Muellers nie-
mals wie Varianten eines Schemas oder gar
gesamt ins Berliner Museum gekommen —
eine Reihe hervorragender Stücke aufgenom-
men hat, gibt einen vorzüglichen Überblick
über die Jahrhunderte der Entwicklung des
antiken Glases und des antiken Goldschmuk-
kes von Ägypten an bis in die spätrömische
Kaiserzeit. Prof. Robert Zahn, der zweite Di-
rektor der Berliner Antikensammlung, erläu-
terte den künstlerischen Wert und die histori-
sche Bedeutung des vielfältigen und reichen
Besitzes, der Kostbarkeiten und Kunstwerke
kleinen Umfanges, aber höchsten Ranges ent-
hält. r
EIN GOBELIN-MUSEUM
Auf Anordnung des Königs von Spanien soll
in dem historischen Palast der früheren Som-
merresidenz Aranjuez ein Museum der herrli-
chen Sammlungen von Wandteppichen einge-
richtet werden, die der Madrider Hof besitzt.
Das Museum dürfte, wenn es fertig ist, in sei-
ner Art das erste und reichhaltigste der Welt
werden. Was die Zahl der Teppiche anlangt,
die zur Verfügung stehen, so würden sie, an-
einandergereiht, eine Strecke von mehreren
Kilometern füllen. Es gibt da nämlich neben
den Erzeugnissen späterer Epochen bis hinauf
zu den bekannten, nach Entwürfen Goyas her-
gestellten Teppichen, seltene gotische Exem-
plare aus dem i4-, ja sogar i3. Jahrhundert
und nicht minder wertvolle Serien im Stil der
Renaissance aus der Zeit Karls V. Ein großer
Teil dieses Besitzes ist in dem eben erschiene-
nen II. Teil von Göbels monumentalem Werk
über die Wandteppiche reproduziert. Die
Verbindung mit dieser außerhalb der Haupt-
stadt gelegenen Sammlung wird durch eine
neu anzulegende Autostraße Madrid—Aran-
juez—Toledo wesentlich erleichtert werden.
A.D.
DIE STEINSCHEN GLASGEMÄLDE
Im Städelschen Institut in Frankfurt a.M. ist
kürzlich der Öffentlichkeit eine Sammlung
mittelalterlicher Glasgemälde zugänglich ge-
macht worden, die zum Schönsten und Kost-
barsten gehört, was Deutschland auf diesem
Gebiete besitzt. Die vom jetzigen Besitzer als
Leihgabe überlassenen 18 Glasgemälde gehö-
ren zu einer Sammlung von 2-4 Glasgemälden,
die der Freiherr vom Stein zu Beginn des vori-
gen Jahrhunderts auf Schloß Nassau a.Lahn
zusammengebracht hat und die dort und in
dem Stein ebenfalls gehörigen Schloß Cappen-
berg in Westfalen eingebaut waren. Teile ein-
zelner Scheiben befinden sich heute noch im
sogenannten Gedächtnisturm des Steinschen
Schlosses in Nassau. Diesem Kunstbesitz des
Freiherrn vom Stein war insofern ein beson-
deres Schicksal beschieden, als sein Hauptbe-
standteil, die Gerlachusscheiben, auf Nassau
einer vollkommenen Verwahrlosung anheim-
fielen und erst im Jahre 1897 von dem Kunst-
historiker Heinrich Oidtmann wiederentdeckt
und zusammen mit dem auf Schloß Cappen-
berg befindlichen Nachlaß an Glasgemälden
ihrer Bedeutung entsprechend fest gestellt wur-
den. Der Weltkrieg und ein darauf folgender
Besitzwechsel waren dann aber die Veranlas-
sung, die Steinschen Glasgemälde wiederum in
Vergessenheit geraten zu lassen; und als vor
einigen Jahren Schloß Cappenberg umgebaut
wurde, fanden die damals dort befindlichen
und teilweise noch eingebauten Scheiben nur
soweit Beachtung, daß man sie in Kisten ver-
packte und wiederum einem unsicheren Schick-
sal überließ. Jm Frühjahr 1927 wurden dann
die Glasgemälde, und zwar wiederum die Ger-
lachusscheiben, ihr kostbarster Teil, von dem
Kunsthistoriker F. A. Lutz in Berlin wieder-
entdeckt und zum zweiten Male mit dem noch
in Cappenberg befindlichen Rest, zusammen
2/; Glasgemälden, als der berühmte Nachlaß
des Freiherrn vom Stein festgestellt. Verhand-
lungen mit dem preußischen Staat, betreffend
die Übernahme dieser Sammlung zusammen
mit dem übrigen überaus wertvollen Nachlaß
Steins, haben dann zur leihweisen Überlas-
sung der Glasgemälde an das Städelsche Kunst-
institut in Frankfurt a. M. geführt, wodurch
für die nächste Zukunft wenigstens das Schick-
sal dieses national wertvollen Kunstbesitzes
sichergestellt sein dürfte. R
★
BERLINER AUSSTELLUNGEN
OttoMüller / „Das bildmäßige Aquarell“
Max Neumann / Georg Kirsta
In der Galerie Ferdinand Möller ist uns
erneut zum Erlebnis der melodiösen Kunst
Otto Muellers verholfen, deren sanfte und
bei allem Lyrismus doch nicht im mindesten
süßliche Art sich gleich zu bleiben vermochte,
ohne sich irgend zu erschöpfen. Gewiß läßt
dies Bpharren, das den schmalen Themenbe-
reich aus kaum abgewandelter Empfindung
und Diktion immer wieder aufbietet, Grenzen
des Gestaltungswillens erkennen. Aber es darf
andrerseits beanspruchen, als Erscheinungs-
form der Intensität gewertet zu werden, einer
künstlerischen Nachhaltigkeit, deren stille
Kraft einem gerade aus der Erfahrung deut-
lich wird, daß die Bilder Otto Muellers nie-
mals wie Varianten eines Schemas oder gar