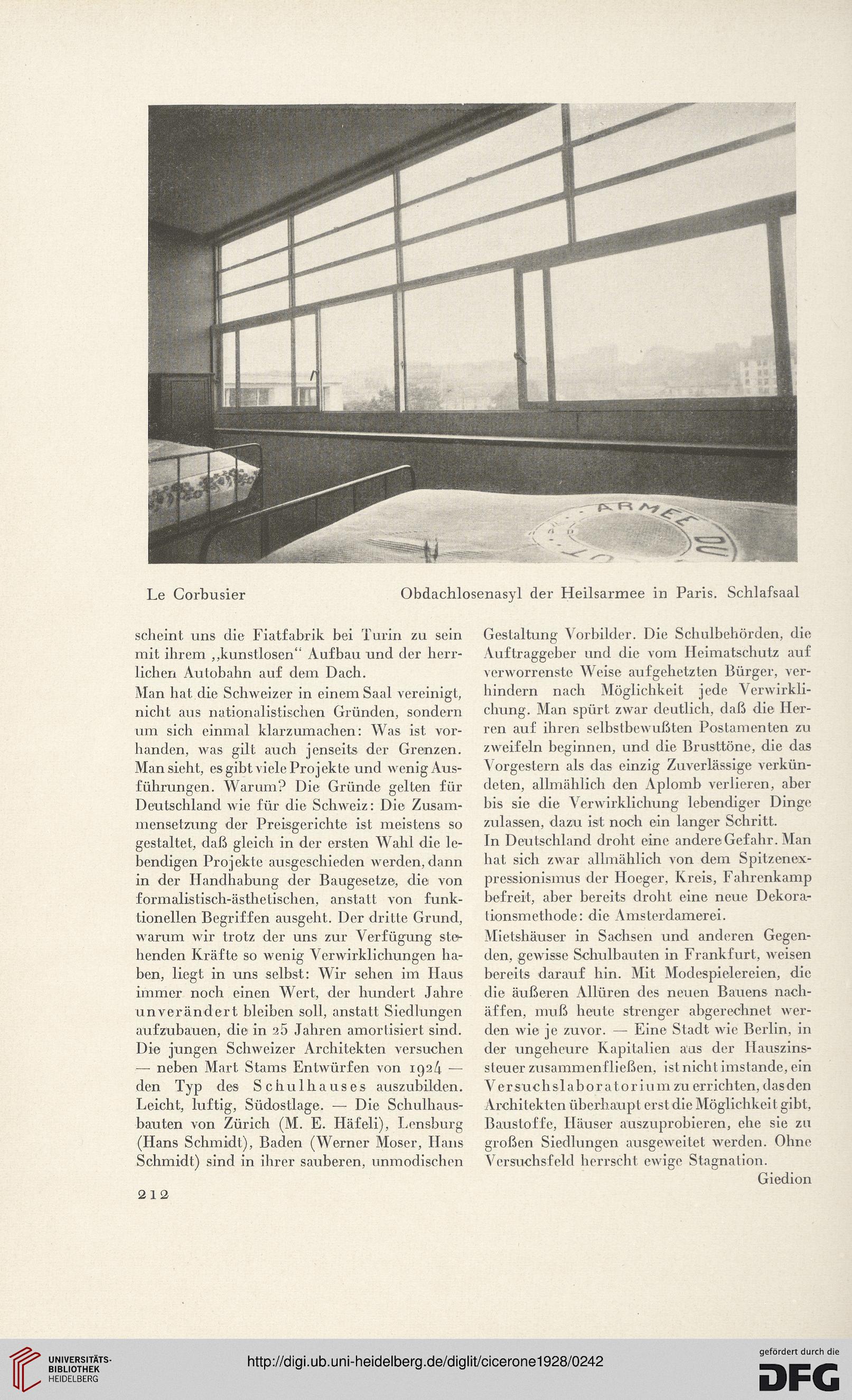Der Cicerone: Halbmonatsschrift für die Interessen des Kunstforschers & Sammlers — 20.1928
Zitieren dieser Seite
Bitte zitieren Sie diese Seite, indem Sie folgende Adresse (URL)/folgende DOI benutzen:
https://doi.org/10.11588/diglit.41322#0242
DOI Heft:
Heft 6
DOI Artikel:Zum neuen Bauen
DOI Seite / Zitierlink:https://doi.org/10.11588/diglit.41322#0242
Le Corbusier
Obdachlosenasyl der Heilsarmee in Paris. Schlafsaal
scheint uns die Fiatfabrik bei Turin zu sein
mit ihrem „kunstlosen“ Aufbau und der herr-
lichen Autobahn auf dem Dach.
Man hat die Schweizer in einem Saal vereinigt,
nicht aus nationalistischen Gründen, sondern
um sich einmal klarzumachen: Was ist vor-
handen, was gilt auch jenseits der Grenzen.
Man sieht, es gibt viele Projekte und wenig Aus-
führungen. Warum? Die Gründe gelten für
Deutschland wie für die Schweiz: Die Zusam-
mensetzung der Preisgerichte ist meistens so
gestaltet, daß gleich in der ersten Wahl die le-
bendigen Projekte ausgeschieden werden, dann
in der Handhabung der Baugesetze, die von
formalistisch-ästhetischen, anstatt von funk-
tionellen Begriffen ausgeht. Der dritte Grund,
warum wir trotz der uns zur Verfügung ste-
henden Kräfte so wenig Verwirklichungen ha-
ben, liegt in uns selbst: Wir sehen im Haus
immer noch einen Wert, der hundert Jahre
unverändert bleiben soll, anstatt Siedlungen
aufzubauen, die in 25 Jahren amortisiert sind.
Die jungen Schweizer Architekten versuchen
— neben Mart Stams Entwürfen von 1924 —
den Typ des Schulhauses auszubilden.
Leicht, luftig, Südostlage. — Die Schulhaus-
bauten von Zürich (M. E. Häfeli), Lensburg
(Hans Schmidt), Baden (Werner Moser, Hans
Schmidt) sind in ihrer sauberen, unmodischen
Gestaltung Vorbilder. Die Schulbehörden, die
Auftraggeber und die vom Heimatschutz auf
verworrenste Weise aufgehetzten Bürger, ver-
hindern nach Möglichkeit jede Verwirkli-
chung. Man spürt zwar deutlich, daß die Her-
ren auf ihren selbstbewußten Postamenten zu
zweifeln beginnen, und die Brusttöne, die das
Vorgestern als das einzig Zuverlässige verkün-
deten, allmählich den Aplomb verlieren, aber
bis sie die Verwirklichung lebendiger Dinge
zulassen, dazu ist noch ein langer Schritt.
In Deutschland droht eine andere Gefahr. Man
hat sich zwar allmählich von dem Spitzenex-
pressionismus der Hoeger, Kreis, Fahrenkamp
befreit, aber bereits droht eine neue Dekora-
tionsmethode: die Amsterdamerei.
Mietshäuser in Sachsen und anderen Gegen-
den, gewisse Schulbauten in Frankfurt, weisen
bereits darauf hin. Mit Modespielereien, die
die äußeren Allüren des neuen Bauens nach-
äffen, muß heute strenger abgerechnet wer-
den wie je zuvor. — Eine Stadt wie Berlin, in
der ungeheure Kapitalien aus der Hauszins-
steuer zusammenfließen, ist nicht imstande, ein
Versuchslabor at orium zu errichten, dasden
Architekten überhaupt erst die Möglichkeit gibt,
Baustoffe, Häuser auszuprobieren, ehe sie zu
großen Siedlungen ausgeweitet werden. Ohne
Versuchsfeld herrscht ewige Stagnation.
Giedion
Obdachlosenasyl der Heilsarmee in Paris. Schlafsaal
scheint uns die Fiatfabrik bei Turin zu sein
mit ihrem „kunstlosen“ Aufbau und der herr-
lichen Autobahn auf dem Dach.
Man hat die Schweizer in einem Saal vereinigt,
nicht aus nationalistischen Gründen, sondern
um sich einmal klarzumachen: Was ist vor-
handen, was gilt auch jenseits der Grenzen.
Man sieht, es gibt viele Projekte und wenig Aus-
führungen. Warum? Die Gründe gelten für
Deutschland wie für die Schweiz: Die Zusam-
mensetzung der Preisgerichte ist meistens so
gestaltet, daß gleich in der ersten Wahl die le-
bendigen Projekte ausgeschieden werden, dann
in der Handhabung der Baugesetze, die von
formalistisch-ästhetischen, anstatt von funk-
tionellen Begriffen ausgeht. Der dritte Grund,
warum wir trotz der uns zur Verfügung ste-
henden Kräfte so wenig Verwirklichungen ha-
ben, liegt in uns selbst: Wir sehen im Haus
immer noch einen Wert, der hundert Jahre
unverändert bleiben soll, anstatt Siedlungen
aufzubauen, die in 25 Jahren amortisiert sind.
Die jungen Schweizer Architekten versuchen
— neben Mart Stams Entwürfen von 1924 —
den Typ des Schulhauses auszubilden.
Leicht, luftig, Südostlage. — Die Schulhaus-
bauten von Zürich (M. E. Häfeli), Lensburg
(Hans Schmidt), Baden (Werner Moser, Hans
Schmidt) sind in ihrer sauberen, unmodischen
Gestaltung Vorbilder. Die Schulbehörden, die
Auftraggeber und die vom Heimatschutz auf
verworrenste Weise aufgehetzten Bürger, ver-
hindern nach Möglichkeit jede Verwirkli-
chung. Man spürt zwar deutlich, daß die Her-
ren auf ihren selbstbewußten Postamenten zu
zweifeln beginnen, und die Brusttöne, die das
Vorgestern als das einzig Zuverlässige verkün-
deten, allmählich den Aplomb verlieren, aber
bis sie die Verwirklichung lebendiger Dinge
zulassen, dazu ist noch ein langer Schritt.
In Deutschland droht eine andere Gefahr. Man
hat sich zwar allmählich von dem Spitzenex-
pressionismus der Hoeger, Kreis, Fahrenkamp
befreit, aber bereits droht eine neue Dekora-
tionsmethode: die Amsterdamerei.
Mietshäuser in Sachsen und anderen Gegen-
den, gewisse Schulbauten in Frankfurt, weisen
bereits darauf hin. Mit Modespielereien, die
die äußeren Allüren des neuen Bauens nach-
äffen, muß heute strenger abgerechnet wer-
den wie je zuvor. — Eine Stadt wie Berlin, in
der ungeheure Kapitalien aus der Hauszins-
steuer zusammenfließen, ist nicht imstande, ein
Versuchslabor at orium zu errichten, dasden
Architekten überhaupt erst die Möglichkeit gibt,
Baustoffe, Häuser auszuprobieren, ehe sie zu
großen Siedlungen ausgeweitet werden. Ohne
Versuchsfeld herrscht ewige Stagnation.
Giedion