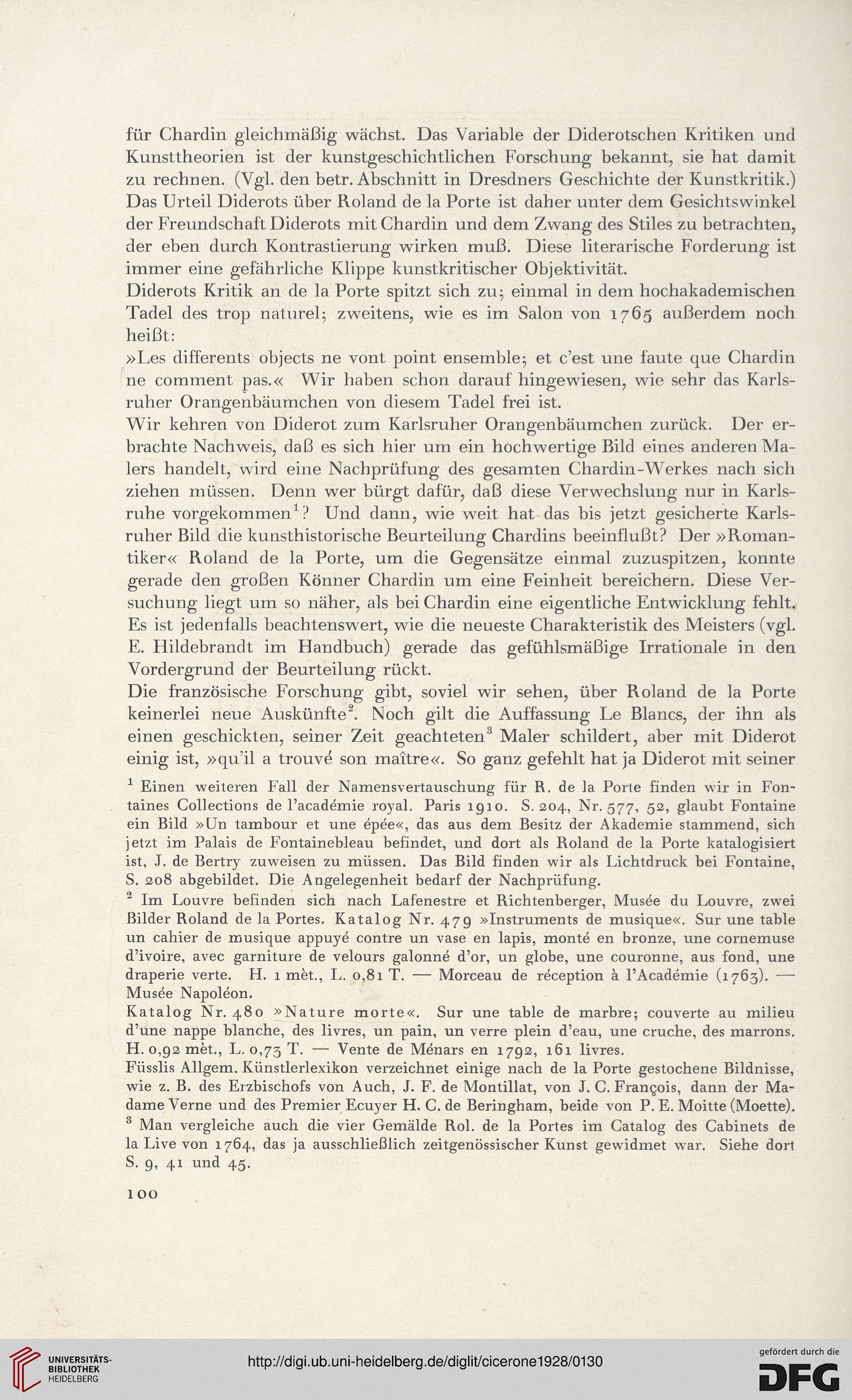für Chardin gleichmäßig wächst. Das Variable der Diderotschen Kritiken und
Kunsttheorien ist der kunstgeschichtlichen Forschung bekannt, sie hat damit
zu rechnen. (Vgl. den betr. Abschnitt in Dresdners Geschichte der Kunstkritik.)
Das Urteil Diderots über Roland de la Porte ist daher unter dem Gesichtswinkel
der Freundschaft Diderots mit Chardin und dem Zwang des Stiles zu betrachten,
der eben durch Kontrastierung wirken muß. Diese literarische Forderung ist
immer eine gefährliche Klippe kunstkritischer Objektivität.
Diderots Kritik an de la Porte spitzt sich zu; einmal in dem hochakademischen
Tadel des trop naturel; zweitens, wie es im Salon von 1765 außerdem noch
heißt:
»Les differents objects ne vont point ensemble; et c’est une faute que Chardin
ne comment pas.« Wir haben schon darauf hingewiesen, wie sehr das Karls-
ruher Orangenbäumchen von diesem Tadel frei ist.
Wir kehren von Diderot zum Karlsruher Orangenbäumchen zurück. Der er-
brachte Nachweis, daß es sich hier um ein hochwertige Bild eines anderen Ma-
lers handelt, wird eine Nachprüfung des gesamten Chardin-Werkes nach sich
ziehen müssen. Denn wer bürgt dafür, daß diese Verwechslung nur in Karls-
ruhe vorgekommen1? Und dann, wie weit hat das bis jetzt gesicherte Karls-
ruher Bild die kunsthistorische Beurteilung Chardins beeinflußt? Der »Roman-
tiker« Roland de la Porte, um die Gegensätze einmal zuzuspitzen, konnte
gerade den großen Könner Chardin um eine Feinheit bereichern. Diese Ver-
suchung liegt um so näher, als bei Chardin eine eigentliche Entwicklung fehlt.
Es ist jedenfalls beachtenswert, wie die neueste Charakteristik des Meisters (vgl.
E. Hildebrandt im Handbuch) gerade das gefühlsmäßige Irrationale in den
Vordergrund der Beurteilung rückt.
Die französische Forschung gibt, soviel wir sehen, über Roland de la Porte
keinerlei neue Auskünfte2. Noch gilt die Auffassung Le Blancs, der ihn als
einen geschickten, seiner Zeit geachteten3 Maler schildert, aber mit Diderot
einig ist, »qu’il a trouve son maitre«. So ganz gefehlt hat ja Diderot mit seiner
1 Einen weiteren Fall der Namensvertauschung für R. de la Porte finden wir in Fon-
taines Collections de l’academie royal. Paris 1910. S. 204, Nr. 577, 52, glaubt Fontaine
ein Bild »Un tambour et une epee«, das aus dem Besitz der Akademie stammend, sich
jetzt im Palais de Fontainebleau befindet, und dort als Roland de la Porte katalogisiert
ist, J. de Bertry zuweisen zu müssen. Das Bild finden wir als Lichtdruck bei Fontaine,
S. 208 abgebildet. Die Angelegenheit bedarf der Nachprüfung.
2 Im Louvre befinden sich nach Lafenestre et Richtenberger, Musee du Louvre, zwei
Bilder Roland de la Portes. Katalog Nr. 479 »Instruments de musique«. Sur une table
un cahier de musique appuye contre un vase en lapis, monte en bronze, une cornemuse
d’ivoire, avec garniture de velours galonne d’or, un globe, une couronne, aus fond, une
draperie verte. H. 1 met., L. 0,81 T. — Morceau de reception ä l’Academie (1763). —
Musee Napoleon.
Katalog Nr. 480 »Nature morte«. Sur une table de marbre; couverte au milieu
d’une nappe blanche, des livres, un pain, un verre plein d’eau, une cruche, des marrons.
H. 0,92 met., L. 0,73 T. — Vente de Menars en 1792, 161 livres.
Füsslis Allgem. Künstlerlexikon verzeichnet einige nach de la Porte gestochene Bildnisse,
wie z. B. des Erzbischofs von Auch, J. F. de Montillat, von J. C. Frangois, dann der Ma-
dame Verne und des Premier Ecuyer H. C. de Beringham, beide von P. E. Moitte (Moette).
3 Man vergleiche auch die vier Gemälde Rol. de la Portes im Catalog des Cabinets de
la Live von 1764, das ja ausschließlich zeitgenössischer Kunst gewidmet war. Siehe dort
S. g, 41 und 45.
IOO
Kunsttheorien ist der kunstgeschichtlichen Forschung bekannt, sie hat damit
zu rechnen. (Vgl. den betr. Abschnitt in Dresdners Geschichte der Kunstkritik.)
Das Urteil Diderots über Roland de la Porte ist daher unter dem Gesichtswinkel
der Freundschaft Diderots mit Chardin und dem Zwang des Stiles zu betrachten,
der eben durch Kontrastierung wirken muß. Diese literarische Forderung ist
immer eine gefährliche Klippe kunstkritischer Objektivität.
Diderots Kritik an de la Porte spitzt sich zu; einmal in dem hochakademischen
Tadel des trop naturel; zweitens, wie es im Salon von 1765 außerdem noch
heißt:
»Les differents objects ne vont point ensemble; et c’est une faute que Chardin
ne comment pas.« Wir haben schon darauf hingewiesen, wie sehr das Karls-
ruher Orangenbäumchen von diesem Tadel frei ist.
Wir kehren von Diderot zum Karlsruher Orangenbäumchen zurück. Der er-
brachte Nachweis, daß es sich hier um ein hochwertige Bild eines anderen Ma-
lers handelt, wird eine Nachprüfung des gesamten Chardin-Werkes nach sich
ziehen müssen. Denn wer bürgt dafür, daß diese Verwechslung nur in Karls-
ruhe vorgekommen1? Und dann, wie weit hat das bis jetzt gesicherte Karls-
ruher Bild die kunsthistorische Beurteilung Chardins beeinflußt? Der »Roman-
tiker« Roland de la Porte, um die Gegensätze einmal zuzuspitzen, konnte
gerade den großen Könner Chardin um eine Feinheit bereichern. Diese Ver-
suchung liegt um so näher, als bei Chardin eine eigentliche Entwicklung fehlt.
Es ist jedenfalls beachtenswert, wie die neueste Charakteristik des Meisters (vgl.
E. Hildebrandt im Handbuch) gerade das gefühlsmäßige Irrationale in den
Vordergrund der Beurteilung rückt.
Die französische Forschung gibt, soviel wir sehen, über Roland de la Porte
keinerlei neue Auskünfte2. Noch gilt die Auffassung Le Blancs, der ihn als
einen geschickten, seiner Zeit geachteten3 Maler schildert, aber mit Diderot
einig ist, »qu’il a trouve son maitre«. So ganz gefehlt hat ja Diderot mit seiner
1 Einen weiteren Fall der Namensvertauschung für R. de la Porte finden wir in Fon-
taines Collections de l’academie royal. Paris 1910. S. 204, Nr. 577, 52, glaubt Fontaine
ein Bild »Un tambour et une epee«, das aus dem Besitz der Akademie stammend, sich
jetzt im Palais de Fontainebleau befindet, und dort als Roland de la Porte katalogisiert
ist, J. de Bertry zuweisen zu müssen. Das Bild finden wir als Lichtdruck bei Fontaine,
S. 208 abgebildet. Die Angelegenheit bedarf der Nachprüfung.
2 Im Louvre befinden sich nach Lafenestre et Richtenberger, Musee du Louvre, zwei
Bilder Roland de la Portes. Katalog Nr. 479 »Instruments de musique«. Sur une table
un cahier de musique appuye contre un vase en lapis, monte en bronze, une cornemuse
d’ivoire, avec garniture de velours galonne d’or, un globe, une couronne, aus fond, une
draperie verte. H. 1 met., L. 0,81 T. — Morceau de reception ä l’Academie (1763). —
Musee Napoleon.
Katalog Nr. 480 »Nature morte«. Sur une table de marbre; couverte au milieu
d’une nappe blanche, des livres, un pain, un verre plein d’eau, une cruche, des marrons.
H. 0,92 met., L. 0,73 T. — Vente de Menars en 1792, 161 livres.
Füsslis Allgem. Künstlerlexikon verzeichnet einige nach de la Porte gestochene Bildnisse,
wie z. B. des Erzbischofs von Auch, J. F. de Montillat, von J. C. Frangois, dann der Ma-
dame Verne und des Premier Ecuyer H. C. de Beringham, beide von P. E. Moitte (Moette).
3 Man vergleiche auch die vier Gemälde Rol. de la Portes im Catalog des Cabinets de
la Live von 1764, das ja ausschließlich zeitgenössischer Kunst gewidmet war. Siehe dort
S. g, 41 und 45.
IOO