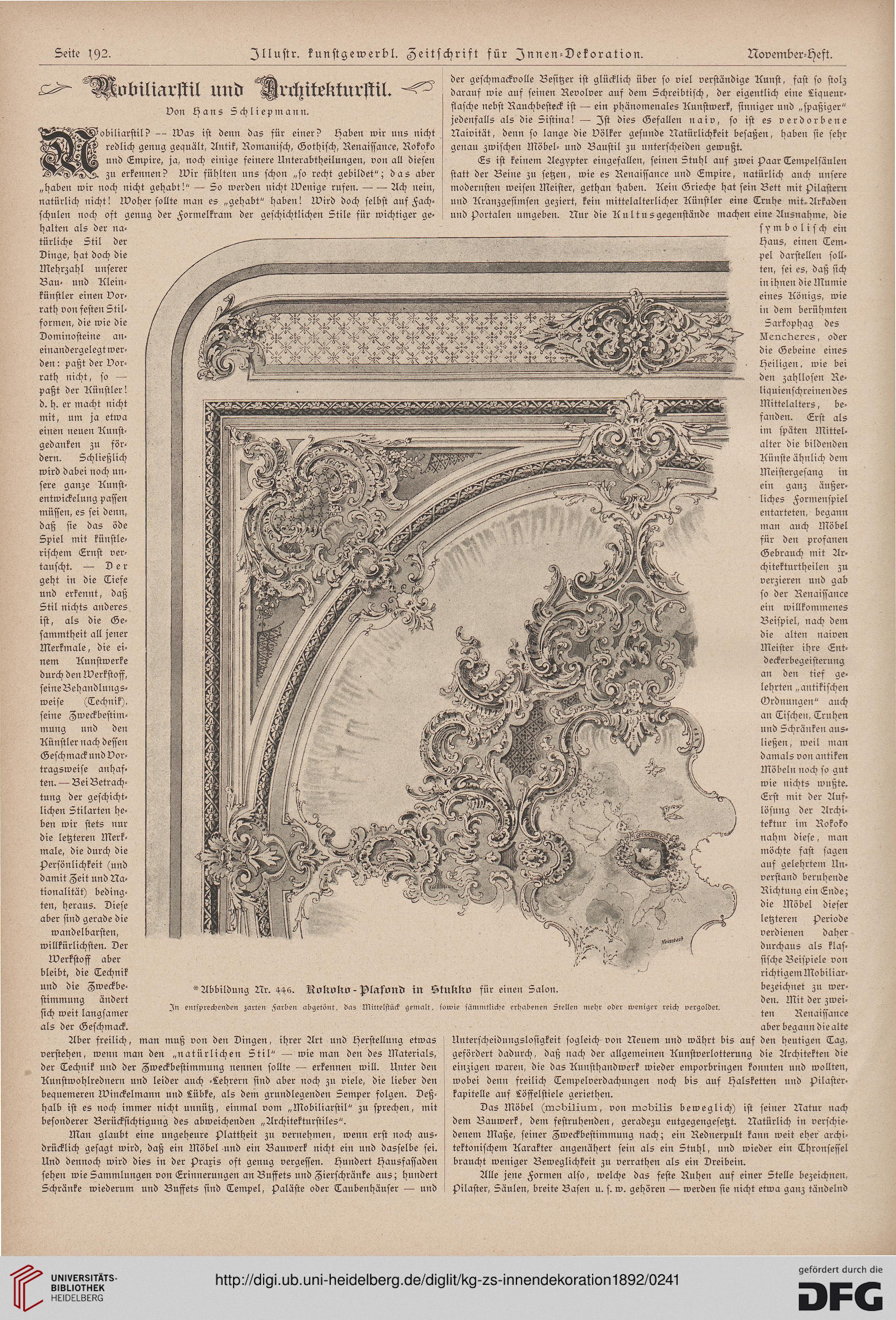Seite ^92.
Zllustr. kunstgewerbl. Zeitschrift für Znnen-Dekoration.
Novernber-Peft.
"dulnliarstil uud Mrchitekturstil.
von Hans Schliepinann.
obiliarstil? — Was ist denn das für einer? Haben wir uns nicht
redlich genug gequält, Antik, Romanisch, Gothisch, Renaissance, Rokoko
und Empire, ja, noch einige feinere Unterabtheilungen, von all dieser:
zu erkennen? Wir fühlten uns schon „so recht gebildet"; das aber
„haben wir noch nicht gehabt!" — So werden nicht Wenige rufen.-Ach nein,
natürlich nicht! Woher sollte man es „gehabt" haben! Wird doch selbst auf Fach-
schulen noch oft genug der Formelkram der geschichtlichen Stile für wichtiger ge-
halten als der na-
türliche Stil der
Dinge, hat doch die
Mehrzahl unserer
Bau- und Klern-
künstler einen Vor-
rath von festen Stil-
formen, die wie die
Dominosteine an-
einandergelegt wer-
den : paßt der Vor-
rath nicht, so —
paßt der Künstler!
d. h. er macht nicht
mit, um ja etwa
einen neuen Kunst-
gedanken zu för-
dern. Schließlich
wird dabei noch un-
sere ganze Kunst-
entwickelung passen
müssen, es sei denn,
daß sie das öde
Spiel mit künstle-
rischem Ernst ver-
tauscht. — Der
geht in die Tiefe
und erkennt, daß
Stil nichts anderes
ist, als die Ge-
sammtheit all jener
Merkmale, die ei-
nem Kunstwerke
durch den Werkstoff,
seineBehandlungs-
weise (Technik),
seine Zweckbestim-
mung und den
Künstler nach dessen
Geschmack und Vor-
tragsweise anhaf-
ten.— Bei Betrach-
tung der geschicht-
lichen Stilarten he-
ben wir stets nur
die letzteren Merk-
male, die durch die
Persönlichkeit (und
damit Zeit und Na-
tionalität) beding-
ten, heraus. Diese
aber sind gerade die
wandelbarsten,
willkürlichsten. Der
Werkstoff aber
bleibt, die Technik
und die Zweckbe-
stimmung ändert
sich weit langsamer
als der Geschmack.
Aber freilich, man muß von den Dingen, ihrer Art und Herstellung etwas
verstehen, wenn man den „natürlichen Stil" — wie man den des Materials,
der Technik und der Zweckbestimmung nennen sollte — erkennen will. Unter den
Kunstwohlrednern und leider auch -Lehrern sind aber noch zu viele, die lieber den
bequemeren winckelmann und Lübke, als dem grundlegenden Semper folgen. Deß-
halb ist es noch immer nicht unnütz, einmal vom „Mobiliarstil" zu sprechen, mit
besonderer Berücksichtigung des abweichenden „Architekturstiles".
Man glaubt eine ungeheure Plattheit zu vernehmen, wenn erst noch aus-
drücklich gesagt wird, daß ein Möbel und ein Bauwerk nicht ein und dasselbe sei.
Und dennoch wird dies in der Praxis oft genug vergessen. Hundert Hausfassaden
sehen wie Sammlungen von Erinnerungen an Buffets und Zierschränke aus; hundert
Schränke wiederum und Buffets sind Tempel, Paläste oder Taubenhäuser — und
der geschmackvolle Besitzer ist glücklich über so viel verständige Kunst, fast so stolz
darauf wie auf seinen Revolver auf dem Schreibtisch, der eigentlich eine Liqueur-
flasche nebst Rauchbesteck ist — ein phänomenales Kunstwerk, sinniger und „spaßiger"
jedenfalls als die Sistina! — Ist dies Gefallen naiv, so ist es verdorbene
Naivität, denn so lange die Völker gesunde Natürlichkeit besaßen, haben sie sehr
genau zwischen Möbel- und Baustil zu unterscheiden gewußt.
Es ist keinem Aegypter eingefallen, seinen Stuhl auf zwei Paar Temxelsäulen
statt der Beine zu setzen, wie es Renaissance und Empire, natürlich auch unsere
modernsten weisen Meister, gethan haben. Kein Grieche hat sein Bett mit Pilastern
und Kranzgesimsen geziert, kein mittelalterlicher Künstler eine Truhe mit. Arkaden
und Portalen umgeben. Nur die K u l t n s gegenstände machen eine Ausnahme, die
symbolisch ein
Haus, einen Tem-
pel darstellen soll-
ten, sei es, daß sich
in ihnen die Mumie
eines Königs, wie
in dem berühmten
Sarkophag des
Menakeres, oder
die Gebeine eines
Heiligen, wie bei
den zahllosen Re-
liquienschreinendes
Mittelalters, be-
fanden. Erst als
im späten Mittel-
alter die bildenden
Künste ähnlich dem
Meistergesang in
ein ganz äußer-
liches Forinenspiel
entarteten, begann
man auch Möbel
für den profanen
Gebrauch mit Ar-
chitekturtheilen zu
verzieren und gab
so der Renaissance
ein willkommenes
Beispiel, nach dem
die alten naiven
Meister ihre Lnt-
deckerbegeisterung
an den tief ge-
lehrten „antikischen
Vrdnungen" auch
an Tischen, Truhen
und Schränken aus-
ließen, weil man
damals von antiken
Möbeln noch so gut
wie nichts wußte.
Erst mit der Auf-
lösung der Archi-
tektur im Rokoko
nahm diese, man
möchte fast sagen
auf gelehrtem Un-
verstand beruhende
Richtung ein Ende;
die Möbel dieser
letzteren Periode
verdienen daher
durchaus als klas-
sische Beispiele von
richtigem Nobiliar-
bezeichnet zu wer-
den. Mit der zwei-
ten Renaissance
aber begann diealte
Unterscheidnngslosigkeit sogleich von Neuem und währt bis auf den heutigen Tag,
gefördert dadurch, daß nach der allgemeinen Kunstverlotterung die Architekten die
einzigen waren, die das Kunsthandwerk wieder emporbringen konnten und wollten,
wobei denn freilich Tempelverdachungen noch bis auf Halsketten und Pilaster-
kapitelle auf Löffelstiele geriethen.
Das Möbel (rnodilirrrrr, von nrodiUs beweglich) ist seiner Natur nach
dem Bauwerk, dem festruhenden, geradezu entgegengesetzt. Natürlich in verschie-
denem Maße, seiner Zweckbestimmung nach; ein Rednerpult kann weit eher archi-
tektonischem Karakter angenähert sein als ein Stuhl, und wieder ein Thronsessel
braucht weniger Beweglichkeit zu verrathen als ein Dreibein.
Alle jene Formen also, welche das feste Ruhen auf einer Stelle bezeichnen,
Pilaster, Säulen, breite Basen u. s. w. gehören — werden sie nicht etwa ganz tändelnd
* Abbildung Nr. 4,4,6. Rokoko - Plafond in Stukko für einer! Salon.
Zllustr. kunstgewerbl. Zeitschrift für Znnen-Dekoration.
Novernber-Peft.
"dulnliarstil uud Mrchitekturstil.
von Hans Schliepinann.
obiliarstil? — Was ist denn das für einer? Haben wir uns nicht
redlich genug gequält, Antik, Romanisch, Gothisch, Renaissance, Rokoko
und Empire, ja, noch einige feinere Unterabtheilungen, von all dieser:
zu erkennen? Wir fühlten uns schon „so recht gebildet"; das aber
„haben wir noch nicht gehabt!" — So werden nicht Wenige rufen.-Ach nein,
natürlich nicht! Woher sollte man es „gehabt" haben! Wird doch selbst auf Fach-
schulen noch oft genug der Formelkram der geschichtlichen Stile für wichtiger ge-
halten als der na-
türliche Stil der
Dinge, hat doch die
Mehrzahl unserer
Bau- und Klern-
künstler einen Vor-
rath von festen Stil-
formen, die wie die
Dominosteine an-
einandergelegt wer-
den : paßt der Vor-
rath nicht, so —
paßt der Künstler!
d. h. er macht nicht
mit, um ja etwa
einen neuen Kunst-
gedanken zu för-
dern. Schließlich
wird dabei noch un-
sere ganze Kunst-
entwickelung passen
müssen, es sei denn,
daß sie das öde
Spiel mit künstle-
rischem Ernst ver-
tauscht. — Der
geht in die Tiefe
und erkennt, daß
Stil nichts anderes
ist, als die Ge-
sammtheit all jener
Merkmale, die ei-
nem Kunstwerke
durch den Werkstoff,
seineBehandlungs-
weise (Technik),
seine Zweckbestim-
mung und den
Künstler nach dessen
Geschmack und Vor-
tragsweise anhaf-
ten.— Bei Betrach-
tung der geschicht-
lichen Stilarten he-
ben wir stets nur
die letzteren Merk-
male, die durch die
Persönlichkeit (und
damit Zeit und Na-
tionalität) beding-
ten, heraus. Diese
aber sind gerade die
wandelbarsten,
willkürlichsten. Der
Werkstoff aber
bleibt, die Technik
und die Zweckbe-
stimmung ändert
sich weit langsamer
als der Geschmack.
Aber freilich, man muß von den Dingen, ihrer Art und Herstellung etwas
verstehen, wenn man den „natürlichen Stil" — wie man den des Materials,
der Technik und der Zweckbestimmung nennen sollte — erkennen will. Unter den
Kunstwohlrednern und leider auch -Lehrern sind aber noch zu viele, die lieber den
bequemeren winckelmann und Lübke, als dem grundlegenden Semper folgen. Deß-
halb ist es noch immer nicht unnütz, einmal vom „Mobiliarstil" zu sprechen, mit
besonderer Berücksichtigung des abweichenden „Architekturstiles".
Man glaubt eine ungeheure Plattheit zu vernehmen, wenn erst noch aus-
drücklich gesagt wird, daß ein Möbel und ein Bauwerk nicht ein und dasselbe sei.
Und dennoch wird dies in der Praxis oft genug vergessen. Hundert Hausfassaden
sehen wie Sammlungen von Erinnerungen an Buffets und Zierschränke aus; hundert
Schränke wiederum und Buffets sind Tempel, Paläste oder Taubenhäuser — und
der geschmackvolle Besitzer ist glücklich über so viel verständige Kunst, fast so stolz
darauf wie auf seinen Revolver auf dem Schreibtisch, der eigentlich eine Liqueur-
flasche nebst Rauchbesteck ist — ein phänomenales Kunstwerk, sinniger und „spaßiger"
jedenfalls als die Sistina! — Ist dies Gefallen naiv, so ist es verdorbene
Naivität, denn so lange die Völker gesunde Natürlichkeit besaßen, haben sie sehr
genau zwischen Möbel- und Baustil zu unterscheiden gewußt.
Es ist keinem Aegypter eingefallen, seinen Stuhl auf zwei Paar Temxelsäulen
statt der Beine zu setzen, wie es Renaissance und Empire, natürlich auch unsere
modernsten weisen Meister, gethan haben. Kein Grieche hat sein Bett mit Pilastern
und Kranzgesimsen geziert, kein mittelalterlicher Künstler eine Truhe mit. Arkaden
und Portalen umgeben. Nur die K u l t n s gegenstände machen eine Ausnahme, die
symbolisch ein
Haus, einen Tem-
pel darstellen soll-
ten, sei es, daß sich
in ihnen die Mumie
eines Königs, wie
in dem berühmten
Sarkophag des
Menakeres, oder
die Gebeine eines
Heiligen, wie bei
den zahllosen Re-
liquienschreinendes
Mittelalters, be-
fanden. Erst als
im späten Mittel-
alter die bildenden
Künste ähnlich dem
Meistergesang in
ein ganz äußer-
liches Forinenspiel
entarteten, begann
man auch Möbel
für den profanen
Gebrauch mit Ar-
chitekturtheilen zu
verzieren und gab
so der Renaissance
ein willkommenes
Beispiel, nach dem
die alten naiven
Meister ihre Lnt-
deckerbegeisterung
an den tief ge-
lehrten „antikischen
Vrdnungen" auch
an Tischen, Truhen
und Schränken aus-
ließen, weil man
damals von antiken
Möbeln noch so gut
wie nichts wußte.
Erst mit der Auf-
lösung der Archi-
tektur im Rokoko
nahm diese, man
möchte fast sagen
auf gelehrtem Un-
verstand beruhende
Richtung ein Ende;
die Möbel dieser
letzteren Periode
verdienen daher
durchaus als klas-
sische Beispiele von
richtigem Nobiliar-
bezeichnet zu wer-
den. Mit der zwei-
ten Renaissance
aber begann diealte
Unterscheidnngslosigkeit sogleich von Neuem und währt bis auf den heutigen Tag,
gefördert dadurch, daß nach der allgemeinen Kunstverlotterung die Architekten die
einzigen waren, die das Kunsthandwerk wieder emporbringen konnten und wollten,
wobei denn freilich Tempelverdachungen noch bis auf Halsketten und Pilaster-
kapitelle auf Löffelstiele geriethen.
Das Möbel (rnodilirrrrr, von nrodiUs beweglich) ist seiner Natur nach
dem Bauwerk, dem festruhenden, geradezu entgegengesetzt. Natürlich in verschie-
denem Maße, seiner Zweckbestimmung nach; ein Rednerpult kann weit eher archi-
tektonischem Karakter angenähert sein als ein Stuhl, und wieder ein Thronsessel
braucht weniger Beweglichkeit zu verrathen als ein Dreibein.
Alle jene Formen also, welche das feste Ruhen auf einer Stelle bezeichnen,
Pilaster, Säulen, breite Basen u. s. w. gehören — werden sie nicht etwa ganz tändelnd
* Abbildung Nr. 4,4,6. Rokoko - Plafond in Stukko für einer! Salon.