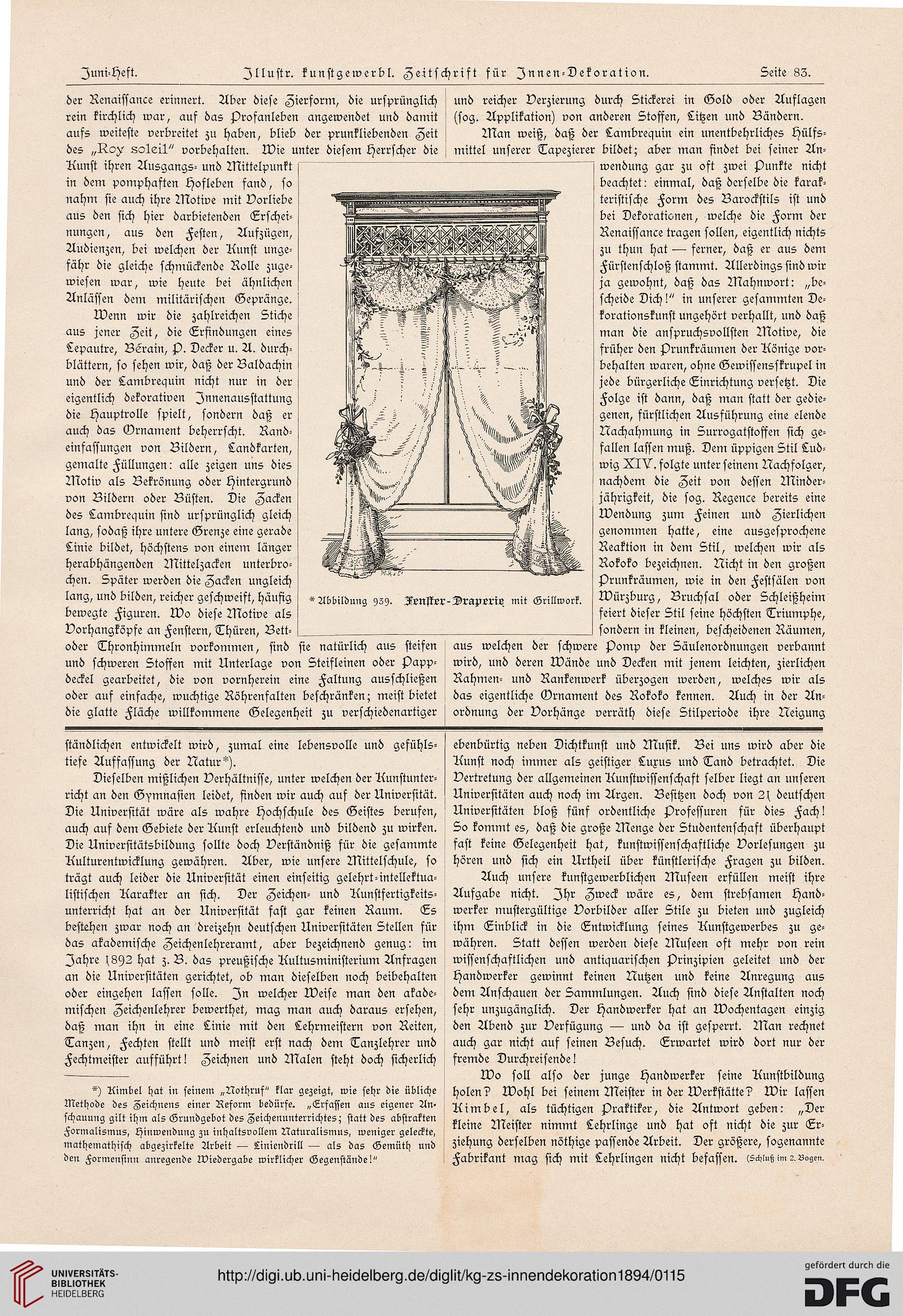Juni-Heft.
Illustr. kunstgewerbl. Zeitschrift für Innen-Dekoration.
Seite 83.
der Renaissance erinnert. Aber diese Zierform, die ursprünglich
rein kirchlich war, aus das Profanleben angewendet und damit
aufs weiteste verbreitet zu haben, blieb der prunkliebenden Zeit
des LOleil" Vorbehalten. Wie unter diesem Herrscher die
Aunst ihren Ausgangs- und Mittelpunkt
in dem pomphaften Hofleben fand, so
nahm sie auch ihre Motive mit Vorliebe
aus den sich hier darbietenden Erschei-
nungen, aus den Heften, Aufzügen,
Audienzen, bei welchen der Aunst unge-
fähr die gleiche schmückende Rolle zuge-
wiesen war, wie heute bei ähnlichen
Anlässen dem militärischen Gepränge.
Wenn wir die zahlreichen Stiche
aus jener Zeit, die Erfindungen eines
Lepautre, Berain, p. Decker u. A. durch-
blättern, so sehen wir, daß der Baldachin
und der Lambrequin nicht nur in der
eigentlich dekorativen Innenausstattung
die Hauptrolle spielt, sondern daß er
auch das Grnament beherrscht. Rand-
einfassungen von Bildern, Landkarten,
gemalte Hüllungen: alle zeigen uns dies
Motiv als Bekrönung oder Hintergrund
von Bildern oder Büsten. Die Zacken
des Lambrequin sind ursprünglich gleich
lang, sodaß ihre untere Grenze eine gerade
Linie bildet, höchstens von einem länger
herabhängendcn Mittelzacken unterbro-
chen. Später werden die Zacken ungleich
lang, und bilden, reicher geschweift, häufig
bewegte Higuren. Wo diese Motive als
Vorhangköpfe an Henstern, Thüren, Bett-
oder Thronhimmeln Vorkommen, sind sie natürlich aus steifen
und schweren Stoffen mit Unterlage von Steifleinen oder Papp-
deckel gearbeitet, die von vornherein eine Haltung ausschließen
oder auf einfache, wuchtige Röhrensalten beschränken; meist bietet
die glatte Hläche willkommene Gelegenheit zu verschiedenartiger
und reicher Verzierung durch Stickerei in Gold oder Auflagen
(sog. Applikation) von anderen Stoffen, Litzen und Bändern.
Man weiß, daß der Lambrequin ein unentbehrliches Hülfs-
mittel unserer Tapezierer bildet; aber man findet bei seiner An-
wendung gar zu oft zwei Punkte nicht
beachtet: einmal, daß derselbe die karak-
teristische Horm des Barockstils ist und
bei Dekorationen, welche die Horm der
Renaissance tragen sollen, eigentlich nichts
zu thun hat — ferner, daß er aus dem
Hürstenschloß stammt. Allerdings sind wir
ja gewohnt, daß das Mahnwort: „be-
scheide Dich!" in unserer gesummten De-
korationskunst ungehört verhallt, und daß
man die anspruchsvollsten Motive, die
früher den Prunkräumen der Aönige Vor-
behalten waren, ohne Gewissensskrupel in
jede bürgerliche Einrichtung versetzt. Die
Holge ist dann, daß man statt der gedie-
genen, fürstlichen Ausführung eine elende
Nachahmung in Surrogatstoffen sich ge-
fallen lassen muß. Dem üppigen Stil Lud-
wig XIV. folgte unter seinen: Nachfolger,
nachdem die Zeit von dessen Minder-
jährigkeit, die sog. Regence bereits eine
Wendung zum Heinen und Zierlichen
genommen hatte, eine ausgesprochene
Reaktion in dem Stil, welchen wir als
Rokoko bezeichnen. Nicht in den großen
Prunkräumen, wie in den Hestsälen von
Würzburg, Bruchsal oder Schleißheim
feiert dieser Stil seine höchsten Triumphe,
sondern in kleinen, bescheidenen Räumen,
aus welchen der schwere Pomp der Säulenordnungen verbannt
wird, und deren Wände und Decken mit jenem leichten, zierlichen
Rahmen- und Rankenwerk überzogen werden, welches wir als
das eigentliche Grnament des Rokoko kennen. Auch in der An-
ordnung der Vorhänge verräth diese Stilperiode ihre Neigung
stündlichen entwickelt wird, zumal eine lebensvolle und gefühls-
tiefe Auffassung der Natur*).
Dieselben mißlichen Verhältnisse, unter welchen der Aunstunter-
richt an den Gymnasien leidet, finden wir auch auf der Universität.
Die Universität wäre als wahre Hochschule des Geistes berufen,
auch auf dem Gebiete der Uunst erleuchtend und bildend zu wirken.
Die Universitätsbildung sollte doch Verständniß für die gesammte
Aulturentwicklung gewähren. Aber, wie unsere Mittelschule, so
trägt auch leider die Universität einen einseitig gelehrt-intellektua-
listischen Uarakter an sich. Der Zeichen- und Aunstfertigkeits-
unterricht hat an der Universität fast gar keinen Raum. Es
bestehen zwar noch an dreizehn deutschen Universitäten Stellen für
das akademische Zeichenlehreramt, aber bezeichnend genug: im
Jahre f8y2 hat z. B. das preußische Aultusministerium Anfragen
an die Universitäten gerichtet, ob man dieselben noch beibehalten
oder eingehen lassen solle. In welcher Weise man den akade-
mischen Zeichenlehrer bewerthet, mag man auch daraus ersehen,
daß man ihn in eine Linie mit den Lehrmeistern von Reiten,
Tanzen, Hechten stellt und meist erst nach dem Tanzlehrer und
Hechtmeister aufführt! Zeichnen und Malen steht doch sicherlich
*) Aimbel hat in seinem „Nothruf" klar gezeigt, wie sehr die übliche
Methode des Zeichnens einer Reform bedürfe. „Erfassen aus eigener An-
schaumig gilt ihm als Grundgebot des Zeichenunterrichtes; statt des abstrakten
Formalismus, Hinwendung zu inhaltsvollem Naturalismus, weniger geleckte,
mathemathisch abgezirkelte Arbeit — Liniendrill — als das Gemüth und
den Formensinn anregende Wiedergabe wirklicher Gegenstände!"
ebenbürtig neben Dichtkunst und Musik. Bei uns wird aber die
Aunst noch immer als geistiger Luxus und Tand betrachtet. Die
Vertretung der allgemeinen Aunstwiffenschaft selber liegt an unseren
Universitäten auch noch in: Argen. Besitzen doch von 2s deutschen
Universitäten bloß fünf ordentliche Professuren für dies Hach!
So kommt es, daß die große Menge der Studentenschaft überhaupt
fast keine Gelegenheit hat, kunstwissenschaftliche Vorlesungen zu
hören und sich ein Urtheil über künstlerische Hragen zu bilden.
Auch unsere kunstgewerblichen Museen erfüllen meist ihre
Aufgabe nicht. Ihr Zweck wäre es, dem strebsamen Hand-
werker mustergültige Vorbilder aller Stile zu bieten und zugleich
ihm Einblick in die Entwicklung seines Aunstgewerbes zu ge-
währen. Statt dessen werden diese Museen oft mehr von rein
wissenschaftlichen und antiquarischen Prinzipien geleitet und der
Handwerker gewinnt keinen Nutzen und keine Anregung aus
dem Anschauen der Sammlungen. Auch sind diese Anstalten noch
sehr unzugänglich. Der Handwerker hat an Wochentagen einzig
den Abend zur Verfügung — und da ist gesperrt. Man rechnet
auch gar nicht auf seinen Besuch. Erwartet wird dort nur der
fremde Durchreisende!
Wo soll also der junge Handwerker seine Aunstbildung
holen? Wohl bei seinem Meister in der Werkstätte? Wir lassen
Aimbel, als tüchtigen Praktiker, die Antwort geben: „Der
kleine Meister nimmt Lehrlinge und hat oft nicht die zur Er-
ziehung derselben nöthige passende Arbeit. Der größere, sogenannte
Habrikant mag sich mit Lehrlingen nicht befassen. (Schluß im 2. Bogen.
Illustr. kunstgewerbl. Zeitschrift für Innen-Dekoration.
Seite 83.
der Renaissance erinnert. Aber diese Zierform, die ursprünglich
rein kirchlich war, aus das Profanleben angewendet und damit
aufs weiteste verbreitet zu haben, blieb der prunkliebenden Zeit
des LOleil" Vorbehalten. Wie unter diesem Herrscher die
Aunst ihren Ausgangs- und Mittelpunkt
in dem pomphaften Hofleben fand, so
nahm sie auch ihre Motive mit Vorliebe
aus den sich hier darbietenden Erschei-
nungen, aus den Heften, Aufzügen,
Audienzen, bei welchen der Aunst unge-
fähr die gleiche schmückende Rolle zuge-
wiesen war, wie heute bei ähnlichen
Anlässen dem militärischen Gepränge.
Wenn wir die zahlreichen Stiche
aus jener Zeit, die Erfindungen eines
Lepautre, Berain, p. Decker u. A. durch-
blättern, so sehen wir, daß der Baldachin
und der Lambrequin nicht nur in der
eigentlich dekorativen Innenausstattung
die Hauptrolle spielt, sondern daß er
auch das Grnament beherrscht. Rand-
einfassungen von Bildern, Landkarten,
gemalte Hüllungen: alle zeigen uns dies
Motiv als Bekrönung oder Hintergrund
von Bildern oder Büsten. Die Zacken
des Lambrequin sind ursprünglich gleich
lang, sodaß ihre untere Grenze eine gerade
Linie bildet, höchstens von einem länger
herabhängendcn Mittelzacken unterbro-
chen. Später werden die Zacken ungleich
lang, und bilden, reicher geschweift, häufig
bewegte Higuren. Wo diese Motive als
Vorhangköpfe an Henstern, Thüren, Bett-
oder Thronhimmeln Vorkommen, sind sie natürlich aus steifen
und schweren Stoffen mit Unterlage von Steifleinen oder Papp-
deckel gearbeitet, die von vornherein eine Haltung ausschließen
oder auf einfache, wuchtige Röhrensalten beschränken; meist bietet
die glatte Hläche willkommene Gelegenheit zu verschiedenartiger
und reicher Verzierung durch Stickerei in Gold oder Auflagen
(sog. Applikation) von anderen Stoffen, Litzen und Bändern.
Man weiß, daß der Lambrequin ein unentbehrliches Hülfs-
mittel unserer Tapezierer bildet; aber man findet bei seiner An-
wendung gar zu oft zwei Punkte nicht
beachtet: einmal, daß derselbe die karak-
teristische Horm des Barockstils ist und
bei Dekorationen, welche die Horm der
Renaissance tragen sollen, eigentlich nichts
zu thun hat — ferner, daß er aus dem
Hürstenschloß stammt. Allerdings sind wir
ja gewohnt, daß das Mahnwort: „be-
scheide Dich!" in unserer gesummten De-
korationskunst ungehört verhallt, und daß
man die anspruchsvollsten Motive, die
früher den Prunkräumen der Aönige Vor-
behalten waren, ohne Gewissensskrupel in
jede bürgerliche Einrichtung versetzt. Die
Holge ist dann, daß man statt der gedie-
genen, fürstlichen Ausführung eine elende
Nachahmung in Surrogatstoffen sich ge-
fallen lassen muß. Dem üppigen Stil Lud-
wig XIV. folgte unter seinen: Nachfolger,
nachdem die Zeit von dessen Minder-
jährigkeit, die sog. Regence bereits eine
Wendung zum Heinen und Zierlichen
genommen hatte, eine ausgesprochene
Reaktion in dem Stil, welchen wir als
Rokoko bezeichnen. Nicht in den großen
Prunkräumen, wie in den Hestsälen von
Würzburg, Bruchsal oder Schleißheim
feiert dieser Stil seine höchsten Triumphe,
sondern in kleinen, bescheidenen Räumen,
aus welchen der schwere Pomp der Säulenordnungen verbannt
wird, und deren Wände und Decken mit jenem leichten, zierlichen
Rahmen- und Rankenwerk überzogen werden, welches wir als
das eigentliche Grnament des Rokoko kennen. Auch in der An-
ordnung der Vorhänge verräth diese Stilperiode ihre Neigung
stündlichen entwickelt wird, zumal eine lebensvolle und gefühls-
tiefe Auffassung der Natur*).
Dieselben mißlichen Verhältnisse, unter welchen der Aunstunter-
richt an den Gymnasien leidet, finden wir auch auf der Universität.
Die Universität wäre als wahre Hochschule des Geistes berufen,
auch auf dem Gebiete der Uunst erleuchtend und bildend zu wirken.
Die Universitätsbildung sollte doch Verständniß für die gesammte
Aulturentwicklung gewähren. Aber, wie unsere Mittelschule, so
trägt auch leider die Universität einen einseitig gelehrt-intellektua-
listischen Uarakter an sich. Der Zeichen- und Aunstfertigkeits-
unterricht hat an der Universität fast gar keinen Raum. Es
bestehen zwar noch an dreizehn deutschen Universitäten Stellen für
das akademische Zeichenlehreramt, aber bezeichnend genug: im
Jahre f8y2 hat z. B. das preußische Aultusministerium Anfragen
an die Universitäten gerichtet, ob man dieselben noch beibehalten
oder eingehen lassen solle. In welcher Weise man den akade-
mischen Zeichenlehrer bewerthet, mag man auch daraus ersehen,
daß man ihn in eine Linie mit den Lehrmeistern von Reiten,
Tanzen, Hechten stellt und meist erst nach dem Tanzlehrer und
Hechtmeister aufführt! Zeichnen und Malen steht doch sicherlich
*) Aimbel hat in seinem „Nothruf" klar gezeigt, wie sehr die übliche
Methode des Zeichnens einer Reform bedürfe. „Erfassen aus eigener An-
schaumig gilt ihm als Grundgebot des Zeichenunterrichtes; statt des abstrakten
Formalismus, Hinwendung zu inhaltsvollem Naturalismus, weniger geleckte,
mathemathisch abgezirkelte Arbeit — Liniendrill — als das Gemüth und
den Formensinn anregende Wiedergabe wirklicher Gegenstände!"
ebenbürtig neben Dichtkunst und Musik. Bei uns wird aber die
Aunst noch immer als geistiger Luxus und Tand betrachtet. Die
Vertretung der allgemeinen Aunstwiffenschaft selber liegt an unseren
Universitäten auch noch in: Argen. Besitzen doch von 2s deutschen
Universitäten bloß fünf ordentliche Professuren für dies Hach!
So kommt es, daß die große Menge der Studentenschaft überhaupt
fast keine Gelegenheit hat, kunstwissenschaftliche Vorlesungen zu
hören und sich ein Urtheil über künstlerische Hragen zu bilden.
Auch unsere kunstgewerblichen Museen erfüllen meist ihre
Aufgabe nicht. Ihr Zweck wäre es, dem strebsamen Hand-
werker mustergültige Vorbilder aller Stile zu bieten und zugleich
ihm Einblick in die Entwicklung seines Aunstgewerbes zu ge-
währen. Statt dessen werden diese Museen oft mehr von rein
wissenschaftlichen und antiquarischen Prinzipien geleitet und der
Handwerker gewinnt keinen Nutzen und keine Anregung aus
dem Anschauen der Sammlungen. Auch sind diese Anstalten noch
sehr unzugänglich. Der Handwerker hat an Wochentagen einzig
den Abend zur Verfügung — und da ist gesperrt. Man rechnet
auch gar nicht auf seinen Besuch. Erwartet wird dort nur der
fremde Durchreisende!
Wo soll also der junge Handwerker seine Aunstbildung
holen? Wohl bei seinem Meister in der Werkstätte? Wir lassen
Aimbel, als tüchtigen Praktiker, die Antwort geben: „Der
kleine Meister nimmt Lehrlinge und hat oft nicht die zur Er-
ziehung derselben nöthige passende Arbeit. Der größere, sogenannte
Habrikant mag sich mit Lehrlingen nicht befassen. (Schluß im 2. Bogen.