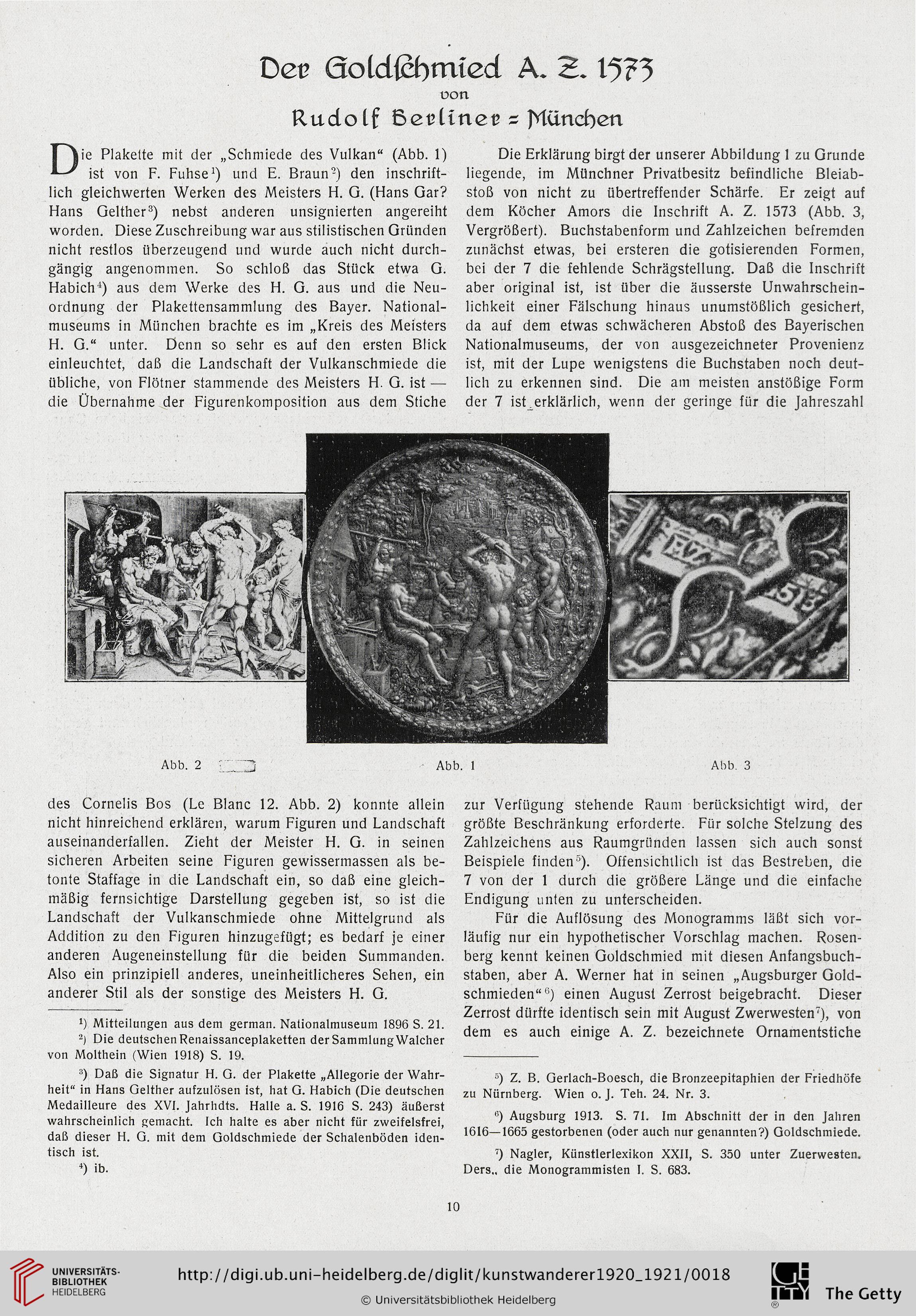Donath, Adolph [Hrsg.]
Der Kunstwanderer: Zeitschrift für alte und neue Kunst, für Kunstmarkt und Sammelwesen
— 2.1920/21
Zitieren dieser Seite
Bitte zitieren Sie diese Seite, indem Sie folgende Adresse (URL)/folgende DOI benutzen:
https://doi.org/10.11588/diglit.27814#0018
DOI Heft:
1. Septemberheft
DOI Artikel:Berliner, Rudolf: Der Goldschmied A. Z. 1573
DOI Seite / Zitierlink:https://doi.org/10.11588/diglit.27814#0018
Det? QotcHcbmted A. 2.15?3
oon
Rudolf Betdinci? c ]viünd)cn
[jie Plakette mit der „Schmiede des Vulkan“ (Abb. 1)
ist von F. Fuhse1 2 3) und E. Braun-) den inschrift-
lich gleichwerten Werken des Meisters H. G. (Hans Gar?
Hans Gelther8) nebst anderen unsignierten angereiht
worden. Diese Zuschreibung war aus stilistischen Gründen
nicht restlos überzeugend und wurde auch nicht durch-
gängig angenommen. So schloß das Stück etwa G.
Habich4) aus dem Werke des H. G. aus und die Neu-
ordnung der Plakettensammlung des Bayer. National-
museums in München brachte es im „Kreis des Meisters
H. G.“ unter. Denn so sehr es auf den ersten Blick
einleuchtct, daß die Landschaft der Vulkanschmiede die
übliche, von Flötner stammende des Meisters H. G. ist —
die Übernahme der Figurenkomposition aus dem Stiche
Die Erklärung birgt der unserer Abbildung 1 zu Grunde
liegende, im Münchner Privatbesitz befindliche Bleiab-
stoß von nicht zu übertreffender Schärfe. Er zeigt auf
dem Köcher Amors die Inschrift A. Z. 1573 (Abb. 3,
Vergrößert). Buchstabenform und Zahlzeichen befremden
zunächst etwas, bei ersteren die gotisierenden Formen,
bei der 7 die fehlende Schrägstellung. Daß die Inschrift
aber original ist, ist über die äusserste Unwahrschein-
lichkeit einer Fälschung hinaus unumstößlich gesichert,
da auf dem etwas schwächeren Abstoß des Bayerischen
Nationalmuseums, der von ausgezeichneter Provenienz
ist, mit der Lupe wenigstens die Buchstaben noch deut-
lich zu erkennen sind. Die am meisten anstößige Form
der 7 ist erklärlich, wenn der geringe für die Jahreszahl
des Cornelis Bos (Le Blanc 12. Abb. 2) konnte allein
nicht hinreichend erklären, warum Figuren und Landschaft
auseinanderfallen. Zieht der Meister H. G. in seinen
sicheren Arbeiten seine Figuren gewissermassen als be-
tonte Staffage in die Landschaft ein, so daß eine gleich-
mäßig fernsichtige Darstellung gegeben ist, so ist die
Landschaft der Vulkanschmiede ohne Mittelgrund als
Addition zu den Figuren hinzugefügt; es bedarf je einer
anderen Augeneinstellung für die beiden Summanden.
Also ein prinzipiell anderes, uneinheitlicheres Sehen, ein
anderer Stil als der sonstige des Meisters H. G.
*) Mitteilungen aus dem german. Nationalmuseum 1896 S. 21.
2) Die deutschen Renaissanceplaketten der Sammlung Walcher
von Molthein (Wien 1918) S. 19.
3) Daß die Signatur H. G. der Plakette „Allegorie der Wahr-
heit“ in Hans Gelther aufzulösen ist, hat G. Habich (Die deutschen
Medailleure des XVI. Jahrhdts. Halle a. S. 1916 S. 243) äußerst
wahrscheinlich gemacht. Ich halte es aber nicht für zweifelsfrei,
daß dieser H. G. mit dem Goldschmiede der Schalenböden iden-
tisch ist.
4) ib.
zur Verfügung stehende Raum berücksichtigt wird, der
größte Beschränkung erforderte. Für solche Stelzung des
Zahlzeichens aus Raumgründen lassen sich auch sonst
Beispiele finden5)- Offensichtlich ist das Bestreben, die
7 von der 1 durch die größere Länge und die einfache
Endigung unten zu unterscheiden.
Für die Auflösung des Monogramms läßt sich vor-
läufig nur ein hypothetischer Vorschlag machen. Rosen-
berg kennt keinen Goldschmied mit diesen Anfangsbuch-
staben, aber A. Werner hat in seinen „Augsburger Gold-
schmieden“6) einen August Zerrost beigebracht. Dieser
Zerrost dürfte identisch sein mit August Zwerwesten7), von
dem es auch einige A. Z. bezeichnete Ornamentstiche
6) Z. B. Gerlach-Boesch, die Bronzeepitaphien der Friedhöfe
zu Nürnberg. Wien o. J. Teh. 24. Nr. 3.
(i) Augsburg 1913. S. 71. Im Abschnitt der in den Jahren
1616—1665 gestorbenen (oder auch nur genannten?) Goldschmiede.
7) Nagler, Künstlerlexikon XXII, S. 350 unter Zuerwesten.
Ders., die Monogrammisten I. S. 683.
10
oon
Rudolf Betdinci? c ]viünd)cn
[jie Plakette mit der „Schmiede des Vulkan“ (Abb. 1)
ist von F. Fuhse1 2 3) und E. Braun-) den inschrift-
lich gleichwerten Werken des Meisters H. G. (Hans Gar?
Hans Gelther8) nebst anderen unsignierten angereiht
worden. Diese Zuschreibung war aus stilistischen Gründen
nicht restlos überzeugend und wurde auch nicht durch-
gängig angenommen. So schloß das Stück etwa G.
Habich4) aus dem Werke des H. G. aus und die Neu-
ordnung der Plakettensammlung des Bayer. National-
museums in München brachte es im „Kreis des Meisters
H. G.“ unter. Denn so sehr es auf den ersten Blick
einleuchtct, daß die Landschaft der Vulkanschmiede die
übliche, von Flötner stammende des Meisters H. G. ist —
die Übernahme der Figurenkomposition aus dem Stiche
Die Erklärung birgt der unserer Abbildung 1 zu Grunde
liegende, im Münchner Privatbesitz befindliche Bleiab-
stoß von nicht zu übertreffender Schärfe. Er zeigt auf
dem Köcher Amors die Inschrift A. Z. 1573 (Abb. 3,
Vergrößert). Buchstabenform und Zahlzeichen befremden
zunächst etwas, bei ersteren die gotisierenden Formen,
bei der 7 die fehlende Schrägstellung. Daß die Inschrift
aber original ist, ist über die äusserste Unwahrschein-
lichkeit einer Fälschung hinaus unumstößlich gesichert,
da auf dem etwas schwächeren Abstoß des Bayerischen
Nationalmuseums, der von ausgezeichneter Provenienz
ist, mit der Lupe wenigstens die Buchstaben noch deut-
lich zu erkennen sind. Die am meisten anstößige Form
der 7 ist erklärlich, wenn der geringe für die Jahreszahl
des Cornelis Bos (Le Blanc 12. Abb. 2) konnte allein
nicht hinreichend erklären, warum Figuren und Landschaft
auseinanderfallen. Zieht der Meister H. G. in seinen
sicheren Arbeiten seine Figuren gewissermassen als be-
tonte Staffage in die Landschaft ein, so daß eine gleich-
mäßig fernsichtige Darstellung gegeben ist, so ist die
Landschaft der Vulkanschmiede ohne Mittelgrund als
Addition zu den Figuren hinzugefügt; es bedarf je einer
anderen Augeneinstellung für die beiden Summanden.
Also ein prinzipiell anderes, uneinheitlicheres Sehen, ein
anderer Stil als der sonstige des Meisters H. G.
*) Mitteilungen aus dem german. Nationalmuseum 1896 S. 21.
2) Die deutschen Renaissanceplaketten der Sammlung Walcher
von Molthein (Wien 1918) S. 19.
3) Daß die Signatur H. G. der Plakette „Allegorie der Wahr-
heit“ in Hans Gelther aufzulösen ist, hat G. Habich (Die deutschen
Medailleure des XVI. Jahrhdts. Halle a. S. 1916 S. 243) äußerst
wahrscheinlich gemacht. Ich halte es aber nicht für zweifelsfrei,
daß dieser H. G. mit dem Goldschmiede der Schalenböden iden-
tisch ist.
4) ib.
zur Verfügung stehende Raum berücksichtigt wird, der
größte Beschränkung erforderte. Für solche Stelzung des
Zahlzeichens aus Raumgründen lassen sich auch sonst
Beispiele finden5)- Offensichtlich ist das Bestreben, die
7 von der 1 durch die größere Länge und die einfache
Endigung unten zu unterscheiden.
Für die Auflösung des Monogramms läßt sich vor-
läufig nur ein hypothetischer Vorschlag machen. Rosen-
berg kennt keinen Goldschmied mit diesen Anfangsbuch-
staben, aber A. Werner hat in seinen „Augsburger Gold-
schmieden“6) einen August Zerrost beigebracht. Dieser
Zerrost dürfte identisch sein mit August Zwerwesten7), von
dem es auch einige A. Z. bezeichnete Ornamentstiche
6) Z. B. Gerlach-Boesch, die Bronzeepitaphien der Friedhöfe
zu Nürnberg. Wien o. J. Teh. 24. Nr. 3.
(i) Augsburg 1913. S. 71. Im Abschnitt der in den Jahren
1616—1665 gestorbenen (oder auch nur genannten?) Goldschmiede.
7) Nagler, Künstlerlexikon XXII, S. 350 unter Zuerwesten.
Ders., die Monogrammisten I. S. 683.
10