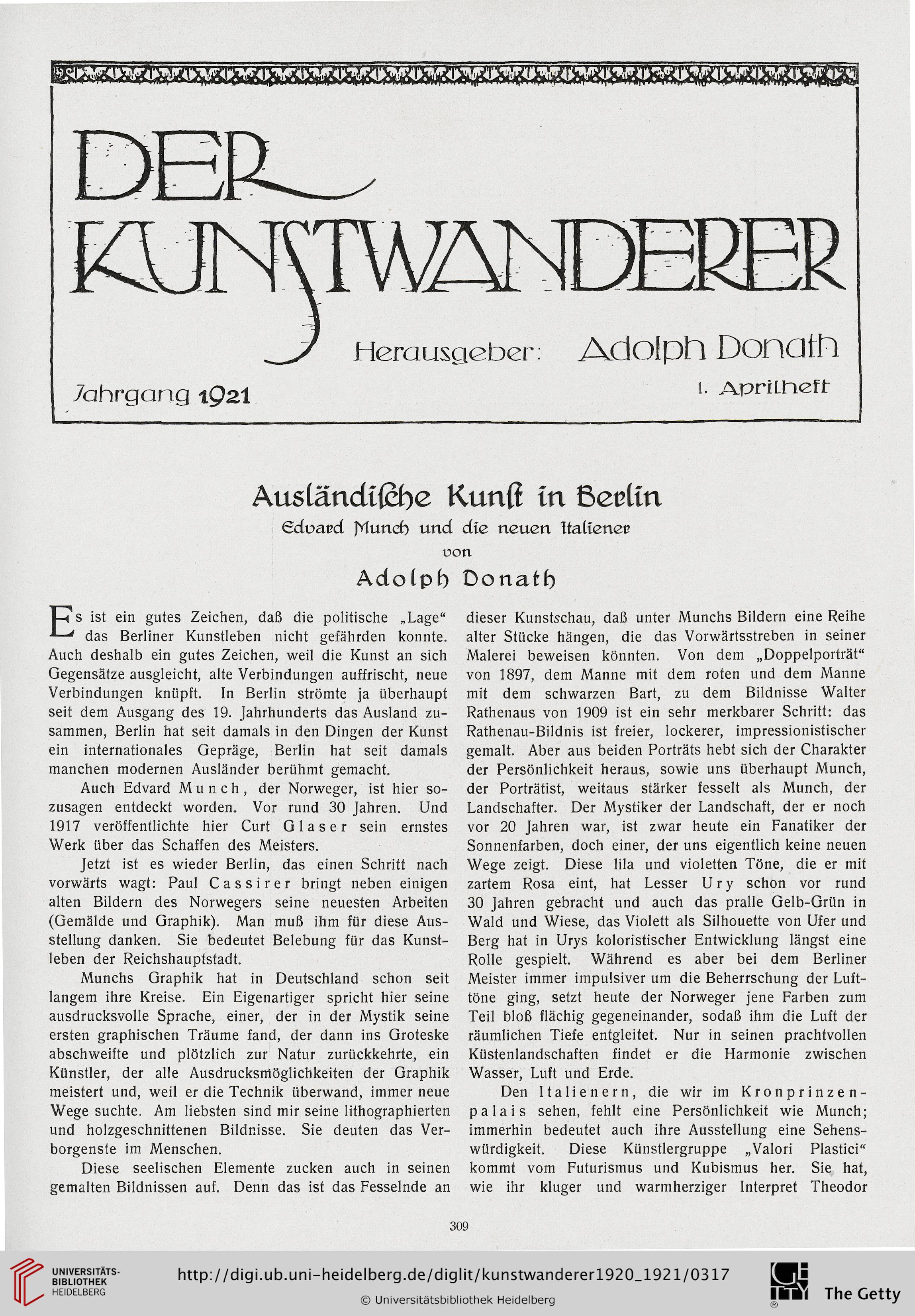Donath, Adolph [Hrsg.]
Der Kunstwanderer: Zeitschrift für alte und neue Kunst, für Kunstmarkt und Sammelwesen
— 2.1920/21
Zitieren dieser Seite
Bitte zitieren Sie diese Seite, indem Sie folgende Adresse (URL)/folgende DOI benutzen:
https://doi.org/10.11588/diglit.27814#0317
DOI Heft:
2. Märzheft
DOI Artikel:1. Aprilheft
DOI Artikel:Donath, Adolph: Ausländische Kunst in Berlin: Edvard Munch und die neuen Italiener
DOI Seite / Zitierlink:https://doi.org/10.11588/diglit.27814#0317
7ahrgang \Qz\
Herausgeber: iXdOlptl DOHOtfl
l. ApriLUeFf
Auständi(cbc Kun(t in Beetin
6dt>at?d jvtunef) und die neuen Ifatienet?
eon
Adolph Donath
tTs ist ein gutes Zeichen, daß die politische „Lage“
das Berliner Kunstleben nicht gefährden konnte.
Auch deshalb ein gutes Zeichen, weil die Kunst an sich
Gegensätze ausgleicht, alte Verbindungen auffrischt, neue
Verbindungen knüpft. In Berlin strömte ja überhaupt
seit dem Ausgang des 19. Jahrhunderts das Ausland zu-
sammen, Berlin hat seit damals in den Dingen der Kunst
ein internationales Gepräge, Berlin hat seit damals
manchen modernen Ausländer berühmt gemacht.
Auch Edvard Munch, der Norweger, ist hier so-
zusagen entdeckt worden. Vor rund 30 Jahren. Und
1917 veröffentlichte hier Curt Glaser sein ernstes
Werk über das Schaffen des Meisters.
Jetzt ist es wieder Berlin, das einen Schritt nach
vorwärts wagt: Paul Cassirer bringt neben einigen
alten Bildern des Norwegers seine neuesten Arbeiten
(Gemälde und Graphik). Man muß ihm für diese Aus-
stellung danken. Sie bedeutet Belebung für das Kunst-
leben der Reichshauptstadt.
Munchs Graphik hat in Deutschland schon seit
langem ihre Kreise. Ein Eigenartiger spricht hier seine
ausdrucksvolle Sprache, einer, der in der Mystik seine
ersten graphischen Träume fand, der dann ins Groteske
abschweifte und plötzlich zur Natur zurückkehrte, ein
Künstler, der alle Ausdrucksmöglichkeiten der Graphik
meistert und, weil er die Technik überwand, immer neue
Wege suchte. Am liebsten sind mir seine lithographierten
und holzgeschnittenen Bildnisse. Sie deuten das Ver-
borgenste im Menschen.
Diese seelischen Elemente zucken auch in seinen
gemalten Bildnissen auf. Denn das ist das Fesselnde an
dieser Kunstschau, daß unter Munchs Bildern eine Reihe
alter Stücke hängen, die das Vorwärtsstreben in seiner
Malerei beweisen könnten. Von dem „Doppelporträt“
von 1897, dem Manne mit dem roten und dem Manne
mit dem schwarzen Bart, zu dem Bildnisse Walter
Rathenaus von 1909 ist ein sehr merkbarer Schritt: das
Rathenau-Bildnis ist freier, lockerer, impressionistischer
gemalt. Aber aus beiden Porträts hebt sich der Charakter
der Persönlichkeit heraus, sowie uns überhaupt Munch,
der Porträtist, weitaus stärker fesselt als Munch, der
Landschafter. Der Mystiker der Landschaft, der er noch
vor 20 Jahren war, ist zwar heute ein Fanatiker der
Sonnenfarben, doch einer, der uns eigentlich keine neuen
Wege zeigt. Diese lila und violetten Töne, die er mit
zartem Rosa eint, hat Lesser U r y schon vor rund
30 Jahren gebracht und auch das pralle Gelb-Grün in
Wald und Wiese, das Violett als Silhouette von Ufer und
Berg hat in Urys koloristischer Entwicklung längst eine
Rolle gespielt. Während es aber bei dem Berliner
Meister immer impulsiver um die Beherrschung der Luft-
töne ging, setzt heute der Norweger jene Farben zum
Teil bloß flächig gegeneinander, sodaß ihm die Luft der
räumlichen Tiefe entgleitet. Nur in seinen prachtvollen
Küstenlandschaften findet er die Harmonie zwischen
Wasser, Luft und Erde.
Den Italienern, die wir im Kronprinzen-
palais sehen, fehlt eine Persönlichkeit wie Munch;
immerhin bedeutet auch ihre Ausstellung eine Sehens-
würdigkeit. Diese Künstlergruppe „Valori Plastici“
kommt vom Futurismus und Kubismus her. Sie hat,
wie ihr kluger und warmherziger Interpret Theodor
309
Herausgeber: iXdOlptl DOHOtfl
l. ApriLUeFf
Auständi(cbc Kun(t in Beetin
6dt>at?d jvtunef) und die neuen Ifatienet?
eon
Adolph Donath
tTs ist ein gutes Zeichen, daß die politische „Lage“
das Berliner Kunstleben nicht gefährden konnte.
Auch deshalb ein gutes Zeichen, weil die Kunst an sich
Gegensätze ausgleicht, alte Verbindungen auffrischt, neue
Verbindungen knüpft. In Berlin strömte ja überhaupt
seit dem Ausgang des 19. Jahrhunderts das Ausland zu-
sammen, Berlin hat seit damals in den Dingen der Kunst
ein internationales Gepräge, Berlin hat seit damals
manchen modernen Ausländer berühmt gemacht.
Auch Edvard Munch, der Norweger, ist hier so-
zusagen entdeckt worden. Vor rund 30 Jahren. Und
1917 veröffentlichte hier Curt Glaser sein ernstes
Werk über das Schaffen des Meisters.
Jetzt ist es wieder Berlin, das einen Schritt nach
vorwärts wagt: Paul Cassirer bringt neben einigen
alten Bildern des Norwegers seine neuesten Arbeiten
(Gemälde und Graphik). Man muß ihm für diese Aus-
stellung danken. Sie bedeutet Belebung für das Kunst-
leben der Reichshauptstadt.
Munchs Graphik hat in Deutschland schon seit
langem ihre Kreise. Ein Eigenartiger spricht hier seine
ausdrucksvolle Sprache, einer, der in der Mystik seine
ersten graphischen Träume fand, der dann ins Groteske
abschweifte und plötzlich zur Natur zurückkehrte, ein
Künstler, der alle Ausdrucksmöglichkeiten der Graphik
meistert und, weil er die Technik überwand, immer neue
Wege suchte. Am liebsten sind mir seine lithographierten
und holzgeschnittenen Bildnisse. Sie deuten das Ver-
borgenste im Menschen.
Diese seelischen Elemente zucken auch in seinen
gemalten Bildnissen auf. Denn das ist das Fesselnde an
dieser Kunstschau, daß unter Munchs Bildern eine Reihe
alter Stücke hängen, die das Vorwärtsstreben in seiner
Malerei beweisen könnten. Von dem „Doppelporträt“
von 1897, dem Manne mit dem roten und dem Manne
mit dem schwarzen Bart, zu dem Bildnisse Walter
Rathenaus von 1909 ist ein sehr merkbarer Schritt: das
Rathenau-Bildnis ist freier, lockerer, impressionistischer
gemalt. Aber aus beiden Porträts hebt sich der Charakter
der Persönlichkeit heraus, sowie uns überhaupt Munch,
der Porträtist, weitaus stärker fesselt als Munch, der
Landschafter. Der Mystiker der Landschaft, der er noch
vor 20 Jahren war, ist zwar heute ein Fanatiker der
Sonnenfarben, doch einer, der uns eigentlich keine neuen
Wege zeigt. Diese lila und violetten Töne, die er mit
zartem Rosa eint, hat Lesser U r y schon vor rund
30 Jahren gebracht und auch das pralle Gelb-Grün in
Wald und Wiese, das Violett als Silhouette von Ufer und
Berg hat in Urys koloristischer Entwicklung längst eine
Rolle gespielt. Während es aber bei dem Berliner
Meister immer impulsiver um die Beherrschung der Luft-
töne ging, setzt heute der Norweger jene Farben zum
Teil bloß flächig gegeneinander, sodaß ihm die Luft der
räumlichen Tiefe entgleitet. Nur in seinen prachtvollen
Küstenlandschaften findet er die Harmonie zwischen
Wasser, Luft und Erde.
Den Italienern, die wir im Kronprinzen-
palais sehen, fehlt eine Persönlichkeit wie Munch;
immerhin bedeutet auch ihre Ausstellung eine Sehens-
würdigkeit. Diese Künstlergruppe „Valori Plastici“
kommt vom Futurismus und Kubismus her. Sie hat,
wie ihr kluger und warmherziger Interpret Theodor
309