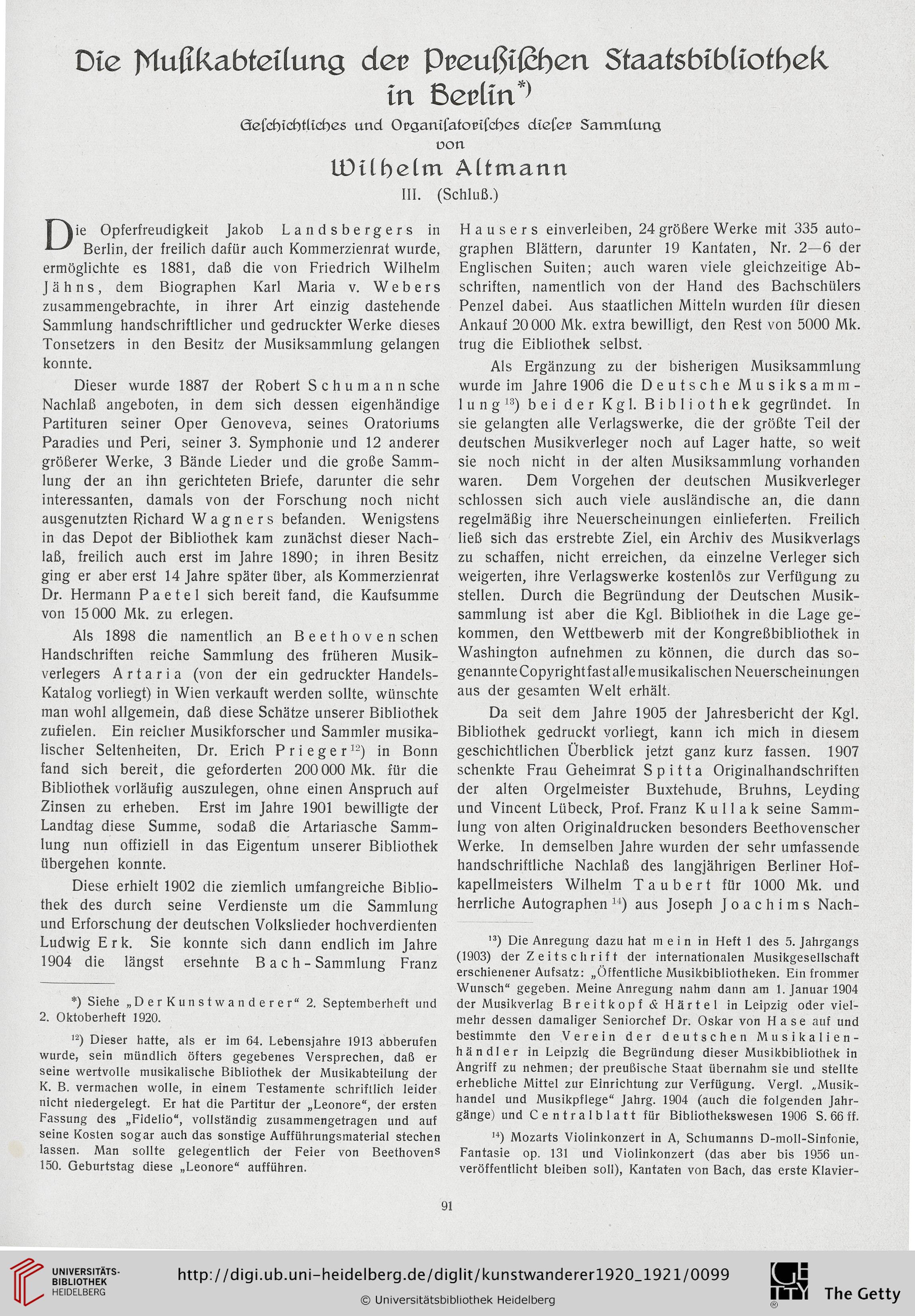Die jviußkabtetlung dev Peeußticben Staatsbibliothek
in Bet?ltn
öefcbtcbtlicbes und OEganifatotufcbes diefeu Sammlung
oon
IDÜbctm Altmann
III. (Schluß.)
Die Opferfreudigkeit Jakob Landsbergers in
Berlin, der freilich dafür auch Kommerzienrat wurde,
ermöglichte es 1881, daß die von Friedrich Wilhelm
Jäh ns, dem Biographen Karl Maria v. Webers
zusammengebrachte, in ihrer Art einzig dastehende
Sammlung handschriftlicher und gedruckter Werke dieses
Tonsetzers in den Besitz der Musiksammlung gelangen
konnte.
Dieser wurde 1887 der Robert Schumann sehe
Nachlaß angeboten, in dem sich dessen eigenhändige
Partituren seiner Oper Genoveva, seines Oratoriums
Paradies und Peri, seiner 3. Symphonie und 12 anderer
größerer Werke, 3 Bände Lieder und die große Samm-
lung der an ihn gerichteten Briefe, darunter die sehr
interessanten, damals von der Forschung noch nicht
ausgenutzten Richard Wagners befanden. Wenigstens
in das Depot der Bibliothek kam zunächst dieser Nach-
laß, freilich auch erst im Jahre 1890; in ihren Besitz
ging er aber erst 14 Jahre später über, als Kommerzienrat
Dr. Hermann P a e t e 1 sich bereit fand, die Kaufsumme
von 15 000 Mk. zu erlegen.
Als 1898 die namentlich an Beethoven sehen
Handschriften reiche Sammlung des früheren Musik-
verlegers A r t a r i a (von der ein gedruckter Handels-
Katalog vorliegt) in Wien verkauft werden sollte, wünschte
man wohl allgemein, daß diese Schätze unserer Bibliothek
zufielen. Ein reicher Musikforscher und Sammler musika-
lischer Seltenheiten, Dr. Erich Prieger12) in Bonn
fand sich bereit, die geforderten 200 000 Mk. für die
Bibliothek vorläufig auszulegen, ohne einen Anspruch auf
Zinsen zu erheben. Erst im Jahre 1901 bewilligte der
Landtag diese Summe, sodaß die Artariasche Samm-
lung nun offiziell in das Eigentum unserer Bibliothek
übergehen konnte.
Diese erhielt 1902 die ziemlich umfangreiche Biblio-
thek des durch seine Verdienste um die Sammlung
und Erforschung der deutschen Volkslieder hochverdienten
Ludwig Erk. Sie konnte sich dann endlich im Jahre
1904 die längst ersehnte B a c h - Sammlung Franz
*) Siehe „DerKunstwanderer“ 2. Septemberheft und
2. Oktoberheft 1920.
12) Dieser hatte, als er im 64. Lebensjahre 1913 abberufen
wurde, sein mündlich öfters gegebenes Versprechen, daß er
seine wertvolle musikalische Bibliothek der Musikabteilung der
K. B. vermachen wolle, in einem Testamente schriftlich leider
nicht niedergelegt. Er hat die Partitur der „Leonore“, der ersten
Fassung des „Fldelio“, vollständig zusammengetragen und auf
seine Kosten sogar auch das sonstige Aufführungsmaterial stechen
lassen. Man sollte gelegentlich der Feier von Beethovens
150. Geburtstag diese „Leonore“ aufführen.
Hausers einverleiben, 24 größere Werke mit 335 auto-
graphen Blättern, darunter 19 Kantaten, Nr. 2—6 der
Englischen Suiten; auch waren viele gleichzeitige Ab-
schriften, namentlich von der Hand des Bachschülers
Penzel dabei. Aus staatlichen Mitteln wurden für diesen
Ankauf 20000 Mk. extra bewilligt, den Rest von 5000 Mk.
trug die Eibliothek selbst.
Als Ergänzung zu der bisherigen Musiksammlung
wurde im Jahre 1906 die Deutsche Musiksamm-
lung13) bei der Kgl. Bibliothek gegründet. In
sie gelangten alle Verlagswerke, die der größte Teil der
deutschen Musikverleger noch auf Lager hatte, so weit
sie noch nicht in der alten Musiksammlung vorhanden
waren. Dem Vorgehen der deutschen Musikverleger
schlossen sich auch viele ausländische an, die dann
regelmäßig ihre Neuerscheinungen einlieferten. Freilich
ließ sich das erstrebte Ziel, ein Archiv des Musikverlags
zu schaffen, nicht erreichen, da einzelne Verleger sich
weigerten, ihre Verlagswerke kostenlös zur Verfügung zu
stellen. Durch die Begründung der Deutschen Musik-
sammlung ist aber die Kgl. Bibliothek in die Lage ge-
kommen, den Wettbewerb mit der Kongreßbibliothek in
Washington aufnehmen zu können, die durch das so-
genannte Copyright fast alle musikalischen Neuerscheinungen
aus der gesamten Welt erhält.
Da seit dem Jahre 1905 der Jahresbericht der Kgl.
Bibliothek gedruckt yorliegt, kann ich mich in diesem
geschichtlichen Überblick jetzt ganz kurz fassen. 1907
schenkte Frau Geheimrat S p i 11 a Originalhandschriften
der alten Orgelmeister Buxtehude, Bruhns, Leyding
und Vincent Lübeck, Prof. Franz K u 11 a k seine Samm-
lung von alten Originaldrucken besonders Beethovenscher
Werke. In demselben Jahre wurden der sehr umfassende
handschriftliche Nachlaß des langjährigen Berliner Hof-
kapellmeisters Wilhelm Taubert für 1000 Mk. und
herrliche Autographen u) aus Joseph Joachims Nach-
13) Die Anregung dazu hat mein in Heft 1 des 5. Jahrgangs
(1903) der Z e i t s c h r i f t der internationalen Musikgesellschaft
erschienener Aufsatz: „Öffentliche Musikbibliotheken. Ein frommer
Wunsch“ gegeben. Meine Anregung nahm dann am 1. Januar 1904
der Musikverlag Breitkopf & Härtel in Leipzig oder viel-
mehr dessen damaliger Seniorchef Dr. Oskar von Hase auf und
bestimmte den Verein der deutschen Musikalien-
händler in Leipzig die Begründung dieser Musikbibliothek in
Angriff zu nehmen; der preußische Staat übernahm sie und stellte
erhebliche Mittel zur Einrichtung zur Verfügung. Vergl. „Musik-
handel und Musikpflege“ Jahrg. 1904 (auch die folgenden Jahr-
gänge) und Centralblatt für Bibliothekswesen 1906 S. 66 ff.
14) Mozarts Violinkonzert in A, Schumanns D-moll-Sinfonie,
Fantasie op. 131 und Violinkonzert (das aber bis 1956 un-
veröffentlicht bleiben soll), Kantaten von Bach, das erste Klavier-
91
in Bet?ltn
öefcbtcbtlicbes und OEganifatotufcbes diefeu Sammlung
oon
IDÜbctm Altmann
III. (Schluß.)
Die Opferfreudigkeit Jakob Landsbergers in
Berlin, der freilich dafür auch Kommerzienrat wurde,
ermöglichte es 1881, daß die von Friedrich Wilhelm
Jäh ns, dem Biographen Karl Maria v. Webers
zusammengebrachte, in ihrer Art einzig dastehende
Sammlung handschriftlicher und gedruckter Werke dieses
Tonsetzers in den Besitz der Musiksammlung gelangen
konnte.
Dieser wurde 1887 der Robert Schumann sehe
Nachlaß angeboten, in dem sich dessen eigenhändige
Partituren seiner Oper Genoveva, seines Oratoriums
Paradies und Peri, seiner 3. Symphonie und 12 anderer
größerer Werke, 3 Bände Lieder und die große Samm-
lung der an ihn gerichteten Briefe, darunter die sehr
interessanten, damals von der Forschung noch nicht
ausgenutzten Richard Wagners befanden. Wenigstens
in das Depot der Bibliothek kam zunächst dieser Nach-
laß, freilich auch erst im Jahre 1890; in ihren Besitz
ging er aber erst 14 Jahre später über, als Kommerzienrat
Dr. Hermann P a e t e 1 sich bereit fand, die Kaufsumme
von 15 000 Mk. zu erlegen.
Als 1898 die namentlich an Beethoven sehen
Handschriften reiche Sammlung des früheren Musik-
verlegers A r t a r i a (von der ein gedruckter Handels-
Katalog vorliegt) in Wien verkauft werden sollte, wünschte
man wohl allgemein, daß diese Schätze unserer Bibliothek
zufielen. Ein reicher Musikforscher und Sammler musika-
lischer Seltenheiten, Dr. Erich Prieger12) in Bonn
fand sich bereit, die geforderten 200 000 Mk. für die
Bibliothek vorläufig auszulegen, ohne einen Anspruch auf
Zinsen zu erheben. Erst im Jahre 1901 bewilligte der
Landtag diese Summe, sodaß die Artariasche Samm-
lung nun offiziell in das Eigentum unserer Bibliothek
übergehen konnte.
Diese erhielt 1902 die ziemlich umfangreiche Biblio-
thek des durch seine Verdienste um die Sammlung
und Erforschung der deutschen Volkslieder hochverdienten
Ludwig Erk. Sie konnte sich dann endlich im Jahre
1904 die längst ersehnte B a c h - Sammlung Franz
*) Siehe „DerKunstwanderer“ 2. Septemberheft und
2. Oktoberheft 1920.
12) Dieser hatte, als er im 64. Lebensjahre 1913 abberufen
wurde, sein mündlich öfters gegebenes Versprechen, daß er
seine wertvolle musikalische Bibliothek der Musikabteilung der
K. B. vermachen wolle, in einem Testamente schriftlich leider
nicht niedergelegt. Er hat die Partitur der „Leonore“, der ersten
Fassung des „Fldelio“, vollständig zusammengetragen und auf
seine Kosten sogar auch das sonstige Aufführungsmaterial stechen
lassen. Man sollte gelegentlich der Feier von Beethovens
150. Geburtstag diese „Leonore“ aufführen.
Hausers einverleiben, 24 größere Werke mit 335 auto-
graphen Blättern, darunter 19 Kantaten, Nr. 2—6 der
Englischen Suiten; auch waren viele gleichzeitige Ab-
schriften, namentlich von der Hand des Bachschülers
Penzel dabei. Aus staatlichen Mitteln wurden für diesen
Ankauf 20000 Mk. extra bewilligt, den Rest von 5000 Mk.
trug die Eibliothek selbst.
Als Ergänzung zu der bisherigen Musiksammlung
wurde im Jahre 1906 die Deutsche Musiksamm-
lung13) bei der Kgl. Bibliothek gegründet. In
sie gelangten alle Verlagswerke, die der größte Teil der
deutschen Musikverleger noch auf Lager hatte, so weit
sie noch nicht in der alten Musiksammlung vorhanden
waren. Dem Vorgehen der deutschen Musikverleger
schlossen sich auch viele ausländische an, die dann
regelmäßig ihre Neuerscheinungen einlieferten. Freilich
ließ sich das erstrebte Ziel, ein Archiv des Musikverlags
zu schaffen, nicht erreichen, da einzelne Verleger sich
weigerten, ihre Verlagswerke kostenlös zur Verfügung zu
stellen. Durch die Begründung der Deutschen Musik-
sammlung ist aber die Kgl. Bibliothek in die Lage ge-
kommen, den Wettbewerb mit der Kongreßbibliothek in
Washington aufnehmen zu können, die durch das so-
genannte Copyright fast alle musikalischen Neuerscheinungen
aus der gesamten Welt erhält.
Da seit dem Jahre 1905 der Jahresbericht der Kgl.
Bibliothek gedruckt yorliegt, kann ich mich in diesem
geschichtlichen Überblick jetzt ganz kurz fassen. 1907
schenkte Frau Geheimrat S p i 11 a Originalhandschriften
der alten Orgelmeister Buxtehude, Bruhns, Leyding
und Vincent Lübeck, Prof. Franz K u 11 a k seine Samm-
lung von alten Originaldrucken besonders Beethovenscher
Werke. In demselben Jahre wurden der sehr umfassende
handschriftliche Nachlaß des langjährigen Berliner Hof-
kapellmeisters Wilhelm Taubert für 1000 Mk. und
herrliche Autographen u) aus Joseph Joachims Nach-
13) Die Anregung dazu hat mein in Heft 1 des 5. Jahrgangs
(1903) der Z e i t s c h r i f t der internationalen Musikgesellschaft
erschienener Aufsatz: „Öffentliche Musikbibliotheken. Ein frommer
Wunsch“ gegeben. Meine Anregung nahm dann am 1. Januar 1904
der Musikverlag Breitkopf & Härtel in Leipzig oder viel-
mehr dessen damaliger Seniorchef Dr. Oskar von Hase auf und
bestimmte den Verein der deutschen Musikalien-
händler in Leipzig die Begründung dieser Musikbibliothek in
Angriff zu nehmen; der preußische Staat übernahm sie und stellte
erhebliche Mittel zur Einrichtung zur Verfügung. Vergl. „Musik-
handel und Musikpflege“ Jahrg. 1904 (auch die folgenden Jahr-
gänge) und Centralblatt für Bibliothekswesen 1906 S. 66 ff.
14) Mozarts Violinkonzert in A, Schumanns D-moll-Sinfonie,
Fantasie op. 131 und Violinkonzert (das aber bis 1956 un-
veröffentlicht bleiben soll), Kantaten von Bach, das erste Klavier-
91