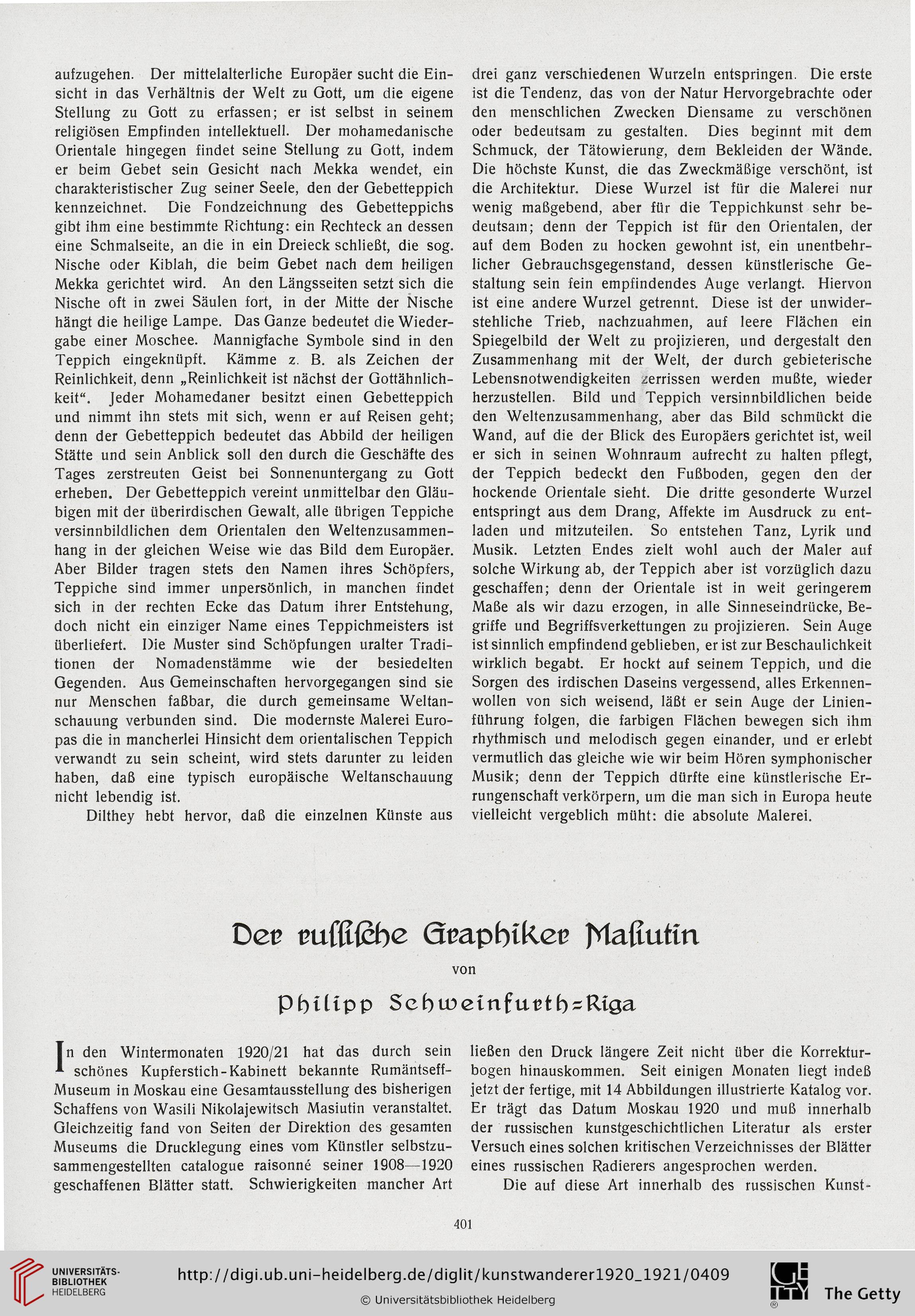aufzugehen. Der mittelalterliche Europäer sucht die Ein-
sicht in das Verhältnis der Welt zu Gott, um die eigene
Stellung zu Gott zu erfassen; er ist selbst in seinem
religiösen Empfinden intellektuell. Der mohamedanische
Orientale hingegen findet seine Stellung zu Gott, indem
er beim Gebet sein Gesicht nach Mekka wendet, ein
charakteristischer Zug seiner Seele, den der Gebetteppich
kennzeichnet. Die Fondzeichnung des Gebetteppichs
gibt ihm eine bestimmte Richtung: ein Rechteck an dessen
eine Schmalseite, an die in ein Dreieck schließt, die sog.
Nische oder Kiblah, die beim Gebet nach dem heiligen
Mekka gerichtet wird. An den Längsseiten setzt sich die
Nische oft in zwei Säulen fort, in der Mitte der Nische
hängt die heilige Lampe. Das Ganze bedeutet die Wieder-
gabe einer Moschee. Mannigfache Symbole sind in den
Teppich eingeknüpft. Kämme z. B. als Zeichen der
Reinlichkeit, denn „Reinlichkeit ist nächst der Gottähnlich-
keit“. Jeder Mohamedaner besitzt einen Gebetteppich
und nimmt ihn stets mit sich, wenn er auf Reisen geht;
denn der Gebetteppich bedeutet das Abbild der heiligen
Stätte und sein Anblick soll den durch die Geschäfte des
Tages zerstreuten Geist bei Sonnenuntergang zu Gott
erheben. Der Gebetteppich vereint unmittelbar den Gläu-
bigen mit der überirdischen Gewalt, alle übrigen Teppiche
versinnbildlichen dem Orientalen den Weltenzusammen-
hang in der gleichen Weise wie das Bild dem Europäer.
Aber Bilder tragen stets den Namen ihres Schöpfers,
Teppiche sind immer unpersönlich, in manchen findet
sich in der rechten Ecke das Datum ihrer Entstehung,
doch nicht ein einziger Name eines Teppichmeisters ist
überliefert. Die Muster sind Schöpfungen uralter Tradi-
tionen der Nomadenstämme wie der besiedelten
Gegenden. Aus Gemeinschaften hervorgegangen sind sie
nur Menschen faßbar, die durch gemeinsame Weltan-
schauung verbunden sind. Die modernste Malerei Euro-
pas die in mancherlei Hinsicht dem orientalischen Teppich
verwandt zu sein scheint, wird stets darunter zu leiden
haben, daß eine typisch europäische Weltanschauung
nicht lebendig ist.
Dilthey hebt hervor, daß die einzelnen Künste aus
drei ganz verschiedenen Wurzeln entspringen. Die erste
ist die Tendenz, das von der Natur Hervorgebrachte oder
den menschlichen Zwecken Diensame zu verschönen
oder bedeutsam zu gestalten. Dies beginnt mit dem
Schmuck, der Tätowierung, dem Bekleiden der Wände.
Die höchste Kunst, die das Zweckmäßige verschönt, ist
die Architektur. Diese Wurzel ist für die Malerei nur
wenig maßgebend, aber für die Teppichkunst sehr be-
deutsam; denn der Teppich ist für den Orientalen, der
auf dem Boden zu hocken gewohnt ist, ein unentbehr-
licher Gebrauchsgegenstand, dessen künstlerische Ge-
staltung sein fein empfindendes Auge verlangt. Hiervon
ist eine andere Wurzel getrennt. Diese ist der unwider-
stehliche Trieb, nachzuahmen, auf leere Flächen ein
Spiegelbild der Welt zu projizieren, und dergestalt den
Zusammenhang mit der Welt, der durch gebieterische
Lebensnotwendigkeiten zerrissen werden mußte, wieder
herzustellen. Bild und Teppich versinnbildlichen beide
den Weltenzusammenhang, aber das Bild schmückt die
Wand, auf die der Blick des Europäers gerichtet ist, weil
er sich in seinen Wohnraum aufrecht zu halten pflegt,
der Teppich bedeckt den Fußboden, gegen den der
hockende Orientale sieht. Die dritte gesonderte Wurzel
entspringt aus dem Drang, Affekte im Ausdruck zu ent-
laden und mitzuteilen. So entstehen Tanz, Lyrik und
Musik. Letzten Endes zielt wohl auch der Maler auf
solche Wirkung ab, der Teppich aber ist vorzüglich dazu
geschaffen; denn der Orientale ist in weit geringerem
Maße als wir dazu erzogen, in alle Sinneseindrücke, Be-
griffe und Begriffsverkettungen zu projizieren. Sein Auge
ist sinnlich empfindend geblieben, er ist zur Beschaulichkeit
wirklich begabt. Er hockt auf seinem Teppich, und die
Sorgen des irdischen Daseins vergessend, alles Erkennen-
wollen von sich weisend, läßt er sein Auge der Linien-
führung folgen, die farbigen Flächen bewegen sich ihm
rhythmisch und melodisch gegen einander, und er erlebt
vermutlich das gleiche wie wir beim Hören symphonischer
Musik; denn der Teppich dürfte eine künstlerische Er-
rungenschaftverkörpern, um die man sich in Europa heute
vielleicht vergeblich müht: die absolute Malerei.
Det? vuttx&oe Qüapbikcü )vta{tutm
von
Pbittpp Scbu)etnfuütb-Rtga
In den Wintermonaten 1920/21 hat das durch sein
schönes Kupferstich-Kabinett bekannte Rumäntseff-
Museum in Moskau eine Gesamtausstellung des bisherigen
Schaffens von Wasili Nikolajewitsch Masiutin veranstaltet.
Gleichzeitig fand von Seiten der Direktion des gesamten
Museums die Drucklegung eines vom Künstler selbstzu-
sammengestellten catalogue raisonne seiner 1908—1920
geschaffenen Blätter statt. Schwierigkeiten mancher Art
ließen den Druck längere Zeit nicht über die Korrektur-
bogen hinauskommen. Seit einigen Monaten liegt indeß
jetzt der fertige, mit 14 Abbildungen illustrierte Katalog vor.
Er trägt das Datum Moskau 1920 und muß innerhalb
der russischen kunstgeschichtlichen Literatur als erster
Versuch eines solchen kritischen Verzeichnisses der Blätter
eines russischen Radierers angesprochen werden.
Die auf diese Art innerhalb des russischen Kunst-
401
sicht in das Verhältnis der Welt zu Gott, um die eigene
Stellung zu Gott zu erfassen; er ist selbst in seinem
religiösen Empfinden intellektuell. Der mohamedanische
Orientale hingegen findet seine Stellung zu Gott, indem
er beim Gebet sein Gesicht nach Mekka wendet, ein
charakteristischer Zug seiner Seele, den der Gebetteppich
kennzeichnet. Die Fondzeichnung des Gebetteppichs
gibt ihm eine bestimmte Richtung: ein Rechteck an dessen
eine Schmalseite, an die in ein Dreieck schließt, die sog.
Nische oder Kiblah, die beim Gebet nach dem heiligen
Mekka gerichtet wird. An den Längsseiten setzt sich die
Nische oft in zwei Säulen fort, in der Mitte der Nische
hängt die heilige Lampe. Das Ganze bedeutet die Wieder-
gabe einer Moschee. Mannigfache Symbole sind in den
Teppich eingeknüpft. Kämme z. B. als Zeichen der
Reinlichkeit, denn „Reinlichkeit ist nächst der Gottähnlich-
keit“. Jeder Mohamedaner besitzt einen Gebetteppich
und nimmt ihn stets mit sich, wenn er auf Reisen geht;
denn der Gebetteppich bedeutet das Abbild der heiligen
Stätte und sein Anblick soll den durch die Geschäfte des
Tages zerstreuten Geist bei Sonnenuntergang zu Gott
erheben. Der Gebetteppich vereint unmittelbar den Gläu-
bigen mit der überirdischen Gewalt, alle übrigen Teppiche
versinnbildlichen dem Orientalen den Weltenzusammen-
hang in der gleichen Weise wie das Bild dem Europäer.
Aber Bilder tragen stets den Namen ihres Schöpfers,
Teppiche sind immer unpersönlich, in manchen findet
sich in der rechten Ecke das Datum ihrer Entstehung,
doch nicht ein einziger Name eines Teppichmeisters ist
überliefert. Die Muster sind Schöpfungen uralter Tradi-
tionen der Nomadenstämme wie der besiedelten
Gegenden. Aus Gemeinschaften hervorgegangen sind sie
nur Menschen faßbar, die durch gemeinsame Weltan-
schauung verbunden sind. Die modernste Malerei Euro-
pas die in mancherlei Hinsicht dem orientalischen Teppich
verwandt zu sein scheint, wird stets darunter zu leiden
haben, daß eine typisch europäische Weltanschauung
nicht lebendig ist.
Dilthey hebt hervor, daß die einzelnen Künste aus
drei ganz verschiedenen Wurzeln entspringen. Die erste
ist die Tendenz, das von der Natur Hervorgebrachte oder
den menschlichen Zwecken Diensame zu verschönen
oder bedeutsam zu gestalten. Dies beginnt mit dem
Schmuck, der Tätowierung, dem Bekleiden der Wände.
Die höchste Kunst, die das Zweckmäßige verschönt, ist
die Architektur. Diese Wurzel ist für die Malerei nur
wenig maßgebend, aber für die Teppichkunst sehr be-
deutsam; denn der Teppich ist für den Orientalen, der
auf dem Boden zu hocken gewohnt ist, ein unentbehr-
licher Gebrauchsgegenstand, dessen künstlerische Ge-
staltung sein fein empfindendes Auge verlangt. Hiervon
ist eine andere Wurzel getrennt. Diese ist der unwider-
stehliche Trieb, nachzuahmen, auf leere Flächen ein
Spiegelbild der Welt zu projizieren, und dergestalt den
Zusammenhang mit der Welt, der durch gebieterische
Lebensnotwendigkeiten zerrissen werden mußte, wieder
herzustellen. Bild und Teppich versinnbildlichen beide
den Weltenzusammenhang, aber das Bild schmückt die
Wand, auf die der Blick des Europäers gerichtet ist, weil
er sich in seinen Wohnraum aufrecht zu halten pflegt,
der Teppich bedeckt den Fußboden, gegen den der
hockende Orientale sieht. Die dritte gesonderte Wurzel
entspringt aus dem Drang, Affekte im Ausdruck zu ent-
laden und mitzuteilen. So entstehen Tanz, Lyrik und
Musik. Letzten Endes zielt wohl auch der Maler auf
solche Wirkung ab, der Teppich aber ist vorzüglich dazu
geschaffen; denn der Orientale ist in weit geringerem
Maße als wir dazu erzogen, in alle Sinneseindrücke, Be-
griffe und Begriffsverkettungen zu projizieren. Sein Auge
ist sinnlich empfindend geblieben, er ist zur Beschaulichkeit
wirklich begabt. Er hockt auf seinem Teppich, und die
Sorgen des irdischen Daseins vergessend, alles Erkennen-
wollen von sich weisend, läßt er sein Auge der Linien-
führung folgen, die farbigen Flächen bewegen sich ihm
rhythmisch und melodisch gegen einander, und er erlebt
vermutlich das gleiche wie wir beim Hören symphonischer
Musik; denn der Teppich dürfte eine künstlerische Er-
rungenschaftverkörpern, um die man sich in Europa heute
vielleicht vergeblich müht: die absolute Malerei.
Det? vuttx&oe Qüapbikcü )vta{tutm
von
Pbittpp Scbu)etnfuütb-Rtga
In den Wintermonaten 1920/21 hat das durch sein
schönes Kupferstich-Kabinett bekannte Rumäntseff-
Museum in Moskau eine Gesamtausstellung des bisherigen
Schaffens von Wasili Nikolajewitsch Masiutin veranstaltet.
Gleichzeitig fand von Seiten der Direktion des gesamten
Museums die Drucklegung eines vom Künstler selbstzu-
sammengestellten catalogue raisonne seiner 1908—1920
geschaffenen Blätter statt. Schwierigkeiten mancher Art
ließen den Druck längere Zeit nicht über die Korrektur-
bogen hinauskommen. Seit einigen Monaten liegt indeß
jetzt der fertige, mit 14 Abbildungen illustrierte Katalog vor.
Er trägt das Datum Moskau 1920 und muß innerhalb
der russischen kunstgeschichtlichen Literatur als erster
Versuch eines solchen kritischen Verzeichnisses der Blätter
eines russischen Radierers angesprochen werden.
Die auf diese Art innerhalb des russischen Kunst-
401