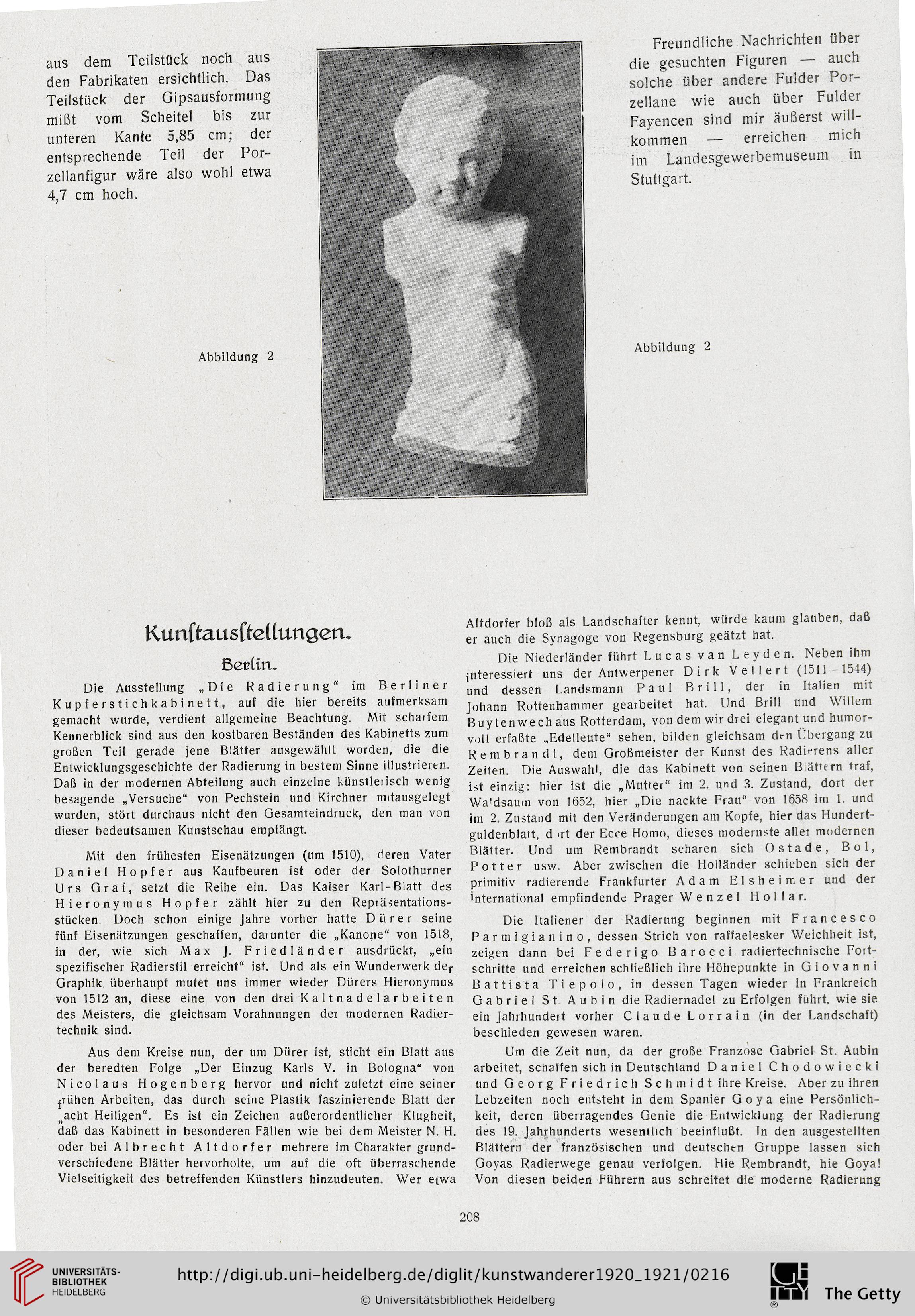Donath, Adolph [Editor]
Der Kunstwanderer: Zeitschrift für alte und neue Kunst, für Kunstmarkt und Sammelwesen
— 2.1920/21
Cite this page
Please cite this page by using the following URL/DOI:
https://doi.org/10.11588/diglit.27814#0216
DOI issue:
2. Januarheft
DOI article:Josten, Hanns Heinz: Unauffindbare Fulder Porzellanfiguren
DOI article:Kunstausstellungen / Aus der Museen- und Sammlerwelt / Kunstauktionen / Die Sammlung Alphonse Kann in Paris / Vom holländischen Kunstmarkt / Ein falscher Whistler? / Londoner Kunstschau / Schweizerische Kusntchronik / Kunstvermächtnis Vanderbilts / Die tschechische Malergruppe "Die Unenwegten" / Genossenschaftsgallerie in Dresden / Hildebrand und - Rodin / Bibliographische und bibliophile Notizen / Neue Kunstbücher
DOI Page / Citation link:https://doi.org/10.11588/diglit.27814#0216
aus dem Teilstück noch aus
den Fabrikaten ersichtlich. Das
Teilstück der Gipsausformung
mißt vom Scheitel bis zur
unteren Kante 5,85 cm; der
entsprechende Teil der Por-
zellanfigur wäre also wohl etwa
4,7 cm hoch.
Abbildung 2
Freundliche Nachrichten über
die gesuchten Figuren — auch
solche über andere Fulder Por-
zellane wie auch über Fulder
Fayencen sind mir äußerst will-
kommen — erreichen mich
im Landesgewerbemuseum in
Stuttgart.
Abbildung 2
Kunftausftellungen.
Bettltn.
Die Ausstellung „Die Radierung“ im Berliner
Kupferstichkabinett, auf die hier bereits aufmerksam
gemacht wurde, verdient allgemeine Beachtung. Mit scharfem
Kennerblick sind aus den kostbaren Beständen des Kabinetts zum
großen Teil gerade jene Blätter ausgewählt worden, die die
Entwicklungsgeschichte der Radierung in bestem Sinne illustrieren.
Daß in der modernen Abteilung auch einzelne künstlerisch wenig
besagende „Versuche“ von Pechstein und Kirchner mitausgelegt
wurden, stört durchaus nicht den Gesamteindruck, den man von
dieser bedeutsamen Kunstschau empfängt.
Mit den frühesten Eisenätzungen (um 1510), deren Vater
Daniel Hopfer aus Kaufbeuren ist oder der Solothurner
Urs Graf, setzt die Reihe ein. Das Kaiser Karl-Blatt des
Hieronymus Hopfer zählt hier zu den Repräsentations-
stücken Doch schon einige Jahre vorher hatte Dürer seine
fünf Eisenätzungen geschaffen, darunter die „Kanone“ von 1518,
in der, wie sich Max J. Friedländer ausdrückt, „ein
spezifischer Radierstil erreicht“ ist. Und als ein Wunderwerk der
Graphik überhaupt mutet uns immer wieder Dürers Hieronymus
von 1512 an, diese eine von den drei Kaltnadelarbeiten
des Meisters, die gleichsam Vorahnungen der modernen Radier-
technik sind.
Aus dem Kreise nun, der um Dürer ist, sticht ein Blatt aus
der beredten Folge „Der Einzug Karls V. in Bologna“ von
Nico laus Hogenberg hervor und nicht zuletzt eine seiner
frühen Arbeiten, das durch seine Plastik faszinierende Blatt der
„acht Heiligen“. Es ist ein Zeichen außerordentlicher Klugheit,
daß das Kabinett in besonderen Fällen wie bei dem Meister N. H.
oder beiAlbrecht Altdorfer mehrere im Charakter grund-
verschiedene Blätter hervorholte, um auf die oft überraschende
Vielseitigkeit des betreffenden Künstlers hinzudeuten. Wer etwa
Altdorfer bloß als Landschafter kennt, würde kaum glauben, daß
er auch die Synagoge von Regensburg geätzt hat.
Die Niederländer führt Lucas van Leyden. Neben ihm
interessiert uns der Antwerpener Dirk Vellert (1511 — 1544)
und dessen Landsmann Paul Brill, der in Italien mit
Johann Rottenhammer gearbeitet hat. Und Brill und Willem
Buytenwech aus Rotterdam, vondemwirdrei elegant und humor-
voll erfaßte „Edelleute“ sehen, bilden gleichsam den Übergang zu
Rembrandt, dem Großmeister der Kunst des Radierens aller
Zeiten. Die Auswahl, die das Kabinett von seinen Blättern traf,
ist einzig: hier ist die „Mutter“ im 2. und 3. Zustand, dort der
Wa'dsaum von 1652, hier „Die nackte Frau“ von 1658 im 1. und
im 2. Zustand mit den Veränderungen am Kopfe, hier das Hundert-
guldenblatt, d >rt der Ecce Homo, dieses modernste aller modernen
Blätter. Und um Rembrandt scharen sich Ostade, Bol,
Potter usw. Aber zwischen die Holländer schieben sich der
primitiv radierende Frankfurter Adam Elsheimer und der
international empfindende Prager Wenzel Hollar.
Die Italiener der Radierung beginnen mit Francesco
Parmigianino, dessen Strich von raffaelesker Weichheit ist,
zeigen dann bei Federigo Barocci radiertechnische Fort-
schritte und erreichen schließlich ihre Höhepunkte in Giovanni
Battista Tiepolo, in dessen Tagen wieder in Frankreich
Gabriel St Aubin die Radiernadel zu Erfolgen führt, wie sie
ein Jahrhundert vorher Claude Lorrain (in der Landschaft)
beschieden gewesen waren.
Um die Zeit nun, da der große Franzose Gabriel St. Aubin
arbeitet, schaffen sich in Deutschland Daniel Chodowiecki
und Georg Friedrich Schmidt ihre Kreise. Aber zu ihren
Lebzeiten noch entsteht in dem Spanier Goya eine Persönlich-
keit, deren überragendes Genie die Entwicklung der Radierung
des 19. Jahrhunderts wesentlich beeinflußt. In den ausgestellten
Blättern der französischen und deutschen Gruppe lassen sich
Goyas Radierwege genau verfolgen. Hie Rembrandt, hie Goya!
Von diesen beiden Führern aus schreitet die moderne Radierung
208
den Fabrikaten ersichtlich. Das
Teilstück der Gipsausformung
mißt vom Scheitel bis zur
unteren Kante 5,85 cm; der
entsprechende Teil der Por-
zellanfigur wäre also wohl etwa
4,7 cm hoch.
Abbildung 2
Freundliche Nachrichten über
die gesuchten Figuren — auch
solche über andere Fulder Por-
zellane wie auch über Fulder
Fayencen sind mir äußerst will-
kommen — erreichen mich
im Landesgewerbemuseum in
Stuttgart.
Abbildung 2
Kunftausftellungen.
Bettltn.
Die Ausstellung „Die Radierung“ im Berliner
Kupferstichkabinett, auf die hier bereits aufmerksam
gemacht wurde, verdient allgemeine Beachtung. Mit scharfem
Kennerblick sind aus den kostbaren Beständen des Kabinetts zum
großen Teil gerade jene Blätter ausgewählt worden, die die
Entwicklungsgeschichte der Radierung in bestem Sinne illustrieren.
Daß in der modernen Abteilung auch einzelne künstlerisch wenig
besagende „Versuche“ von Pechstein und Kirchner mitausgelegt
wurden, stört durchaus nicht den Gesamteindruck, den man von
dieser bedeutsamen Kunstschau empfängt.
Mit den frühesten Eisenätzungen (um 1510), deren Vater
Daniel Hopfer aus Kaufbeuren ist oder der Solothurner
Urs Graf, setzt die Reihe ein. Das Kaiser Karl-Blatt des
Hieronymus Hopfer zählt hier zu den Repräsentations-
stücken Doch schon einige Jahre vorher hatte Dürer seine
fünf Eisenätzungen geschaffen, darunter die „Kanone“ von 1518,
in der, wie sich Max J. Friedländer ausdrückt, „ein
spezifischer Radierstil erreicht“ ist. Und als ein Wunderwerk der
Graphik überhaupt mutet uns immer wieder Dürers Hieronymus
von 1512 an, diese eine von den drei Kaltnadelarbeiten
des Meisters, die gleichsam Vorahnungen der modernen Radier-
technik sind.
Aus dem Kreise nun, der um Dürer ist, sticht ein Blatt aus
der beredten Folge „Der Einzug Karls V. in Bologna“ von
Nico laus Hogenberg hervor und nicht zuletzt eine seiner
frühen Arbeiten, das durch seine Plastik faszinierende Blatt der
„acht Heiligen“. Es ist ein Zeichen außerordentlicher Klugheit,
daß das Kabinett in besonderen Fällen wie bei dem Meister N. H.
oder beiAlbrecht Altdorfer mehrere im Charakter grund-
verschiedene Blätter hervorholte, um auf die oft überraschende
Vielseitigkeit des betreffenden Künstlers hinzudeuten. Wer etwa
Altdorfer bloß als Landschafter kennt, würde kaum glauben, daß
er auch die Synagoge von Regensburg geätzt hat.
Die Niederländer führt Lucas van Leyden. Neben ihm
interessiert uns der Antwerpener Dirk Vellert (1511 — 1544)
und dessen Landsmann Paul Brill, der in Italien mit
Johann Rottenhammer gearbeitet hat. Und Brill und Willem
Buytenwech aus Rotterdam, vondemwirdrei elegant und humor-
voll erfaßte „Edelleute“ sehen, bilden gleichsam den Übergang zu
Rembrandt, dem Großmeister der Kunst des Radierens aller
Zeiten. Die Auswahl, die das Kabinett von seinen Blättern traf,
ist einzig: hier ist die „Mutter“ im 2. und 3. Zustand, dort der
Wa'dsaum von 1652, hier „Die nackte Frau“ von 1658 im 1. und
im 2. Zustand mit den Veränderungen am Kopfe, hier das Hundert-
guldenblatt, d >rt der Ecce Homo, dieses modernste aller modernen
Blätter. Und um Rembrandt scharen sich Ostade, Bol,
Potter usw. Aber zwischen die Holländer schieben sich der
primitiv radierende Frankfurter Adam Elsheimer und der
international empfindende Prager Wenzel Hollar.
Die Italiener der Radierung beginnen mit Francesco
Parmigianino, dessen Strich von raffaelesker Weichheit ist,
zeigen dann bei Federigo Barocci radiertechnische Fort-
schritte und erreichen schließlich ihre Höhepunkte in Giovanni
Battista Tiepolo, in dessen Tagen wieder in Frankreich
Gabriel St Aubin die Radiernadel zu Erfolgen führt, wie sie
ein Jahrhundert vorher Claude Lorrain (in der Landschaft)
beschieden gewesen waren.
Um die Zeit nun, da der große Franzose Gabriel St. Aubin
arbeitet, schaffen sich in Deutschland Daniel Chodowiecki
und Georg Friedrich Schmidt ihre Kreise. Aber zu ihren
Lebzeiten noch entsteht in dem Spanier Goya eine Persönlich-
keit, deren überragendes Genie die Entwicklung der Radierung
des 19. Jahrhunderts wesentlich beeinflußt. In den ausgestellten
Blättern der französischen und deutschen Gruppe lassen sich
Goyas Radierwege genau verfolgen. Hie Rembrandt, hie Goya!
Von diesen beiden Führern aus schreitet die moderne Radierung
208