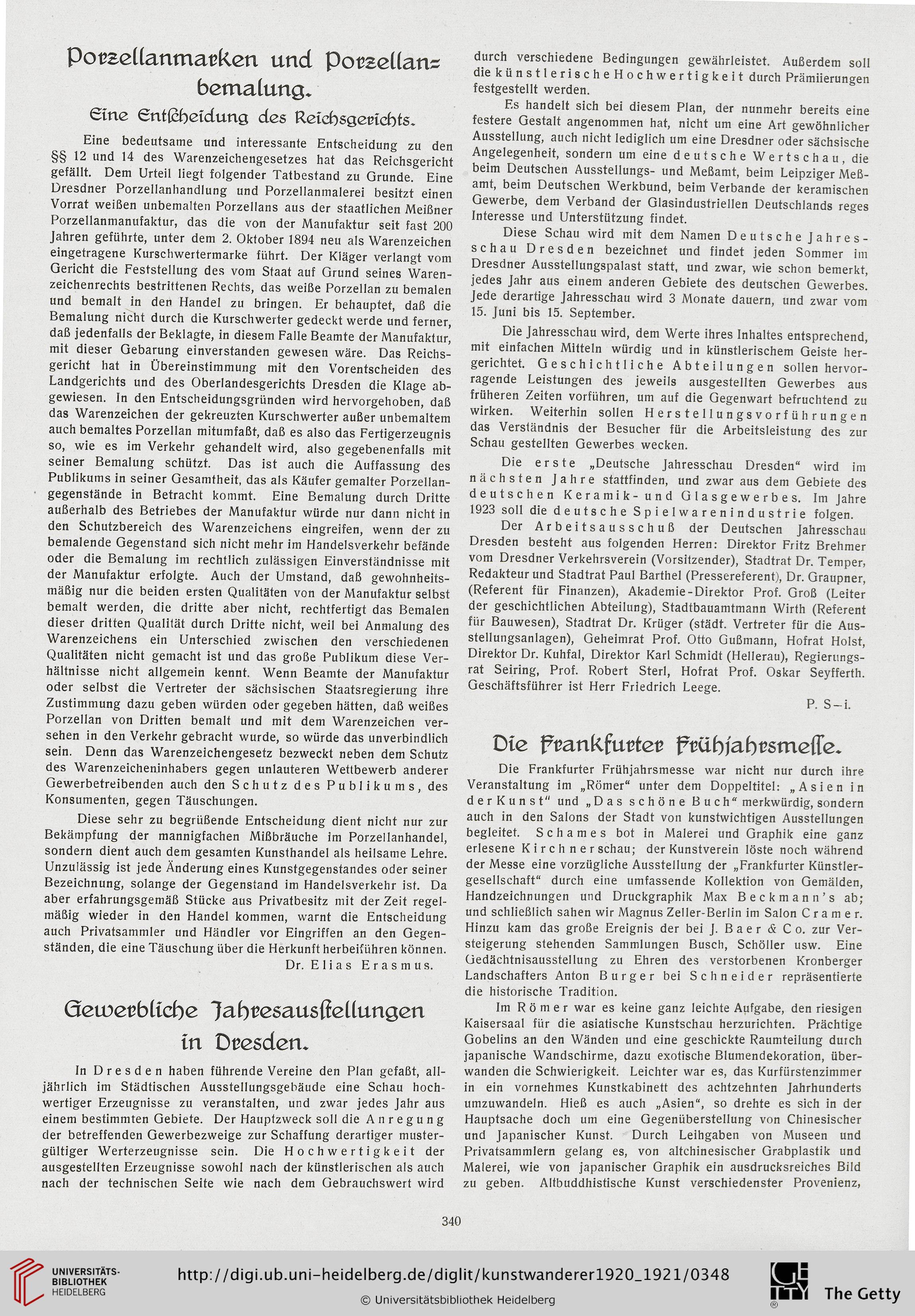Povzellanmavken und Pot^eüans
bemalung.
Sine Sntlcbeidung des Reiebsgetncbts.
Eine bedeutsame und interessante Entscheidung zu den
§§ 12 und 14 des Warenzeichengesetzes hat das Reichsgericht
gefällt. Dem Urteil liegt folgender Tatbestand zu Grunde. Eine
Dresdner Porzellanhandlung und Porzellanmalerei besitzt einen
Vorrat weißen unbemalten Porzellans aus der staatlichen Meißner
Porzellanmanufaktur, das die von der Manufaktur seit fast 200
Jahren geführte, unter dem 2. Oktober 1894 neu als Warenzeichen
eingetragene Kurschwertermarke führt. Der Kläger verlangt vom
Gericht die Feststellung des vom Staat auf Grund seines Waren-
zeichenrechts bestrittenen Rechts, das weiße Porzellan zu bemalen
und bemalt in den Handel zu bringen. Er behauptet, daß die
Bemalung nicht durch die Kurschwerter gedeckt werde und ferner,
daß jedenfalls der Beklagte, in diesem Falle Beamte der Manufaktur,
mit dieser Gebarung einverstanden gewesen wäre. Das Reichs-
gericht hat in Übereinstimmung mit den Vorentscheiden des
Landgerichts und des Oberlandesgerichts Dresden die Klage ab-
gewiesen. In den Entscheidungsgründen wird hervorgehoben, daß
das Warenzeichen der gekreuzten Kurschwerter außer unbemaltem
auch bemaltes Porzellan mitumfaßt, daß es also das Fertigerzeugnis
so, wie es im Verkehr gehandelt wird, also gegebenenfalls mit
seiner Bemalung schützt. Das ist auch die Auffassung des
Publikums in seiner Gesamtheit, das als Käufer gemalter Porzellan-
gegenstände in Betracht kommt. Eine Bemalung durch Dritte
außerhalb des Betriebes der Manufaktur würde nur dann nicht in
den Schutzbereich des Warenzeichens eingreifen, wenn der zu
bemalende Gegenstand sich nicht mehr im Handelsverkehr befände
oder die Bemalung im rechtlich zulässigen Einverständnisse mit
der Manufaktur erfolgte. Auch der Umstand, daß gewohnheits-
mäßig nur die beiden ersten Qualitäten von der Manufaktur selbst
bemalt werden, die dritte aber nicht, rechtfertigt das Bemalen
dieser dritten Qualität durch Dritte nicht, weil bei Anmalung des
Warenzeichens ein Unterschied zwischen den verschiedenen
Qualitäten nicht gemacht ist und das große Publikum diese Ver-
hältnisse nicht allgemein kennt. Wenn Beamte der Manufaktur
oder selbst die Vertreter der sächsischen Staatsregierung ihre
Zustimmung dazu geben würden oder gegeben hätten, daß weißes
Porzellan von Dritten bemalt und mit dem Warenzeichen ver-
sehen in den Verkehr gebracht wurde, so würde das unverbindlich
sein. Denn das Warenzeichengesetz bezweckt neben dem Schutz
des Warenzeicheninhabers gegen unlauteren Wettbewerb anderer
Gewerbetreibenden auch den Schutz des Publikums, des
Konsumenten, gegen Täuschungen.
Diese sehr zu begrüßende Entscheidung dient nicht nur zur
Bekämpfung der mannigfachen Mißbräuche im Porzellanhandel,
sondern dient auch dem gesamten Kunsthandel als heilsame Lehre.
Unzulässig ist jede Änderung eines Kunstgegenstandes oder seiner
Bezeichnung, solange der Gegenstand im Handelsverkehr ist. Da
aber erfahrungsgemäß Stücke aus Privatbesitz mit der Zeit regel-
mäßig wieder in den Handel kommen, warnt die Entscheidung
auch Privatsammler und Händler vor Eingriffen an den Gegen-
ständen, die eine Täuschung über die Herkunft herbeiführen können.
Dr. Elias Erasmus.
6eiüet?blicbe labt?esaus{fellungen
in Düesderu
ln Dresden haben führende Vereine den Plan gefaßt, all-
jährlich im Städtischen Ausstellungsgebäude eine Schau hoch-
wertiger Erzeugnisse zu veranstalten, und zwar jedes Jahr aus
einem bestimmten Gebiete. Der Hauptzweck soll die Anregung
der betreffenden Gewerbezweige zur Schaffung derartiger muster-
gültiger Werterzeugnisse sein. Die Hochwertigkeit der
ausgestellten Erzeugnisse sowohl nach der künstlerischen als auch
nach der technischen Seite wie nach dem Gebrauchswert wird
durch verschiedene Bedingungen gewährleistet. Außerdem soll
die künstlerischeHochwertigkeit durch Prämiierungen
festgestellt werden.
Es handelt sich bei diesem Plan, der nunmehr bereits eine
festere Gestalt angenommen hat, nicht um eine Art gewöhnlicher
Ausstellung, auch nicht lediglich um eine Dresdner oder sächsische
Angelegenheit, sondern um eine deutsche Wertschau, die
beim Deutschen Ausstellungs- und Meßamt, beim Leipziger Meß-
amt, beim Deutschen Werkbund, beim Verbände der keramischen
Gewerbe, dem Verband der Glasindustriellen Deutschlands reges
Interesse und Unterstützung findet.
Diese Schau wird mit dem Namen Deutsche Jahres-
schau Dresden bezeichnet und findet jeden Sommer im
Dresdner Ausstellungspalast statt, und zwar, wie schon bemerkt,
jedes Jahr aus einem anderen Gebiete des deutschen Gewerbes.
Jede derartige Jahresschau wird 3 Monate dauern, und zwar vom
15. Juni bis 15. September.
Die Jahresschau wird, dem Werte ihres Inhaltes entsprechend,
mit einfachen Mitteln würdig und in künstlerischem Geiste her-
gerichtet. Geschichtliche Abteilungen sollen hervor-
ragende Leistungen des jeweils ausgestellten Gewerbes aus
früheren Zeiten vorführen, um auf die Gegenwart befruchtend zu
wirken. Weiterhin sollen Herstellungsvorführungen
das Verständnis der Besucher für die Arbeitsleistung des zur
Schau gestellten Gewerbes wecken.
Die erste „Deutsche Jahresschau Dresden“ wird im
nächsten Jahre stattfinden, und zwar aus dem Gebiete des
deutschen Keramik - und Glasgewerbes. Im Jahre
1923 soll die deutsche Spielwarenindustrie folgen.
Der Arbeitsausschuß der Deutschen Jahresschau
Dresden besteht aus folgenden Herren: Direktor Fritz Brehmer
vom Dresdner Verkehrsverein (Vorsitzender), Stadtrat Dr. Temper,
Redakteur und Stadtrat Paul Barthel (Pressereferent), Dr. Graupner,
(Referent für Finanzen), Akademie-Direktor Prof. Groß (Leiter
der geschichtlichen Abteilung), Stadtbauamtmann Wirth (Referent
für Bauwesen), Stadtrat Dr. Krüger (städt. Vertreter für die Aus-
stellungsanlagen), Geheimrat Prof. Otto Gußmann, Hofrat Holst,
Direktor Dr. Kuhfal, Direktor Karl Schmidt (Hellerau), Regierungs-
rat Seiring, Prof. Robert Sterl, Hofrat Prof. Oskar Seyfferth.
Geschäftsführer ist Herr Friedrich Leege.
P. S-i.
Die ft’ankfut’tet’ fmbjabtfsmeffe.
Die Frankfurter Frühjahrsmesse war nicht nur durch ihre
Veranstaltung im „Römer“ unter dem Doppeltitel: „Asien in
der Kunst" und „Das schöne B u c h“ merkwürdig, sondern
auch in den Salons der Stadt von kunstwichtigen Ausstellungen
begleitet. S c h a m e s bot in Malerei und Graphik eine ganz
erlesene K i r c h n e r schau; der Kunstverein löste noch während
der Messe eine vorzügliche Ausstellung der „Frankfurter Künstler-
gesellschaft“ durch eine umfassende Kollektion von Gemälden,
Handzeichnungen und Druckgraphik Max Beckmann’s ab;
und schließlich sahen wir Magnus Zeller-Berlin im Salon C r a m e r.
Hinzu kam das große Ereignis der bei J. B a e r & C o. zur Ver-
steigerung stehenden Sammlungen Busch, Schöller usw. Eine
Gedächtnisausstellung zu Ehren des verstorbenen Kronberger
Landschafters Anton Burger bei Schneider repräsentierte
die historische Tradition.
Im Römer war es keine ganz leichte Aufgabe, den riesigen
Kaisersaal für die asiatische Kunstschau herzurichten. Prächtige
Gobelins an den Wänden und eine geschickte Raumteilung durch
japanische Wandschirme, dazu exotische Blumendekoration, über-
wanden die Schwierigkeit. Leichter war es, das Kurfürstenzimmer
in ein vornehmes Kunstkabinett des achtzehnten Jahrhunderts
umzuwandeln. Hieß es auch „Asien“, so drehte es sich in der
Hauptsache doch um eine Gegenüberstellung von Chinesischer
und Japanischer Kunst. Durch Leihgaben von Museen und
Privatsammlern gelang es, von altchinesischer Grabplastik und
Malerei, wie von japanischer Graphik ein ausdrucksreiches Bild
zu geben. Altbuddhistische Kunst verschiedenster Provenienz,
340
bemalung.
Sine Sntlcbeidung des Reiebsgetncbts.
Eine bedeutsame und interessante Entscheidung zu den
§§ 12 und 14 des Warenzeichengesetzes hat das Reichsgericht
gefällt. Dem Urteil liegt folgender Tatbestand zu Grunde. Eine
Dresdner Porzellanhandlung und Porzellanmalerei besitzt einen
Vorrat weißen unbemalten Porzellans aus der staatlichen Meißner
Porzellanmanufaktur, das die von der Manufaktur seit fast 200
Jahren geführte, unter dem 2. Oktober 1894 neu als Warenzeichen
eingetragene Kurschwertermarke führt. Der Kläger verlangt vom
Gericht die Feststellung des vom Staat auf Grund seines Waren-
zeichenrechts bestrittenen Rechts, das weiße Porzellan zu bemalen
und bemalt in den Handel zu bringen. Er behauptet, daß die
Bemalung nicht durch die Kurschwerter gedeckt werde und ferner,
daß jedenfalls der Beklagte, in diesem Falle Beamte der Manufaktur,
mit dieser Gebarung einverstanden gewesen wäre. Das Reichs-
gericht hat in Übereinstimmung mit den Vorentscheiden des
Landgerichts und des Oberlandesgerichts Dresden die Klage ab-
gewiesen. In den Entscheidungsgründen wird hervorgehoben, daß
das Warenzeichen der gekreuzten Kurschwerter außer unbemaltem
auch bemaltes Porzellan mitumfaßt, daß es also das Fertigerzeugnis
so, wie es im Verkehr gehandelt wird, also gegebenenfalls mit
seiner Bemalung schützt. Das ist auch die Auffassung des
Publikums in seiner Gesamtheit, das als Käufer gemalter Porzellan-
gegenstände in Betracht kommt. Eine Bemalung durch Dritte
außerhalb des Betriebes der Manufaktur würde nur dann nicht in
den Schutzbereich des Warenzeichens eingreifen, wenn der zu
bemalende Gegenstand sich nicht mehr im Handelsverkehr befände
oder die Bemalung im rechtlich zulässigen Einverständnisse mit
der Manufaktur erfolgte. Auch der Umstand, daß gewohnheits-
mäßig nur die beiden ersten Qualitäten von der Manufaktur selbst
bemalt werden, die dritte aber nicht, rechtfertigt das Bemalen
dieser dritten Qualität durch Dritte nicht, weil bei Anmalung des
Warenzeichens ein Unterschied zwischen den verschiedenen
Qualitäten nicht gemacht ist und das große Publikum diese Ver-
hältnisse nicht allgemein kennt. Wenn Beamte der Manufaktur
oder selbst die Vertreter der sächsischen Staatsregierung ihre
Zustimmung dazu geben würden oder gegeben hätten, daß weißes
Porzellan von Dritten bemalt und mit dem Warenzeichen ver-
sehen in den Verkehr gebracht wurde, so würde das unverbindlich
sein. Denn das Warenzeichengesetz bezweckt neben dem Schutz
des Warenzeicheninhabers gegen unlauteren Wettbewerb anderer
Gewerbetreibenden auch den Schutz des Publikums, des
Konsumenten, gegen Täuschungen.
Diese sehr zu begrüßende Entscheidung dient nicht nur zur
Bekämpfung der mannigfachen Mißbräuche im Porzellanhandel,
sondern dient auch dem gesamten Kunsthandel als heilsame Lehre.
Unzulässig ist jede Änderung eines Kunstgegenstandes oder seiner
Bezeichnung, solange der Gegenstand im Handelsverkehr ist. Da
aber erfahrungsgemäß Stücke aus Privatbesitz mit der Zeit regel-
mäßig wieder in den Handel kommen, warnt die Entscheidung
auch Privatsammler und Händler vor Eingriffen an den Gegen-
ständen, die eine Täuschung über die Herkunft herbeiführen können.
Dr. Elias Erasmus.
6eiüet?blicbe labt?esaus{fellungen
in Düesderu
ln Dresden haben führende Vereine den Plan gefaßt, all-
jährlich im Städtischen Ausstellungsgebäude eine Schau hoch-
wertiger Erzeugnisse zu veranstalten, und zwar jedes Jahr aus
einem bestimmten Gebiete. Der Hauptzweck soll die Anregung
der betreffenden Gewerbezweige zur Schaffung derartiger muster-
gültiger Werterzeugnisse sein. Die Hochwertigkeit der
ausgestellten Erzeugnisse sowohl nach der künstlerischen als auch
nach der technischen Seite wie nach dem Gebrauchswert wird
durch verschiedene Bedingungen gewährleistet. Außerdem soll
die künstlerischeHochwertigkeit durch Prämiierungen
festgestellt werden.
Es handelt sich bei diesem Plan, der nunmehr bereits eine
festere Gestalt angenommen hat, nicht um eine Art gewöhnlicher
Ausstellung, auch nicht lediglich um eine Dresdner oder sächsische
Angelegenheit, sondern um eine deutsche Wertschau, die
beim Deutschen Ausstellungs- und Meßamt, beim Leipziger Meß-
amt, beim Deutschen Werkbund, beim Verbände der keramischen
Gewerbe, dem Verband der Glasindustriellen Deutschlands reges
Interesse und Unterstützung findet.
Diese Schau wird mit dem Namen Deutsche Jahres-
schau Dresden bezeichnet und findet jeden Sommer im
Dresdner Ausstellungspalast statt, und zwar, wie schon bemerkt,
jedes Jahr aus einem anderen Gebiete des deutschen Gewerbes.
Jede derartige Jahresschau wird 3 Monate dauern, und zwar vom
15. Juni bis 15. September.
Die Jahresschau wird, dem Werte ihres Inhaltes entsprechend,
mit einfachen Mitteln würdig und in künstlerischem Geiste her-
gerichtet. Geschichtliche Abteilungen sollen hervor-
ragende Leistungen des jeweils ausgestellten Gewerbes aus
früheren Zeiten vorführen, um auf die Gegenwart befruchtend zu
wirken. Weiterhin sollen Herstellungsvorführungen
das Verständnis der Besucher für die Arbeitsleistung des zur
Schau gestellten Gewerbes wecken.
Die erste „Deutsche Jahresschau Dresden“ wird im
nächsten Jahre stattfinden, und zwar aus dem Gebiete des
deutschen Keramik - und Glasgewerbes. Im Jahre
1923 soll die deutsche Spielwarenindustrie folgen.
Der Arbeitsausschuß der Deutschen Jahresschau
Dresden besteht aus folgenden Herren: Direktor Fritz Brehmer
vom Dresdner Verkehrsverein (Vorsitzender), Stadtrat Dr. Temper,
Redakteur und Stadtrat Paul Barthel (Pressereferent), Dr. Graupner,
(Referent für Finanzen), Akademie-Direktor Prof. Groß (Leiter
der geschichtlichen Abteilung), Stadtbauamtmann Wirth (Referent
für Bauwesen), Stadtrat Dr. Krüger (städt. Vertreter für die Aus-
stellungsanlagen), Geheimrat Prof. Otto Gußmann, Hofrat Holst,
Direktor Dr. Kuhfal, Direktor Karl Schmidt (Hellerau), Regierungs-
rat Seiring, Prof. Robert Sterl, Hofrat Prof. Oskar Seyfferth.
Geschäftsführer ist Herr Friedrich Leege.
P. S-i.
Die ft’ankfut’tet’ fmbjabtfsmeffe.
Die Frankfurter Frühjahrsmesse war nicht nur durch ihre
Veranstaltung im „Römer“ unter dem Doppeltitel: „Asien in
der Kunst" und „Das schöne B u c h“ merkwürdig, sondern
auch in den Salons der Stadt von kunstwichtigen Ausstellungen
begleitet. S c h a m e s bot in Malerei und Graphik eine ganz
erlesene K i r c h n e r schau; der Kunstverein löste noch während
der Messe eine vorzügliche Ausstellung der „Frankfurter Künstler-
gesellschaft“ durch eine umfassende Kollektion von Gemälden,
Handzeichnungen und Druckgraphik Max Beckmann’s ab;
und schließlich sahen wir Magnus Zeller-Berlin im Salon C r a m e r.
Hinzu kam das große Ereignis der bei J. B a e r & C o. zur Ver-
steigerung stehenden Sammlungen Busch, Schöller usw. Eine
Gedächtnisausstellung zu Ehren des verstorbenen Kronberger
Landschafters Anton Burger bei Schneider repräsentierte
die historische Tradition.
Im Römer war es keine ganz leichte Aufgabe, den riesigen
Kaisersaal für die asiatische Kunstschau herzurichten. Prächtige
Gobelins an den Wänden und eine geschickte Raumteilung durch
japanische Wandschirme, dazu exotische Blumendekoration, über-
wanden die Schwierigkeit. Leichter war es, das Kurfürstenzimmer
in ein vornehmes Kunstkabinett des achtzehnten Jahrhunderts
umzuwandeln. Hieß es auch „Asien“, so drehte es sich in der
Hauptsache doch um eine Gegenüberstellung von Chinesischer
und Japanischer Kunst. Durch Leihgaben von Museen und
Privatsammlern gelang es, von altchinesischer Grabplastik und
Malerei, wie von japanischer Graphik ein ausdrucksreiches Bild
zu geben. Altbuddhistische Kunst verschiedenster Provenienz,
340