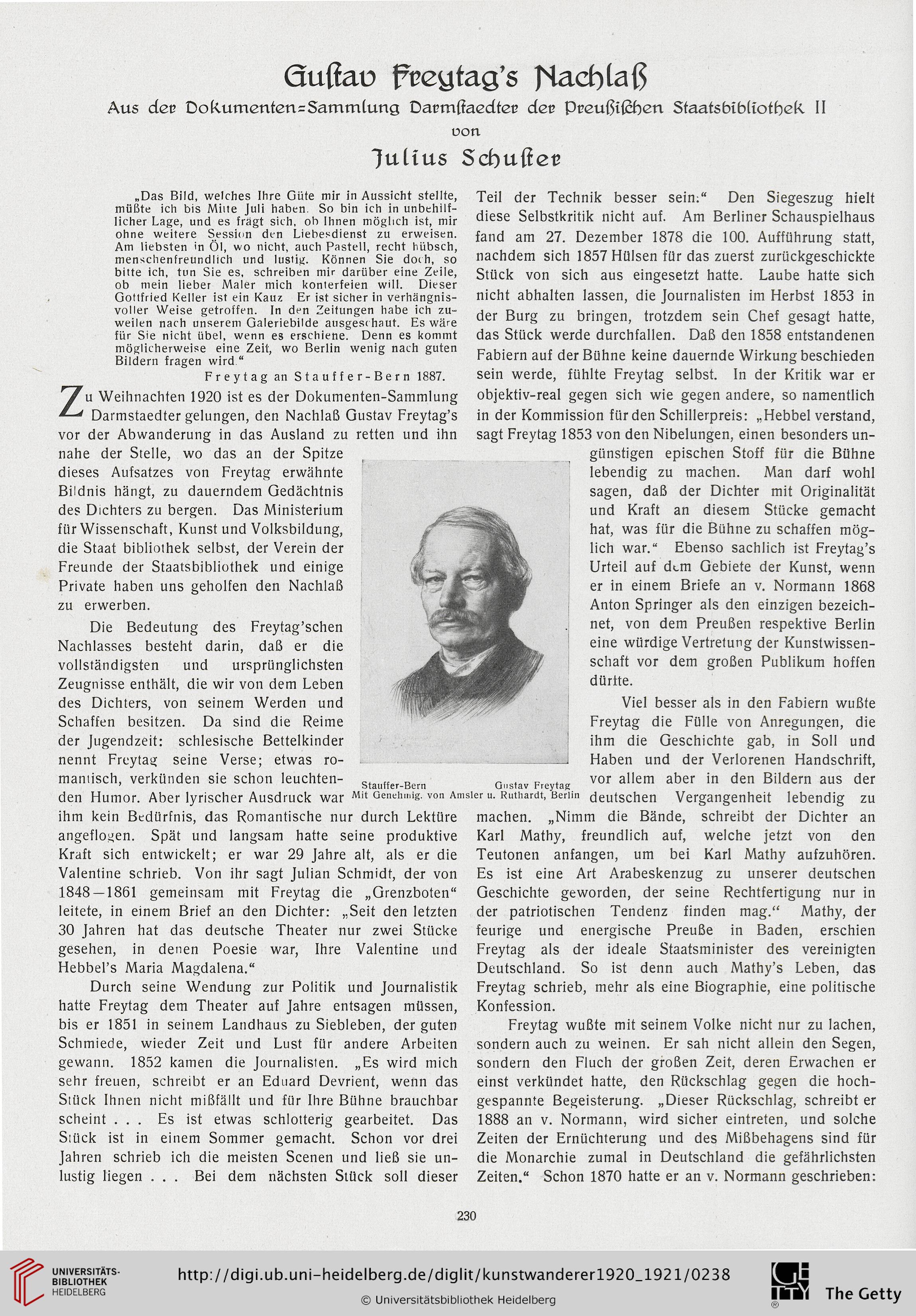Quffao preytag’s ]Had)taß
Aus dev Dokumenten=Sammlung Dat?m{laedtev det? ptteußi{eben Staatsbibliothek II
oon
lutius Scbußet?
„Das Bild, welches Ihre Güte mir in Aussicht stellte,
müßte ich bis Milte Juli haben So bin ich in unbehilf-
licher Lage, und es fragt sich, ob Ihnen möglich ist, mir
ohne weitere Session den Liebesdienst zu erweisen.
Am liebsten in Öl, wo nicht, auch Pastell, recht hübsch,
menschenfreundlich und lustig. Können Sie doch, so
bitte ich, tun Sie es, schreiben mir darüber eine Zeile,
ob mein lieber Maler mich konterfeien will. Dieser
Gottfried Keller ist ein Kauz Er ist sicher in verhängnis-
voller Weise getroffen, ln den Zeitungen habe ich zu-
weilen nach unserem Galeriebilde ausgeschaut. Es wäre
für Sie nicht übel, wenn es erschiene. Denn es kommt
möglicherweise eine Zeit, wo Berlin wenig nach guten
Bildern fragen wird “
Freytag an Stauffer-Bern 1887.
Teil der Technik besser sein:“ Den Siegeszug hielt
diese Selbstkritik nicht auf. Am Berliner Schauspielhaus
fand am 27. Dezember 1878 die 100. Aufführung statt,
nachdem sich 1857 Hülsen für das zuerst zurückgeschickte
Stück von sich aus eingesetzt hatte. Laube hatte sich
nicht abhalten lassen, die Journalisten im Herbst 1853 in
der Burg zu bringen, trotzdem sein Chef gesagt hatte,
das Stück werde durchfallen. Daß den 1858 entstandenen
Fabiern auf der Bühne keine dauernde Wirkung beschieden
sein werde, fühlte Freytag selbst. In der Kritik war er
Zu Weihnachten 1920 ist es der Dokumenten-Sammlung objektiv-real gegen sich wie gegen andere, so namentlich
nat-mctapHtpr orpinncrpn ripn Narhiaß HiKJtav Frpvtsa’s in der Kommission für den Schi 11 erpreis: „Hebbel verstand,
sagt Freytag 1853 von den Nibelungen, einen besonders un-
günstigen epischen Stoff für die Bühne
lebendig zu machen. Man darf wohl
sagen, daß der Dichter mit Originalität
und Kraft an diesem Stücke gemacht
hat, was für die Bühne zu schaffen mög-
lich war.“ Ebenso sachlich ist Freytag’s
Urteil auf dun Gebiete der Kunst, wenn
er in einem Briefe an v. Normann 1868
Anton Springer als den einzigen bezeich-
net, von dem Preußen respektive Berlin
eine würdige Vertretung der Kunstwissen-
schaft vor dem großen Publikum hoffen
dürfte.
Viel besser als in den Fabiern wußte
Freytag die Fülle von Anregungen, die
ihm die Geschichte gab, in Soll und
Haben und der Verlorenen Handschrift,
Gustav Freytag vor a**em aber 'n den Bildern aus der
den Humor. Aber lyrischer Ausdruck war Mit Geneh",ig-von Amsler u-Ruthardt'Berlin deutschen Vergangenheit lebendig zu
machen. „Nimm die Bände, schreibt der Dichter an
u Weihnachten 1920 ist es der Dokumenten-Sammlung
Darmstaedter gelungen, den Nachlaß Gustav Freytag’s
vor der Abwanderung in das Ausland zu retten und ihn
nahe der Stelle, wo das an der Spitze
dieses Aufsatzes von Freytag erwähnte
Bildnis hängt, zu dauerndem Gedächtnis
des Dichters zu bergen. Das Ministerium
für Wissenschaft, Kunst und Volksbildung,
die Staat bibliothek selbst, der Verein der
Freunde der Staatsbibliothek und einige
Private haben uns geholfen den Nachlaß
zu erwerben.
Die Bedeutung des Freytag’schen
Nachlasses besteht darin, daß er die
vollständigsten und ursprünglichsten
Zeugnisse enthält, die wir von dem Leben
des Dichters, von seinem Werden und
Schaffen besitzen. Da sind die Reime
der Jugendzeit: schlesische Bettelkinder
nennt Freytag seine Verse; etwas ro-
manlisch, verkünden sie schon leuchten- stauffer-Bem
ihm kein Bedürfnis, das Romantische nur durch Lektüre
angeflogen. Spät und langsam hatte seine produktive
Kraft sich entwickelt; er war 29 Jahre alt, als er die
Valentine schrieb. Von ihr sagt Julian Schmidt, der von
1848 — 1861 gemeinsam mit Freytag die „Grenzboten“
leitete, in einem Brief an den Dichter: „Seit den letzten
30 Jahren hat das deutsche Theater nur zwei Stücke
gesehen, in denen Poesie war, Ihre Valentine und
Hebbel’s Maria Magdalena.“
Durch seine Wendung zur Politik und Journalistik
hatte Freytag dem Theater auf Jahre entsagen müssen,
bis er 1851 in seinem Landhaus zu Siebleben, der guten
Schmiede, wieder Zeit und Lust für andere Arbeiten
gewann. 1852 kamen die Journalisten. „Es wird mich
sehr freuen, schreibt er an Eduard Devrient, wenn das
Stück Ihnen nicht mißfällt und für Ihre Bühne brauchbar
scheint ... Es ist etwas schlotterig gearbeitet. Das
Stück ist in einem Sommer gemacht. Schon vor drei
Jahren schrieb ich die meisten Scenen und ließ sie un-
lustig liegen . . . Bei dem nächsten Stück soll dieser
Karl Mathy, freundlich auf, welche jetzt von den
Teutonen anfangen, um bei Karl Mathy aufzuhören.
Es ist eine Art Arabeskenzug zu unserer deutschen
Geschichte geworden, der seine Rechtfertigung nur in
der patriotischen Tendenz finden mag.“ Mathy, der
feurige und energische Preuße in Baden, erschien
Freytag als der ideale Staatsminister des vereinigten
Deutschland. So ist denn auch Mathy’s Leben, das
Freytag schrieb, mehr als eine Biographie, eine politische
Konfession.
Freytag wußte mit seinem Volke nicht nur zu lachen,
sondern auch zu weinen. Er sah nicht allein den Segen,
sondern den Fluch der großen Zeit, deren Erwachen er
einst verkündet hatte, den Rückschlag gegen die hoch-
gespannte Begeisterung. „Dieser Rückschlag, schreibt er
1888 an v. Normann, wird sicher eintreten, und solche
Zeiten der Ernüchterung und des Mißbehagens sind für
die Monarchie zumal in Deutschland die gefährlichsten
Zeiten.“ Schon 1870 hatte er an v. Normann geschrieben:
230
Aus dev Dokumenten=Sammlung Dat?m{laedtev det? ptteußi{eben Staatsbibliothek II
oon
lutius Scbußet?
„Das Bild, welches Ihre Güte mir in Aussicht stellte,
müßte ich bis Milte Juli haben So bin ich in unbehilf-
licher Lage, und es fragt sich, ob Ihnen möglich ist, mir
ohne weitere Session den Liebesdienst zu erweisen.
Am liebsten in Öl, wo nicht, auch Pastell, recht hübsch,
menschenfreundlich und lustig. Können Sie doch, so
bitte ich, tun Sie es, schreiben mir darüber eine Zeile,
ob mein lieber Maler mich konterfeien will. Dieser
Gottfried Keller ist ein Kauz Er ist sicher in verhängnis-
voller Weise getroffen, ln den Zeitungen habe ich zu-
weilen nach unserem Galeriebilde ausgeschaut. Es wäre
für Sie nicht übel, wenn es erschiene. Denn es kommt
möglicherweise eine Zeit, wo Berlin wenig nach guten
Bildern fragen wird “
Freytag an Stauffer-Bern 1887.
Teil der Technik besser sein:“ Den Siegeszug hielt
diese Selbstkritik nicht auf. Am Berliner Schauspielhaus
fand am 27. Dezember 1878 die 100. Aufführung statt,
nachdem sich 1857 Hülsen für das zuerst zurückgeschickte
Stück von sich aus eingesetzt hatte. Laube hatte sich
nicht abhalten lassen, die Journalisten im Herbst 1853 in
der Burg zu bringen, trotzdem sein Chef gesagt hatte,
das Stück werde durchfallen. Daß den 1858 entstandenen
Fabiern auf der Bühne keine dauernde Wirkung beschieden
sein werde, fühlte Freytag selbst. In der Kritik war er
Zu Weihnachten 1920 ist es der Dokumenten-Sammlung objektiv-real gegen sich wie gegen andere, so namentlich
nat-mctapHtpr orpinncrpn ripn Narhiaß HiKJtav Frpvtsa’s in der Kommission für den Schi 11 erpreis: „Hebbel verstand,
sagt Freytag 1853 von den Nibelungen, einen besonders un-
günstigen epischen Stoff für die Bühne
lebendig zu machen. Man darf wohl
sagen, daß der Dichter mit Originalität
und Kraft an diesem Stücke gemacht
hat, was für die Bühne zu schaffen mög-
lich war.“ Ebenso sachlich ist Freytag’s
Urteil auf dun Gebiete der Kunst, wenn
er in einem Briefe an v. Normann 1868
Anton Springer als den einzigen bezeich-
net, von dem Preußen respektive Berlin
eine würdige Vertretung der Kunstwissen-
schaft vor dem großen Publikum hoffen
dürfte.
Viel besser als in den Fabiern wußte
Freytag die Fülle von Anregungen, die
ihm die Geschichte gab, in Soll und
Haben und der Verlorenen Handschrift,
Gustav Freytag vor a**em aber 'n den Bildern aus der
den Humor. Aber lyrischer Ausdruck war Mit Geneh",ig-von Amsler u-Ruthardt'Berlin deutschen Vergangenheit lebendig zu
machen. „Nimm die Bände, schreibt der Dichter an
u Weihnachten 1920 ist es der Dokumenten-Sammlung
Darmstaedter gelungen, den Nachlaß Gustav Freytag’s
vor der Abwanderung in das Ausland zu retten und ihn
nahe der Stelle, wo das an der Spitze
dieses Aufsatzes von Freytag erwähnte
Bildnis hängt, zu dauerndem Gedächtnis
des Dichters zu bergen. Das Ministerium
für Wissenschaft, Kunst und Volksbildung,
die Staat bibliothek selbst, der Verein der
Freunde der Staatsbibliothek und einige
Private haben uns geholfen den Nachlaß
zu erwerben.
Die Bedeutung des Freytag’schen
Nachlasses besteht darin, daß er die
vollständigsten und ursprünglichsten
Zeugnisse enthält, die wir von dem Leben
des Dichters, von seinem Werden und
Schaffen besitzen. Da sind die Reime
der Jugendzeit: schlesische Bettelkinder
nennt Freytag seine Verse; etwas ro-
manlisch, verkünden sie schon leuchten- stauffer-Bem
ihm kein Bedürfnis, das Romantische nur durch Lektüre
angeflogen. Spät und langsam hatte seine produktive
Kraft sich entwickelt; er war 29 Jahre alt, als er die
Valentine schrieb. Von ihr sagt Julian Schmidt, der von
1848 — 1861 gemeinsam mit Freytag die „Grenzboten“
leitete, in einem Brief an den Dichter: „Seit den letzten
30 Jahren hat das deutsche Theater nur zwei Stücke
gesehen, in denen Poesie war, Ihre Valentine und
Hebbel’s Maria Magdalena.“
Durch seine Wendung zur Politik und Journalistik
hatte Freytag dem Theater auf Jahre entsagen müssen,
bis er 1851 in seinem Landhaus zu Siebleben, der guten
Schmiede, wieder Zeit und Lust für andere Arbeiten
gewann. 1852 kamen die Journalisten. „Es wird mich
sehr freuen, schreibt er an Eduard Devrient, wenn das
Stück Ihnen nicht mißfällt und für Ihre Bühne brauchbar
scheint ... Es ist etwas schlotterig gearbeitet. Das
Stück ist in einem Sommer gemacht. Schon vor drei
Jahren schrieb ich die meisten Scenen und ließ sie un-
lustig liegen . . . Bei dem nächsten Stück soll dieser
Karl Mathy, freundlich auf, welche jetzt von den
Teutonen anfangen, um bei Karl Mathy aufzuhören.
Es ist eine Art Arabeskenzug zu unserer deutschen
Geschichte geworden, der seine Rechtfertigung nur in
der patriotischen Tendenz finden mag.“ Mathy, der
feurige und energische Preuße in Baden, erschien
Freytag als der ideale Staatsminister des vereinigten
Deutschland. So ist denn auch Mathy’s Leben, das
Freytag schrieb, mehr als eine Biographie, eine politische
Konfession.
Freytag wußte mit seinem Volke nicht nur zu lachen,
sondern auch zu weinen. Er sah nicht allein den Segen,
sondern den Fluch der großen Zeit, deren Erwachen er
einst verkündet hatte, den Rückschlag gegen die hoch-
gespannte Begeisterung. „Dieser Rückschlag, schreibt er
1888 an v. Normann, wird sicher eintreten, und solche
Zeiten der Ernüchterung und des Mißbehagens sind für
die Monarchie zumal in Deutschland die gefährlichsten
Zeiten.“ Schon 1870 hatte er an v. Normann geschrieben:
230