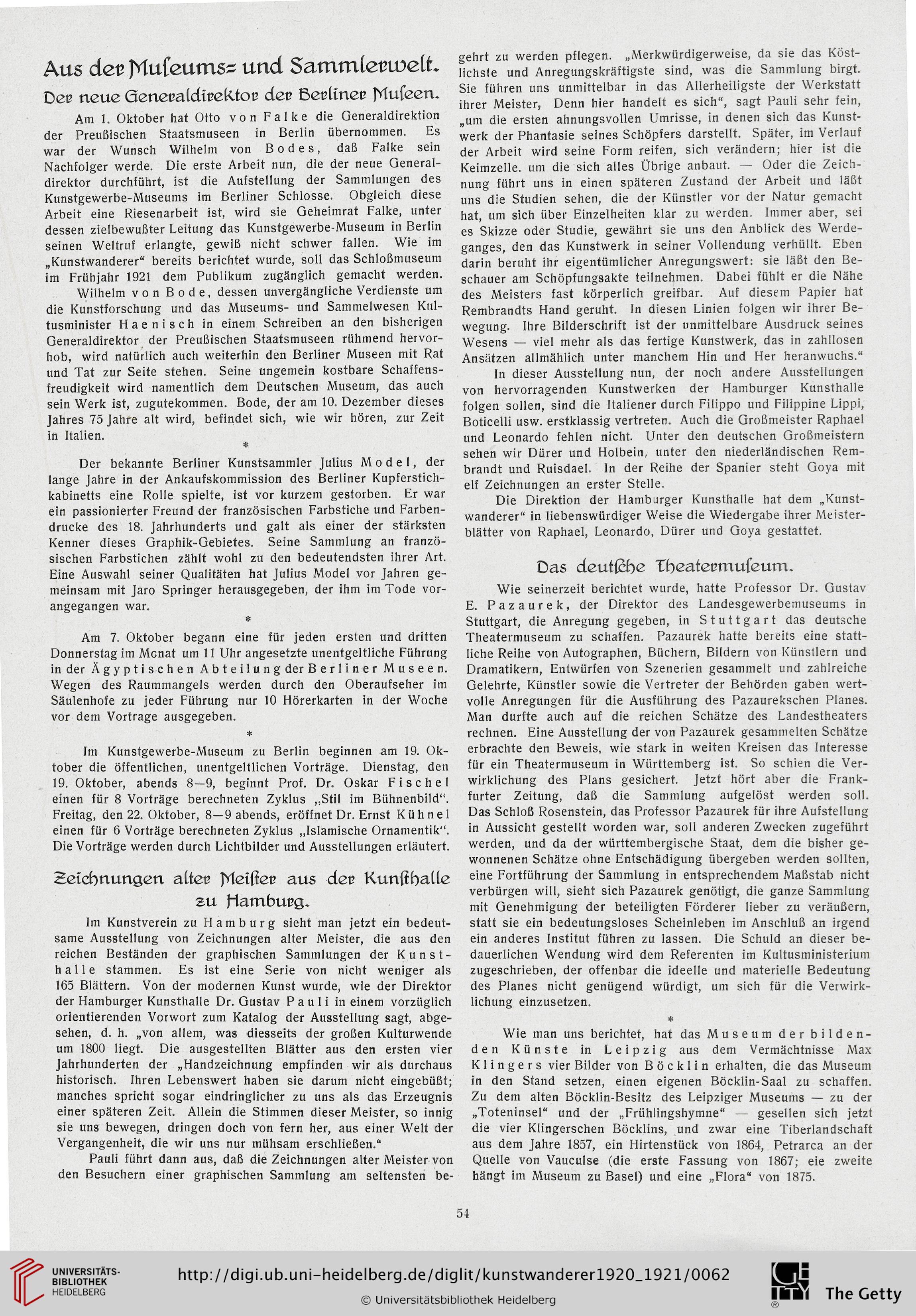Aus dev JMufeumss und Sammlevwelt.
Dec neue Qenecaldit’eKtoc dev Beütinet? Idufeen.
Am 1. Oktober hat Otto von Falke die Generaldirektion
der Preußischen Staatsmuseen in Berlin übernommen. Es
war der Wunsch Wilhelm von Bodes, daß Falke sein
Nachfolger werde. Die erste Arbeit nun, die der neue General-
direktor durchführt, ist die Aufstellung der Sammlungen des
Kunstgewerbe-Museums im Berliner Schlosse. Obgleich diese
Arbeit eine Riesenarbeit ist, wird sie Geheimrat Falke, unter
dessen zielbewußter Leitung das Kunstgewerbe-Museum in Berlin
seinen Weltruf erlangte, gewiß nicht schwer fallen. Wie im
„Kunstwanderer“ bereits berichtet wurde, soll das Schloßmuseum
im Frühjahr 1921 dem Publikum zugänglich gemacht werden.
Wilhelm von Bode, dessen unvergängliche Verdienste um
die Kunstforschung und das Museums- und Sammelwesen Kul-
tusminister Haenisch in einem Schreiben an den bisherigen
Generaldirektor der Preußischen Staatsmuseen rühmend hervor-
hob, wird natürlich auch weiterhin den Berliner Museen mit Rat
und Tat zur Seite stehen. Seine ungemein kostbare Schaffens-
freudigkeit wird namentlich dem Deutschen Museum, das auch
sein Werk ist, zugutekommen. Bode, der am 10. Dezember dieses
Jahres 75 Jahre alt wird, befindet sich, wie wir hören, zur Zeit
in Italien.
*
Der bekannte Berliner Kunstsammler Julius Model, der
lange Jahre in der Ankaufskommission des Berliner Kupferstich-
kabinetts eine Rolle spielte, ist vor kurzem gestorben. Er war
ein passionierter Freund der französischen Farbstiche und Farben-
drucke des 18. Jahrhunderts und galt als einer der stärksten
Kenner dieses Graphik-Gebietes. Seine Sammlung an franzö-
sischen Farbstichen zählt wohl zu den bedeutendsten ihrer Art.
Eine Auswahl seiner Qualitäten hat Julius Model vor Jahren ge-
meinsam mit Jaro Springer herausgegeben, der ihm im Tode vor-
angegangen war.
*
Am 7. Oktober begann eine für jeden ersten und dritten
Donnerstag im Monat um 11 Uhr angesetzte unentgeltliche Führung
in der Ägyptischen Abteilung der Berliner Museen.
Wegen des Raummangels werden durch den Oberaufseher im
Säulenhofe zu jeder Führung nur 10 Hörerkarten in der Woche
vor dem Vortrage ausgegeben.
*
Im Kunstgewerbe-Museum zu Berlin beginnen am 19. Ok-
tober die öffentlichen, unentgeltlichen Vorträge. Dienstag, den
19. Oktober, abends 8—9, beginnt Prof. Dr. Oskar Fischei
einen für 8 Vorträge berechneten Zyklus „Stil im Bühnenbild“.
Freitag, den 22. Oktober, 8—9 abends, eröffnet Dr. Ernst K ü h n e 1
einen für 6 Vorträge berechneten Zyklus „Islamische Ornamentik“.
Die Vorträge werden durch Lichtbilder und Ausstellungen erläutert.
Hcicbnungen altev jYletßee aus dev Kunffballe
zu Jiambut’g.
Im Kunstverein zu Hamburg sieht man jetzt ein bedeut-
same Ausstellung von Zeichnungen alter Meister, die aus den
reichen Beständen der graphischen Sammlungen der Kunst-
halle stammen. Es ist eine Serie von nicht weniger als
165 Blättern. Von der modernen Kunst wurde, wie der Direktor
der Hamburger Kunsthalle Dr. Gustav Pauli in einem vorzüglich
orientierenden Vorwort zum Katalog der Ausstellung sagt, abge-
sehen, d. h. „von allem, was diesseits der großen Kulturwende
um 1800 liegt. Die ausgestellten Blätter aus den ersten vier
Jahrhunderten der „Handzeichnung empfinden wir als durchaus
historisch. Ihren Lebenswert haben sie darum nicht eingebüßt;
manches spricht sogar eindringlicher zu uns als das Erzeugnis
einer späteren Zeit. Allein die Stimmen dieser Meister, so innig
sie uns bewegen, dringen doch von fern her, aus einer Welt der
Vergangenheit, die wir uns nur mühsam erschließen.“
Pauli führt dann aus, daß die Zeichnungen alter Meister von
den Besuchern einer graphischen Sammlung am seltensten be-
gehrt zu werden pflegen. „Merkwürdigerweise, da sie das Köst-
lichste und Anregungskräftigste sind, was die Sammlung birgt.
Sie führen uns unmittelbar in das Allerheiligste der Werkstatt
ihrer Meister, Denn hier handelt es sich“, sagt Pauli sehr fein,
„um die ersten ahnungsvollen Umrisse, in denen sich das Kunst-
werk der Phantasie seines Schöpfers darstellt. Später, im Verlauf
der Arbeit wird seine Form reifen, sich verändern; hier ist die
Keimzelle, um die sich alles Übrige anbaut. — Oder die Zeich-
nung führt uns in einen späteren Zustand der Arbeit und läßt
uns die Studien sehen, die der Künstler vor der Natur gemacht
hat, um sich über Einzelheiten klar zu werden. Immer aber, sei
es Skizze oder Studie, gewährt sie uns den Anblick des Werde-
ganges, den das Kunstwerk in seiner Vollendung verhüllt. Eben
darin beruht ihr eigentümlicher Anregungswert: sie läßt den Be-
schauer am Schöpfungsakte teilnehmen. Dabei fühlt er die Nähe
des Meisters fast körperlich greifbar. Auf diesem Papier hat
Rembrandts Hand geruht. In diesen Linien folgen wir ihrer Be-
wegung. Ihre Bilderschrift ist der unmittelbare Ausdruck seines
Wesens — viel mehr als das fertige Kunstwerk, das in zahllosen
Ansätzen allmählich unter manchem Hin und Her heranwuchs.“
In dieser Ausstellung nun, der noch andere Ausstellungen
von hervorragenden Kunstwerken der Hamburger Kunsthalle
folgen sollen, sind die Italiener durch Filippo und Filippine Lippi,
Boticelli usw. erstklassig vertreten. Auch die Großmeister Raphael
und Leonardo fehlen nicht. Unter den deutschen Großmeistern
sehen wir Dürer und Holbein, unter den niederländischen Rem-
brandt und Ruisdael. In der Reihe der Spanier steht Goya mit
elf Zeichnungen an erster Stelle.
Die Direktion der Hamburger Kunsthalle hat dem „Kunst-
wanderer“ in liebenswürdiger Weise die Wiedergabe ihrer Meister-
blätter von Raphael, Leonardo, Dürer und Goya gestattet.
Das deut{cbe Tbeatecmufeum.
Wie seinerzeit berichtet wurde, hatte Professor Dr. Gustav
E. Pazaurek, der Direktor des Landesgewerbemuseums in
Stuttgart, die Anregung gegeben, in Stuttgart das deutsche
Theatermuseum zu schaffen. Pazaurek hatte bereits eine statt-
liche Reihe von Autographen, Büchern, Bildern von Künstlern und
Dramatikern, Entwürfen von Szenerien gesammelt und zahlreiche
Gelehrte, Künstler sowie die Vertreter der Behörden gaben wert-
volle Anregungen für die Ausführung des Pazaurekschen Planes.
Man durfte auch auf die reichen Schätze des Landestheaters
rechnen. Eine Ausstellung der von Pazaurek gesammelten Schätze
erbrachte den Beweis, wie stark in weiten Kreisen das Interesse
für ein Theatermuseum in Württemberg ist. So schien die Ver-
wirklichung des Plans gesichert. Jetzt hört aber die Frank-
furter Zeitung, daß die Sammlung aufgelöst werden soll.
Das Schloß Rosenstein, das Professor Pazaurek für ihre Aufstellung
in Aussicht gestellt worden war, soll anderen Zwecken zugeführt
werden, und da der württembergische Staat, dem die bisher ge-
wonnenen Schätze ohne Entschädigung übergeben werden sollten,
eine Fortführung der Sammlung in entsprechendem Maßstab nicht
verbürgen will, sieht sich Pazaurek genötigt, die ganze Sammlung
mit Genehmigung der beteiligten Förderer lieber zu veräußern,
statt sie ein bedeutungsloses Scheinleben im Anschluß an irgend
ein anderes Institut führen zu lassen. Die Schuld an dieser be-
dauerlichen Wendung wird dem Referenten im Kultusministerium
zugeschrieben, der offenbar die ideelle und materielle Bedeutung
des Planes nicht genügend würdigt, um sich für die Verwirk-
lichung einzusetzen.
*
Wie man uns berichtet, hat das Museum der bilden-
den Künste in Leipzig aus dem Vermächtnisse Max
K1 i n g e r s vier Bilder von B ö c k 1 i n erhalten, die das Museum
in den Stand setzen, einen eigenen Böcklin-Saal zu schaffen.
Zu dem alten Böcklin-Besitz des Leipziger Museums — zu der
„Toteninsel“ und der „Frühlingshymne“ — gesellen sich jetzt
die vier Klingerschen Böcklins, und zwar eine Tiberlandschaft
aus dem Jahre 1857, ein Hirtenstück von 1864, Petrarca an der
Quelle von Vauculse (die erste Fassung von 1867; eie zweite
hängt im Museum zu Basel) und eine „Flora“ von 1875.
54
Dec neue Qenecaldit’eKtoc dev Beütinet? Idufeen.
Am 1. Oktober hat Otto von Falke die Generaldirektion
der Preußischen Staatsmuseen in Berlin übernommen. Es
war der Wunsch Wilhelm von Bodes, daß Falke sein
Nachfolger werde. Die erste Arbeit nun, die der neue General-
direktor durchführt, ist die Aufstellung der Sammlungen des
Kunstgewerbe-Museums im Berliner Schlosse. Obgleich diese
Arbeit eine Riesenarbeit ist, wird sie Geheimrat Falke, unter
dessen zielbewußter Leitung das Kunstgewerbe-Museum in Berlin
seinen Weltruf erlangte, gewiß nicht schwer fallen. Wie im
„Kunstwanderer“ bereits berichtet wurde, soll das Schloßmuseum
im Frühjahr 1921 dem Publikum zugänglich gemacht werden.
Wilhelm von Bode, dessen unvergängliche Verdienste um
die Kunstforschung und das Museums- und Sammelwesen Kul-
tusminister Haenisch in einem Schreiben an den bisherigen
Generaldirektor der Preußischen Staatsmuseen rühmend hervor-
hob, wird natürlich auch weiterhin den Berliner Museen mit Rat
und Tat zur Seite stehen. Seine ungemein kostbare Schaffens-
freudigkeit wird namentlich dem Deutschen Museum, das auch
sein Werk ist, zugutekommen. Bode, der am 10. Dezember dieses
Jahres 75 Jahre alt wird, befindet sich, wie wir hören, zur Zeit
in Italien.
*
Der bekannte Berliner Kunstsammler Julius Model, der
lange Jahre in der Ankaufskommission des Berliner Kupferstich-
kabinetts eine Rolle spielte, ist vor kurzem gestorben. Er war
ein passionierter Freund der französischen Farbstiche und Farben-
drucke des 18. Jahrhunderts und galt als einer der stärksten
Kenner dieses Graphik-Gebietes. Seine Sammlung an franzö-
sischen Farbstichen zählt wohl zu den bedeutendsten ihrer Art.
Eine Auswahl seiner Qualitäten hat Julius Model vor Jahren ge-
meinsam mit Jaro Springer herausgegeben, der ihm im Tode vor-
angegangen war.
*
Am 7. Oktober begann eine für jeden ersten und dritten
Donnerstag im Monat um 11 Uhr angesetzte unentgeltliche Führung
in der Ägyptischen Abteilung der Berliner Museen.
Wegen des Raummangels werden durch den Oberaufseher im
Säulenhofe zu jeder Führung nur 10 Hörerkarten in der Woche
vor dem Vortrage ausgegeben.
*
Im Kunstgewerbe-Museum zu Berlin beginnen am 19. Ok-
tober die öffentlichen, unentgeltlichen Vorträge. Dienstag, den
19. Oktober, abends 8—9, beginnt Prof. Dr. Oskar Fischei
einen für 8 Vorträge berechneten Zyklus „Stil im Bühnenbild“.
Freitag, den 22. Oktober, 8—9 abends, eröffnet Dr. Ernst K ü h n e 1
einen für 6 Vorträge berechneten Zyklus „Islamische Ornamentik“.
Die Vorträge werden durch Lichtbilder und Ausstellungen erläutert.
Hcicbnungen altev jYletßee aus dev Kunffballe
zu Jiambut’g.
Im Kunstverein zu Hamburg sieht man jetzt ein bedeut-
same Ausstellung von Zeichnungen alter Meister, die aus den
reichen Beständen der graphischen Sammlungen der Kunst-
halle stammen. Es ist eine Serie von nicht weniger als
165 Blättern. Von der modernen Kunst wurde, wie der Direktor
der Hamburger Kunsthalle Dr. Gustav Pauli in einem vorzüglich
orientierenden Vorwort zum Katalog der Ausstellung sagt, abge-
sehen, d. h. „von allem, was diesseits der großen Kulturwende
um 1800 liegt. Die ausgestellten Blätter aus den ersten vier
Jahrhunderten der „Handzeichnung empfinden wir als durchaus
historisch. Ihren Lebenswert haben sie darum nicht eingebüßt;
manches spricht sogar eindringlicher zu uns als das Erzeugnis
einer späteren Zeit. Allein die Stimmen dieser Meister, so innig
sie uns bewegen, dringen doch von fern her, aus einer Welt der
Vergangenheit, die wir uns nur mühsam erschließen.“
Pauli führt dann aus, daß die Zeichnungen alter Meister von
den Besuchern einer graphischen Sammlung am seltensten be-
gehrt zu werden pflegen. „Merkwürdigerweise, da sie das Köst-
lichste und Anregungskräftigste sind, was die Sammlung birgt.
Sie führen uns unmittelbar in das Allerheiligste der Werkstatt
ihrer Meister, Denn hier handelt es sich“, sagt Pauli sehr fein,
„um die ersten ahnungsvollen Umrisse, in denen sich das Kunst-
werk der Phantasie seines Schöpfers darstellt. Später, im Verlauf
der Arbeit wird seine Form reifen, sich verändern; hier ist die
Keimzelle, um die sich alles Übrige anbaut. — Oder die Zeich-
nung führt uns in einen späteren Zustand der Arbeit und läßt
uns die Studien sehen, die der Künstler vor der Natur gemacht
hat, um sich über Einzelheiten klar zu werden. Immer aber, sei
es Skizze oder Studie, gewährt sie uns den Anblick des Werde-
ganges, den das Kunstwerk in seiner Vollendung verhüllt. Eben
darin beruht ihr eigentümlicher Anregungswert: sie läßt den Be-
schauer am Schöpfungsakte teilnehmen. Dabei fühlt er die Nähe
des Meisters fast körperlich greifbar. Auf diesem Papier hat
Rembrandts Hand geruht. In diesen Linien folgen wir ihrer Be-
wegung. Ihre Bilderschrift ist der unmittelbare Ausdruck seines
Wesens — viel mehr als das fertige Kunstwerk, das in zahllosen
Ansätzen allmählich unter manchem Hin und Her heranwuchs.“
In dieser Ausstellung nun, der noch andere Ausstellungen
von hervorragenden Kunstwerken der Hamburger Kunsthalle
folgen sollen, sind die Italiener durch Filippo und Filippine Lippi,
Boticelli usw. erstklassig vertreten. Auch die Großmeister Raphael
und Leonardo fehlen nicht. Unter den deutschen Großmeistern
sehen wir Dürer und Holbein, unter den niederländischen Rem-
brandt und Ruisdael. In der Reihe der Spanier steht Goya mit
elf Zeichnungen an erster Stelle.
Die Direktion der Hamburger Kunsthalle hat dem „Kunst-
wanderer“ in liebenswürdiger Weise die Wiedergabe ihrer Meister-
blätter von Raphael, Leonardo, Dürer und Goya gestattet.
Das deut{cbe Tbeatecmufeum.
Wie seinerzeit berichtet wurde, hatte Professor Dr. Gustav
E. Pazaurek, der Direktor des Landesgewerbemuseums in
Stuttgart, die Anregung gegeben, in Stuttgart das deutsche
Theatermuseum zu schaffen. Pazaurek hatte bereits eine statt-
liche Reihe von Autographen, Büchern, Bildern von Künstlern und
Dramatikern, Entwürfen von Szenerien gesammelt und zahlreiche
Gelehrte, Künstler sowie die Vertreter der Behörden gaben wert-
volle Anregungen für die Ausführung des Pazaurekschen Planes.
Man durfte auch auf die reichen Schätze des Landestheaters
rechnen. Eine Ausstellung der von Pazaurek gesammelten Schätze
erbrachte den Beweis, wie stark in weiten Kreisen das Interesse
für ein Theatermuseum in Württemberg ist. So schien die Ver-
wirklichung des Plans gesichert. Jetzt hört aber die Frank-
furter Zeitung, daß die Sammlung aufgelöst werden soll.
Das Schloß Rosenstein, das Professor Pazaurek für ihre Aufstellung
in Aussicht gestellt worden war, soll anderen Zwecken zugeführt
werden, und da der württembergische Staat, dem die bisher ge-
wonnenen Schätze ohne Entschädigung übergeben werden sollten,
eine Fortführung der Sammlung in entsprechendem Maßstab nicht
verbürgen will, sieht sich Pazaurek genötigt, die ganze Sammlung
mit Genehmigung der beteiligten Förderer lieber zu veräußern,
statt sie ein bedeutungsloses Scheinleben im Anschluß an irgend
ein anderes Institut führen zu lassen. Die Schuld an dieser be-
dauerlichen Wendung wird dem Referenten im Kultusministerium
zugeschrieben, der offenbar die ideelle und materielle Bedeutung
des Planes nicht genügend würdigt, um sich für die Verwirk-
lichung einzusetzen.
*
Wie man uns berichtet, hat das Museum der bilden-
den Künste in Leipzig aus dem Vermächtnisse Max
K1 i n g e r s vier Bilder von B ö c k 1 i n erhalten, die das Museum
in den Stand setzen, einen eigenen Böcklin-Saal zu schaffen.
Zu dem alten Böcklin-Besitz des Leipziger Museums — zu der
„Toteninsel“ und der „Frühlingshymne“ — gesellen sich jetzt
die vier Klingerschen Böcklins, und zwar eine Tiberlandschaft
aus dem Jahre 1857, ein Hirtenstück von 1864, Petrarca an der
Quelle von Vauculse (die erste Fassung von 1867; eie zweite
hängt im Museum zu Basel) und eine „Flora“ von 1875.
54