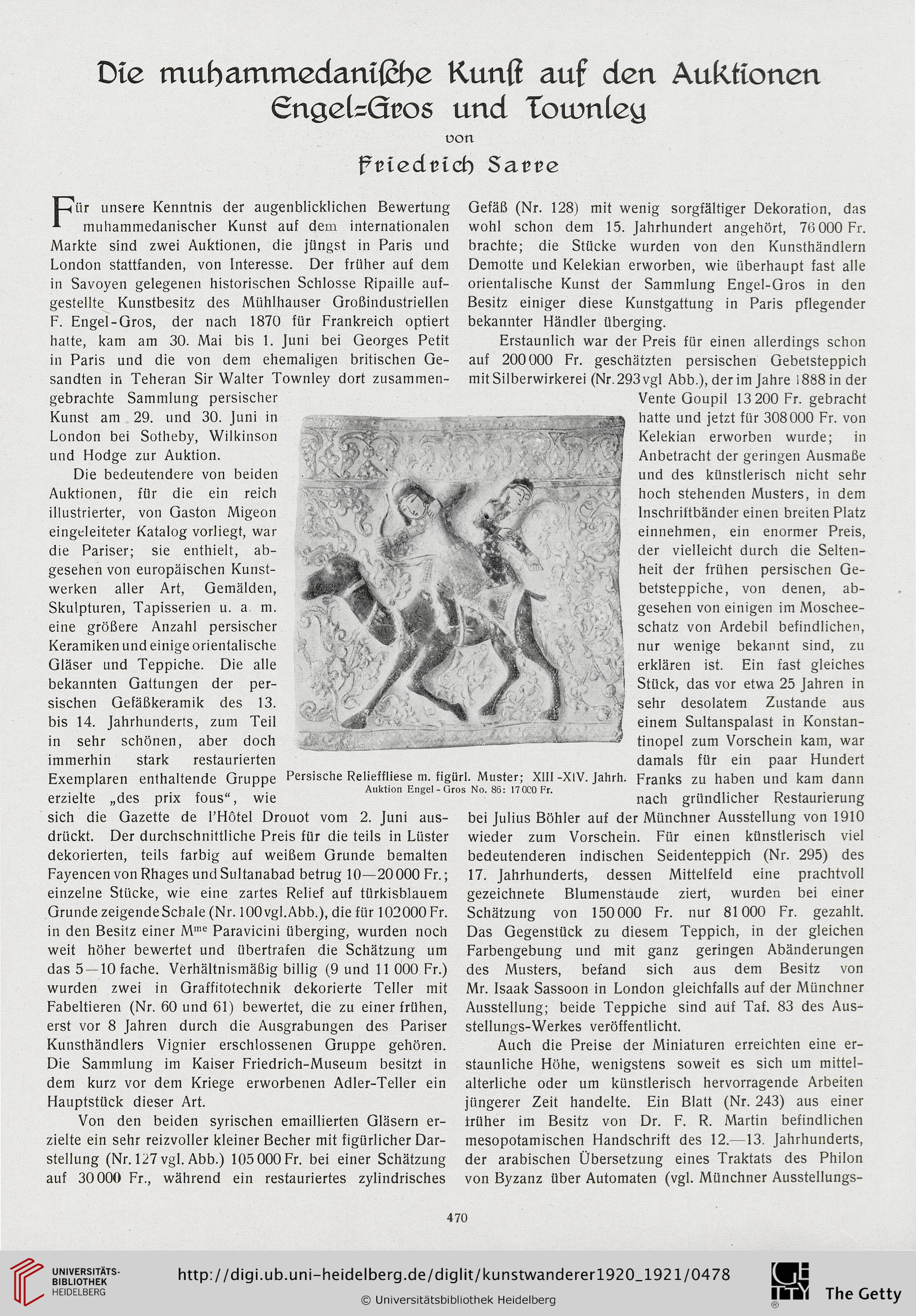Die muh ammedamßbe Kunff auf den Auktionen
6ngel=0t?os und Tomnley
oon
fviedvicb Savve
Ln tir unsere Kenntnis der augenblicklichen Bewertung
*■ muhammedanischer Kunst auf dem internationalen
Markte sind zwei Auktionen, die jüngst in Paris und
London stattfanden, von Interesse. Der früher auf dem
in Savoyen gelegenen historischen Schlosse Ripaille auf-
gestellte Kunstbesitz des Mühlhauser Großindustriellen
F. Engel-Gros, der nach 1870 für Frankreich optiert
hatte, kam am 30. Mai bis 1. Juni bei Georges Petit
in Paris und die von dem ehemaligen britischen Ge-
sandten in Teheran Sir Walter Townley dort zusammen-
gebrachte Sammlung persischer
Kunst am 29. und 30. Juni in
London bei Sotheby, Wilkinson
und Hodge zur Auktion.
Die bedeutendere von beiden
Auktionen, für die ein reich
illustrierter, von Gaston Migeon
eingeleiteter Katalog vorliegt, war
die Pariser; sie enthielt, ab-
gesehen von europäischen Kunst-
werken aller Art, Gemälden,
Skulpturen, Tapisserien u. a m.
eine größere Anzahl persischer
Keramiken und einige orientalische
Gläser und Teppiche. Die alle
bekannten Gattungen der per-
sischen Gefäßkeramik des 13.
bis 14. Jahrhunderts, zum Teil
in sehr schönen, aber doch
immerhin stark restaurierten
Exemplaren enthaltende Gruppe
erzielte „des prix fous“, wie
sich die Gazette de l’Hötel Drouot vom 2. Juni aus-
drückt. Der durchschnittliche Preis für die teils in Lüster
dekorierten, teils farbig auf weißem Grunde bemalten
Fayencen von Rhages und Sultanabad betrug 10—20 000 Fr.;
einzelne Stücke, wie eine zartes Relief auf türkisblauem
Grunde zeigendeScbale (Nr. lOOvgl.Abb.), die für 102000 Fr.
in den Besitz einer Mme Paravicini überging, wurden noch
weit höher bewertet und übertrafen die Schätzung um
das 5 —10 fache. Verhältnismäßig billig (9 und 11 000 Fr.)
wurden zwei in Graffitotechnik dekorierte Teller mit
Fabeltieren (Nr. 60 und 61) bewertet, die zu einer frühen,
erst vor 8 Jahren durch die Ausgrabungen des Pariser
Kunsthändlers Vignier erschlossenen Gruppe gehören.
Die Sammlung im Kaiser Friedrich-Museum besitzt in
dem kurz vor dem Kriege erworbenen Adler-Teller ein
Hauptstück dieser Art.
Von den beiden syrischen emaillierten Gläsern er-
zielte ein sehr reizvoller kleiner Becher mit figürlicher Dar-
stellung (Nr. 127 vgl. Abb.) 105 000 Fr. bei einer Schätzung
auf 30000 Fr., während ein restauriertes zylindrisches
Persische Relieffliese m. figürl. Muster; XIII -XIV. Jahrh.
Auktion Engel - Gros No. 86: 17000 Fr.
Gefäß (Nr. 128) mit wenig sorgfältiger Dekoration, das
wohl schon dem 15. Jahrhundert angehört, 76 000 Fr.
brachte; die Stücke wurden von den Kunsthändlern
Demotte und Kelekian erworben, wie überhaupt fast alle
orientalische Kunst der Sammlung Engel-Gros in den
Besitz einiger diese Kunstgattung in Paris pflegender
bekannter Händler überging.
Erstaunlich war der Preis für einen allerdings schon
auf 200 000 Fr. geschätzten persischen Gebetsteppich
mit Silberwirkerei (Nr.293vgl Abb.), der im Jahre 1888 in der
Vente Goupil 13 200 Fr. gebracht
hatte und jetzt für 308000 Fr. von
Kelekian erworben wurde; in
Anbetracht der geringen Ausmaße
und des künstlerisch nicht sehr
hoch stehenden Musters, in dem
Inschriftbänder einen breiten Platz
einnehmen, ein enormer Preis,
der vielleicht durch die Selten-
heit der frühen persischen Ge-
betsteppiche, von denen, ab-
gesehen von einigen im Moschee-
schatz von Ardebil befindlichen,
nur wenige bekannt sind, zu
erklären ist. Ein fast gleiches
Stück, das vor etwa 25 Jahren in
sehr desolatem Zustande aus
einem Sultanspalast in Konstan-
tinopel zum Vorschein kam, war
damals für ein paar Hundert
Franks zu haben und kam dann
nach gründlicher Restaurierung
bei Julius Böhler auf der Münchner Ausstellung von 1910
wieder zum Vorschein. Für einen künstlerisch viel
bedeutenderen indischen Seidenteppich (Nr. 295) des
17. Jahrhunderts, dessen Mittelfeld eine prachtvoll
gezeichnete Blumenstaude ziert, wurden bei einer
Schätzung von 150000 Fr. nur 81000 Fr. gezahlt.
Das Gegenstück zu diesem Teppich, in der gleichen
Farbengebung und mit ganz geringen Abänderungen
des Musters, befand sich aus dem Besitz von
Mr. Isaak Sassoon in London gleichfalls auf der Münchner
Ausstellung; beide Teppiche sind auf Taf. 83 des Aus-
stellungs-Werkes veröffentlicht.
Auch die Preise der Miniaturen erreichten eine er-
staunliche Höhe, wenigstens soweit es sich um mittel-
alterliche oder um künstlerisch hervorragende Arbeiten
jüngerer Zeit handelte. Ein Blatt (Nr. 243) aus einer
früher im Besitz von Dr. F. R. Martin befindlichen
mesopotamischen Handschrift des 12.—13. Jahrhunderts,
der arabischen Übersetzung eines Traktats des Philon
von Byzanz über Automaten (vgl. Münchner Ausstellungs-
470
6ngel=0t?os und Tomnley
oon
fviedvicb Savve
Ln tir unsere Kenntnis der augenblicklichen Bewertung
*■ muhammedanischer Kunst auf dem internationalen
Markte sind zwei Auktionen, die jüngst in Paris und
London stattfanden, von Interesse. Der früher auf dem
in Savoyen gelegenen historischen Schlosse Ripaille auf-
gestellte Kunstbesitz des Mühlhauser Großindustriellen
F. Engel-Gros, der nach 1870 für Frankreich optiert
hatte, kam am 30. Mai bis 1. Juni bei Georges Petit
in Paris und die von dem ehemaligen britischen Ge-
sandten in Teheran Sir Walter Townley dort zusammen-
gebrachte Sammlung persischer
Kunst am 29. und 30. Juni in
London bei Sotheby, Wilkinson
und Hodge zur Auktion.
Die bedeutendere von beiden
Auktionen, für die ein reich
illustrierter, von Gaston Migeon
eingeleiteter Katalog vorliegt, war
die Pariser; sie enthielt, ab-
gesehen von europäischen Kunst-
werken aller Art, Gemälden,
Skulpturen, Tapisserien u. a m.
eine größere Anzahl persischer
Keramiken und einige orientalische
Gläser und Teppiche. Die alle
bekannten Gattungen der per-
sischen Gefäßkeramik des 13.
bis 14. Jahrhunderts, zum Teil
in sehr schönen, aber doch
immerhin stark restaurierten
Exemplaren enthaltende Gruppe
erzielte „des prix fous“, wie
sich die Gazette de l’Hötel Drouot vom 2. Juni aus-
drückt. Der durchschnittliche Preis für die teils in Lüster
dekorierten, teils farbig auf weißem Grunde bemalten
Fayencen von Rhages und Sultanabad betrug 10—20 000 Fr.;
einzelne Stücke, wie eine zartes Relief auf türkisblauem
Grunde zeigendeScbale (Nr. lOOvgl.Abb.), die für 102000 Fr.
in den Besitz einer Mme Paravicini überging, wurden noch
weit höher bewertet und übertrafen die Schätzung um
das 5 —10 fache. Verhältnismäßig billig (9 und 11 000 Fr.)
wurden zwei in Graffitotechnik dekorierte Teller mit
Fabeltieren (Nr. 60 und 61) bewertet, die zu einer frühen,
erst vor 8 Jahren durch die Ausgrabungen des Pariser
Kunsthändlers Vignier erschlossenen Gruppe gehören.
Die Sammlung im Kaiser Friedrich-Museum besitzt in
dem kurz vor dem Kriege erworbenen Adler-Teller ein
Hauptstück dieser Art.
Von den beiden syrischen emaillierten Gläsern er-
zielte ein sehr reizvoller kleiner Becher mit figürlicher Dar-
stellung (Nr. 127 vgl. Abb.) 105 000 Fr. bei einer Schätzung
auf 30000 Fr., während ein restauriertes zylindrisches
Persische Relieffliese m. figürl. Muster; XIII -XIV. Jahrh.
Auktion Engel - Gros No. 86: 17000 Fr.
Gefäß (Nr. 128) mit wenig sorgfältiger Dekoration, das
wohl schon dem 15. Jahrhundert angehört, 76 000 Fr.
brachte; die Stücke wurden von den Kunsthändlern
Demotte und Kelekian erworben, wie überhaupt fast alle
orientalische Kunst der Sammlung Engel-Gros in den
Besitz einiger diese Kunstgattung in Paris pflegender
bekannter Händler überging.
Erstaunlich war der Preis für einen allerdings schon
auf 200 000 Fr. geschätzten persischen Gebetsteppich
mit Silberwirkerei (Nr.293vgl Abb.), der im Jahre 1888 in der
Vente Goupil 13 200 Fr. gebracht
hatte und jetzt für 308000 Fr. von
Kelekian erworben wurde; in
Anbetracht der geringen Ausmaße
und des künstlerisch nicht sehr
hoch stehenden Musters, in dem
Inschriftbänder einen breiten Platz
einnehmen, ein enormer Preis,
der vielleicht durch die Selten-
heit der frühen persischen Ge-
betsteppiche, von denen, ab-
gesehen von einigen im Moschee-
schatz von Ardebil befindlichen,
nur wenige bekannt sind, zu
erklären ist. Ein fast gleiches
Stück, das vor etwa 25 Jahren in
sehr desolatem Zustande aus
einem Sultanspalast in Konstan-
tinopel zum Vorschein kam, war
damals für ein paar Hundert
Franks zu haben und kam dann
nach gründlicher Restaurierung
bei Julius Böhler auf der Münchner Ausstellung von 1910
wieder zum Vorschein. Für einen künstlerisch viel
bedeutenderen indischen Seidenteppich (Nr. 295) des
17. Jahrhunderts, dessen Mittelfeld eine prachtvoll
gezeichnete Blumenstaude ziert, wurden bei einer
Schätzung von 150000 Fr. nur 81000 Fr. gezahlt.
Das Gegenstück zu diesem Teppich, in der gleichen
Farbengebung und mit ganz geringen Abänderungen
des Musters, befand sich aus dem Besitz von
Mr. Isaak Sassoon in London gleichfalls auf der Münchner
Ausstellung; beide Teppiche sind auf Taf. 83 des Aus-
stellungs-Werkes veröffentlicht.
Auch die Preise der Miniaturen erreichten eine er-
staunliche Höhe, wenigstens soweit es sich um mittel-
alterliche oder um künstlerisch hervorragende Arbeiten
jüngerer Zeit handelte. Ein Blatt (Nr. 243) aus einer
früher im Besitz von Dr. F. R. Martin befindlichen
mesopotamischen Handschrift des 12.—13. Jahrhunderts,
der arabischen Übersetzung eines Traktats des Philon
von Byzanz über Automaten (vgl. Münchner Ausstellungs-
470