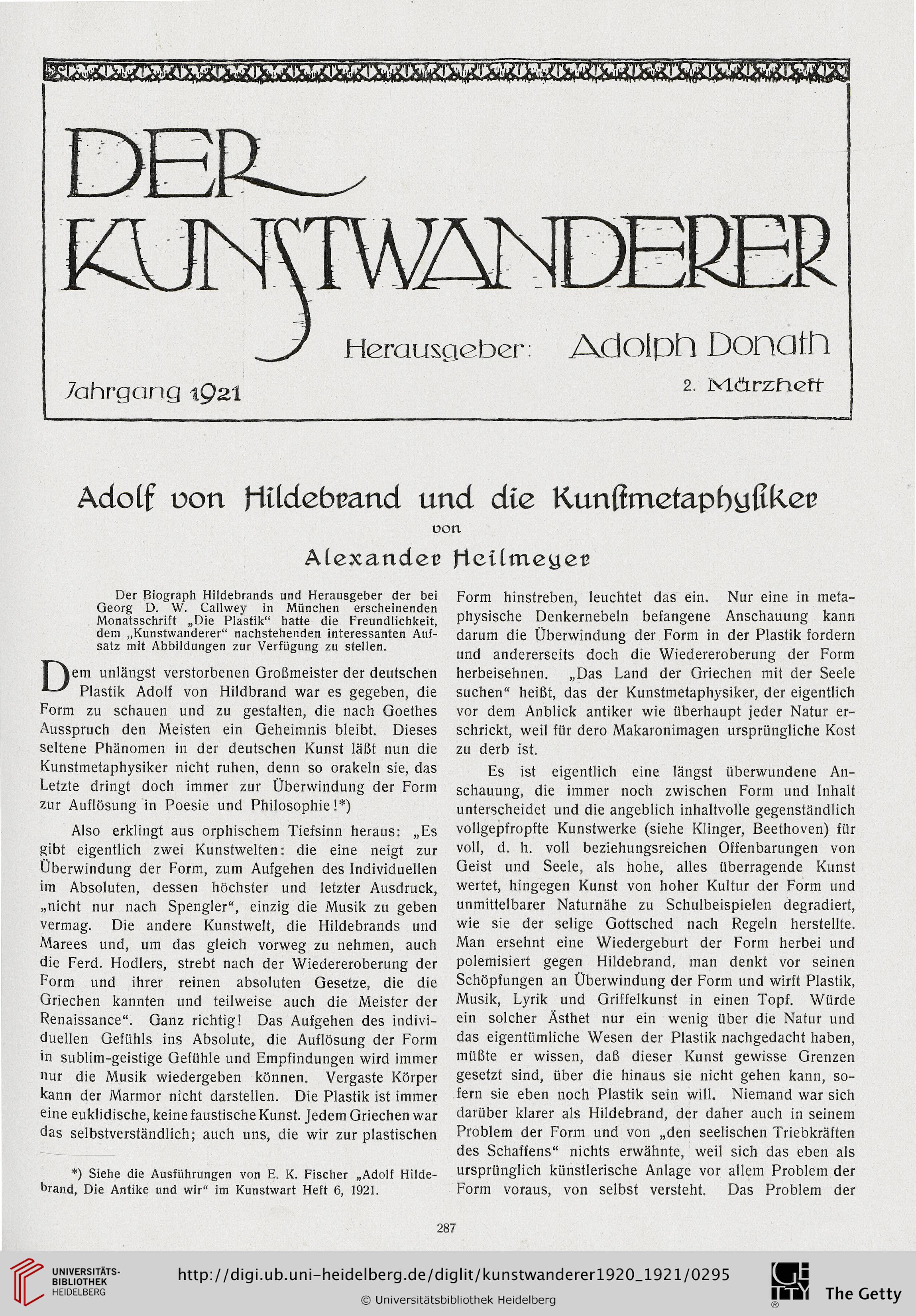Donath, Adolph [Hrsg.]
Der Kunstwanderer: Zeitschrift für alte und neue Kunst, für Kunstmarkt und Sammelwesen
— 2.1920/21
Zitieren dieser Seite
Bitte zitieren Sie diese Seite, indem Sie folgende Adresse (URL)/folgende DOI benutzen:
https://doi.org/10.11588/diglit.27814#0295
DOI Heft:
2. Märzheft
DOI Artikel:Heilmeyer, Alexander: Adolf von Hildebrand und die Kunstmetaphysiker
DOI Seite / Zitierlink:https://doi.org/10.11588/diglit.27814#0295
7ohrgang tQzl
Herausflßber: Adolph DonütP
2. IMörzfieft
Adolf oon }iildcbt?and und die Kunltmetapbyllket?
oon
Alexander dcÜmcyctJ
Der Biograph Hildebrands und Herausgeber der bei
Georg D. W. Callwey in München erscheinenden
Monatsschrift „Die Plastik“ hatte die Freundlichkeit,
dem „Kunstwanderer“ nachstehenden interessanten Auf-
satz mit Abbildungen zur Verfügung zu stellen.
[ jem unlängst verstorbenen Großmeister der deutschen
Plastik Adolf von Hildbrand war es gegeben, die
Form zu schauen und zu gestalten, die nach Goethes
Ausspruch den Meisten ein Geheimnis bleibt. Dieses
seltene Phänomen in der deutschen Kunst läßt nun die
Kunstmetaphysiker nicht ruhen, denn so orakeln sie, das
Letzte dringt doch immer zur Überwindung der Form
zur Auflösung in Poesie und Philosophie!*)
Also erklingt aus orphischem Tiefsinn heraus: „Es
gibt eigentlich zwei Kunstwelten: die eine neigt zur
Überwindung der Form, zum Aufgehen des Individuellen
im Absoluten, dessen höchster und letzter Ausdruck,
„nicht nur nach Spengler“, einzig die Musik zu geben
vermag. Die andere Kunstwelt, die Hildebrands und
Marees und, um das gleich vorweg zu nehmen, auch
die Ferd. Hodlers, strebt nach der Wiedereroberung der
Form und ihrer reinen absoluten Gesetze, die die
Griechen kannten und teilweise auch die Meister der
Renaissance“. Ganz richtig! Das Aufgehen des indivi-
duellen Gefühls ins Absolute, die Auflösung der Form
in sublim-geistige Gefühle und Empfindungen wird immer
nur die Musik wiedergeben können. Vergaste Körper
kann der Marmor nicht darstellen. Die Plastik ist immer
eine euklidische, keine faustische Kunst. Jedem Griechen war
das selbstverständlich; auch uns, die wir zur plastischen
*) Siehe die Ausführungen von E. K. Fischer „Adolf Hilde-
brand, Die Antike und wir“ im Kunstwart Heft 6, 1921.
Form hinstreben, leuchtet das ein. Nur eine in meta-
physische Denkernebeln befangene Anschauung kann
darum die Überwindung der Form in der Plastik fordern
und andererseits doch die Wiedereroberung der Form
herbeisehnen. „Das Land der Griechen mit der Seele
suchen“ heißt, das der Kunstmetaphysiker, der eigentlich
vor dem Anblick antiker wie überhaupt jeder Natur er-
schrickt, weil für dero Makaronimagen ursprüngliche Kost
zu derb ist.
Es ist eigentlich eine längst überwundene An-
schauung, die immer noch zwischen Form und Inhalt
unterscheidet und die angeblich inhaltvolle gegenständlich
vollgepfropfte Kunstwerke (siehe Klinger, Beethoven) für
voll, d. h. voll beziehungsreichen Offenbarungen von
Geist und Seele, als hohe, alles überragende Kunst
wertet, hingegen Kunst von hoher Kultur der Form und
unmittelbarer Naturnähe zu Schulbeispielen degradiert,
wie sie der selige Gottsched nach Regeln herstellte.
Man ersehnt eine Wiedergeburt der Form herbei und
polemisiert gegen Hildebrand, man denkt vor seinen
Schöpfungen an Überwindung der Form und wirft Plastik,
Musik, Lyrik und Griffelkunst in einen Topf. Würde
ein solcher Ästhet nur ein wenig über die Natur und
das eigentümliche Wesen der Plastik nachgedacht haben,
müßte er wissen, daß dieser Kunst gewisse Grenzen
gesetzt sind, über die hinaus sie nicht gehen kann, so-
fern sie eben noch Plastik sein will. Niemand war sich
darüber klarer als Hildebrand, der daher auch in seinem
Problem der Form und von „den seelischen Triebkräften
des Schaffens“ nichts erwähnte, weil sich das eben als
ursprünglich künstlerische Anlage vor allem Problem der
Form voraus, von selbst versteht. Das Problem der
287
Herausflßber: Adolph DonütP
2. IMörzfieft
Adolf oon }iildcbt?and und die Kunltmetapbyllket?
oon
Alexander dcÜmcyctJ
Der Biograph Hildebrands und Herausgeber der bei
Georg D. W. Callwey in München erscheinenden
Monatsschrift „Die Plastik“ hatte die Freundlichkeit,
dem „Kunstwanderer“ nachstehenden interessanten Auf-
satz mit Abbildungen zur Verfügung zu stellen.
[ jem unlängst verstorbenen Großmeister der deutschen
Plastik Adolf von Hildbrand war es gegeben, die
Form zu schauen und zu gestalten, die nach Goethes
Ausspruch den Meisten ein Geheimnis bleibt. Dieses
seltene Phänomen in der deutschen Kunst läßt nun die
Kunstmetaphysiker nicht ruhen, denn so orakeln sie, das
Letzte dringt doch immer zur Überwindung der Form
zur Auflösung in Poesie und Philosophie!*)
Also erklingt aus orphischem Tiefsinn heraus: „Es
gibt eigentlich zwei Kunstwelten: die eine neigt zur
Überwindung der Form, zum Aufgehen des Individuellen
im Absoluten, dessen höchster und letzter Ausdruck,
„nicht nur nach Spengler“, einzig die Musik zu geben
vermag. Die andere Kunstwelt, die Hildebrands und
Marees und, um das gleich vorweg zu nehmen, auch
die Ferd. Hodlers, strebt nach der Wiedereroberung der
Form und ihrer reinen absoluten Gesetze, die die
Griechen kannten und teilweise auch die Meister der
Renaissance“. Ganz richtig! Das Aufgehen des indivi-
duellen Gefühls ins Absolute, die Auflösung der Form
in sublim-geistige Gefühle und Empfindungen wird immer
nur die Musik wiedergeben können. Vergaste Körper
kann der Marmor nicht darstellen. Die Plastik ist immer
eine euklidische, keine faustische Kunst. Jedem Griechen war
das selbstverständlich; auch uns, die wir zur plastischen
*) Siehe die Ausführungen von E. K. Fischer „Adolf Hilde-
brand, Die Antike und wir“ im Kunstwart Heft 6, 1921.
Form hinstreben, leuchtet das ein. Nur eine in meta-
physische Denkernebeln befangene Anschauung kann
darum die Überwindung der Form in der Plastik fordern
und andererseits doch die Wiedereroberung der Form
herbeisehnen. „Das Land der Griechen mit der Seele
suchen“ heißt, das der Kunstmetaphysiker, der eigentlich
vor dem Anblick antiker wie überhaupt jeder Natur er-
schrickt, weil für dero Makaronimagen ursprüngliche Kost
zu derb ist.
Es ist eigentlich eine längst überwundene An-
schauung, die immer noch zwischen Form und Inhalt
unterscheidet und die angeblich inhaltvolle gegenständlich
vollgepfropfte Kunstwerke (siehe Klinger, Beethoven) für
voll, d. h. voll beziehungsreichen Offenbarungen von
Geist und Seele, als hohe, alles überragende Kunst
wertet, hingegen Kunst von hoher Kultur der Form und
unmittelbarer Naturnähe zu Schulbeispielen degradiert,
wie sie der selige Gottsched nach Regeln herstellte.
Man ersehnt eine Wiedergeburt der Form herbei und
polemisiert gegen Hildebrand, man denkt vor seinen
Schöpfungen an Überwindung der Form und wirft Plastik,
Musik, Lyrik und Griffelkunst in einen Topf. Würde
ein solcher Ästhet nur ein wenig über die Natur und
das eigentümliche Wesen der Plastik nachgedacht haben,
müßte er wissen, daß dieser Kunst gewisse Grenzen
gesetzt sind, über die hinaus sie nicht gehen kann, so-
fern sie eben noch Plastik sein will. Niemand war sich
darüber klarer als Hildebrand, der daher auch in seinem
Problem der Form und von „den seelischen Triebkräften
des Schaffens“ nichts erwähnte, weil sich das eben als
ursprünglich künstlerische Anlage vor allem Problem der
Form voraus, von selbst versteht. Das Problem der
287