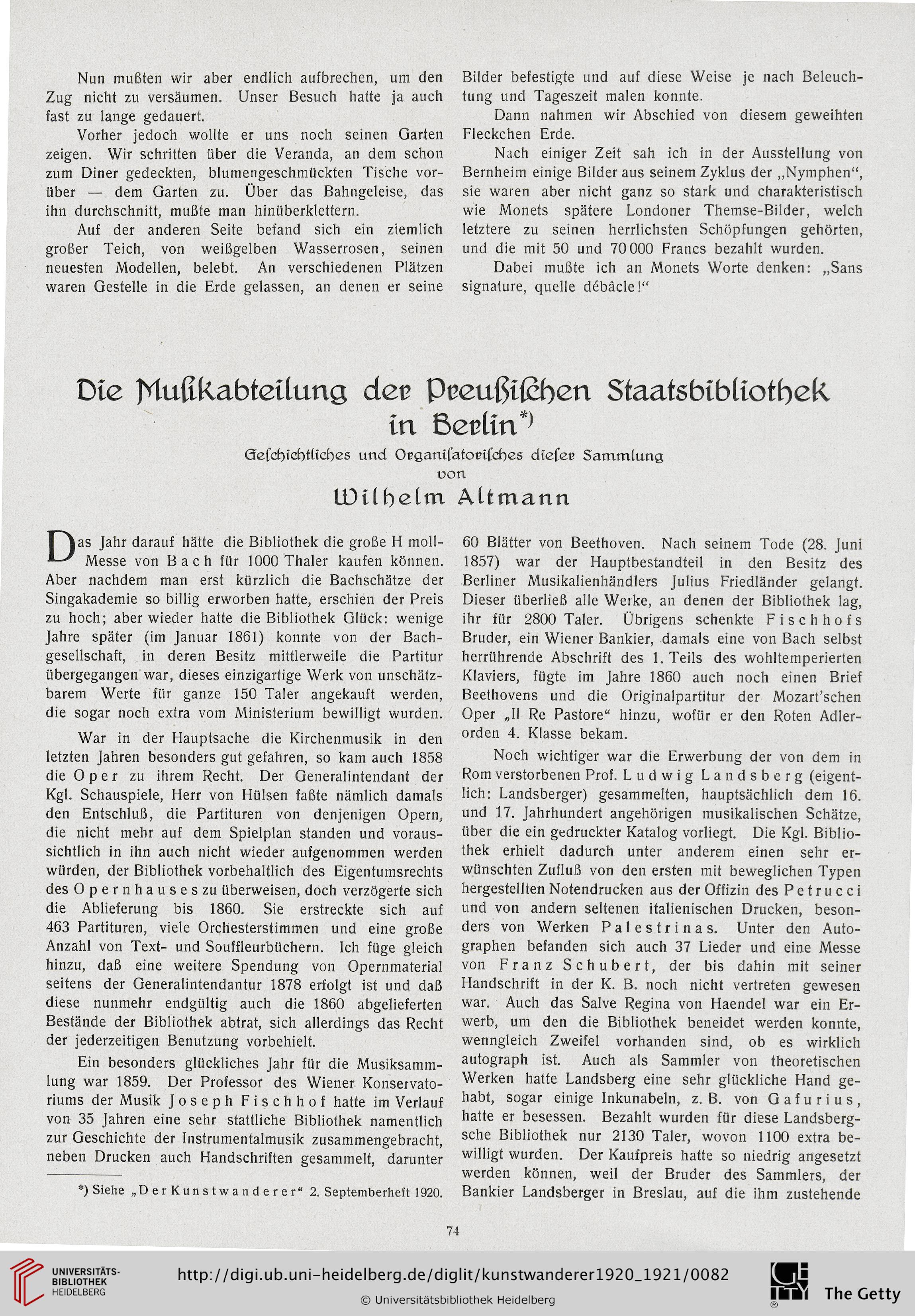Nun mußten wir aber endlich aufbrechen, um den
Zug nicht zu versäumen. Unser Besuch hatte ja auch
fast zu lange gedauert.
Vorher jedoch wollte er uns noch seinen Garten
zeigen. Wir schritten über die Veranda, an dem schon
zum Diner gedeckten, blumengeschmückten Tische vor-
über — dem Garten zu. Über das Bahngeleise, das
ihn durchschnitt, mußte man hinüberklettern.
Auf der anderen Seite befand sich ein ziemlich
großer Teich, von weißgelben Wasserrosen, seinen
neuesten Modellen, belebt. An verschiedenen Plätzen
waren Gestelle in die Erde gelassen, an denen er seine
Bilder befestigte und auf diese Weise je nach Beleuch-
tung und Tageszeit malen konnte.
Dann nahmen wir Abschied von diesem geweihten
Fleckchen Erde.
Nach einiger Zeit sah ich in der Ausstellung von
Bernheim einige Bilder aus seinem Zyklus der „Nymphen“,
sie waren aber nicht ganz so stark und charakteristisch
wie Monets spätere Londoner Themse-Bilder, welch
letztere zu seinen herrlichsten Schöpfungen gehörten,
und die mit 50 und 70 000 Francs bezahlt wurden.
Dabei mußte ich an Monets Worte denken: „Sans
signature, quelle d£bäcle!“
Die blutlkabtcÜung dec Peeußißben Staatsbibliothek
in Berlin *>
Qefcbicbtltches und Organifatocifcbes diefer Sammlung
oon
lÜÜbettn Altmann
Das Jahr darauf hätte die Bibliothek die große H moll-
Messe von Bach für 1000 Thaler kaufen können.
Aber nachdem man erst kürzlich die Bachschätze der
Singakademie so billig erworben hatte, erschien der Preis
zu hoch; aber wieder hatte die Bibliothek Glück: wenige
Jahre später (im Januar 1861) konnte von der Bach-
gesellschaft, in deren Besitz mittlerweile die Partitur
übergegangen war, dieses einzigartige Werk von unschätz-
barem Werte für ganze 150 Taler angekauft werden,
die sogar noch extra vom Ministerium bewilligt wurden.
War in der Hauptsache die Kirchenmusik in den
letzten Jahren besonders gut gefahren, so kam auch 1858
die Oper zu ihrem Recht. Der Generalintendant der
Kgl. Schauspiele, Herr von Hülsen faßte nämlich damals
den Entschluß, die Partituren von denjenigen Opern,
die nicht mehr auf dem Spielplan standen und voraus-
sichtlich in ihn auch nicht wieder aufgenommen werden
würden, der Bibliothek vorbehaltlich des Eigentumsrechts
des Opernhauses zu überweisen, doch verzögerte sich
die Ablieferung bis 1860. Sie erstreckte sich auf
463 Partituren, viele Orchesterstimmen und eine große
Anzahl von Text- und Souffleurbüchern. Ich füge gleich
hinzu, daß eine weitere Spendung von Opernmaterial
seitens der Generalintendantur 1878 erfolgt ist und daß
diese nunmehr endgültig auch die 1860 abgelieferten
Bestände der Bibliothek abtrat, sich allerdings das Recht
der jederzeitigen Benutzung vorbehielt.
Ein besonders glückliches Jahr für die Musiksamm-
lung war 1859. Der Professor des Wiener Konservato-
riums der Musik Joseph Fischhof hatte im Verlauf
von 35 Jahren eine sehr stattliche Bibliothek namentlich
zur Geschichte der Instrumentalmusik zusammengebracht,
neben Drucken auch Handschriften gesammelt, darunter
*) Siehe „Der Kunstwanderer“ 2. Septemberheft 1920.
60 Blätter von Beethoven. Nach seinem Tode (28. Juni
1857) war der Hauptbestandteil in den Besitz des
Berliner Musikalienhändlers Julius Friedländer gelangt.
Dieser überließ alle Werke, an denen der Bibliothek lag,
ihr für 2800 Taler. Übrigens schenkte Fischhofs
Bruder, ein Wiener Bankier, damals eine von Bach selbst
herrührende Abschrift des 1. Teils des wohltemperierten
Klaviers, fügte im Jahre 1860 auch noch einen Brief
Beethovens und die Originalpartitur der Mozart’schen
Oper „II Re Pastore“ hinzu, wofür er den Roten Adler-
orden 4. Klasse bekam.
Noch wichtiger war die Erwerbung der von dem in
Rom verstorbenen Prof. Ludwig Landsberg (eigent-
lich: Landsberger) gesammelten, hauptsächlich dem 16.
und 17. Jahrhundert angehörigen musikalischen Schätze,
über die ein gedruckter Katalog vorliegt. Die Kgl. Biblio-
thek erhielt dadurch unter anderem einen sehr er-
wünschten Zufluß von den ersten mit beweglichen Typen
hergestellten Notendrücken aus der Offizin des P e t r u c c i
und von andern seltenen italienischen Drucken, beson-
ders von Werken Palestrinas. Unter den Auto-
graphen befanden sich auch 37 Lieder und eine Messe
von Franz Schubert, der bis dahin mit seiner
Handschrift in der K. B. noch nicht vertreten gewesen
war. Auch das Salve Regina von Haendel war ein Er-
werb, um den die Bibliothek beneidet werden konnte,
wenngleich Zweifel vorhanden sind, ob es wirklich
autograph ist. Auch als Sammler von theoretischen
Werken hatte Landsberg eine sehr glückliche Hand ge-
habt, sogar einige Inkunabeln, z. B. von G a f u r i u s ,
hatte er besessen. Bezahlt wurden für diese Landsberg-
sche Bibliothek nur 2130 Taler, wovon 1100 extra be-
willigt wurden. Der Kaufpreis hatte so niedrig angesetzt
werden können, weil der Bruder des Sammlers, der
Bankier Landsberger in Breslau, auf die ihm zustehende
74
Zug nicht zu versäumen. Unser Besuch hatte ja auch
fast zu lange gedauert.
Vorher jedoch wollte er uns noch seinen Garten
zeigen. Wir schritten über die Veranda, an dem schon
zum Diner gedeckten, blumengeschmückten Tische vor-
über — dem Garten zu. Über das Bahngeleise, das
ihn durchschnitt, mußte man hinüberklettern.
Auf der anderen Seite befand sich ein ziemlich
großer Teich, von weißgelben Wasserrosen, seinen
neuesten Modellen, belebt. An verschiedenen Plätzen
waren Gestelle in die Erde gelassen, an denen er seine
Bilder befestigte und auf diese Weise je nach Beleuch-
tung und Tageszeit malen konnte.
Dann nahmen wir Abschied von diesem geweihten
Fleckchen Erde.
Nach einiger Zeit sah ich in der Ausstellung von
Bernheim einige Bilder aus seinem Zyklus der „Nymphen“,
sie waren aber nicht ganz so stark und charakteristisch
wie Monets spätere Londoner Themse-Bilder, welch
letztere zu seinen herrlichsten Schöpfungen gehörten,
und die mit 50 und 70 000 Francs bezahlt wurden.
Dabei mußte ich an Monets Worte denken: „Sans
signature, quelle d£bäcle!“
Die blutlkabtcÜung dec Peeußißben Staatsbibliothek
in Berlin *>
Qefcbicbtltches und Organifatocifcbes diefer Sammlung
oon
lÜÜbettn Altmann
Das Jahr darauf hätte die Bibliothek die große H moll-
Messe von Bach für 1000 Thaler kaufen können.
Aber nachdem man erst kürzlich die Bachschätze der
Singakademie so billig erworben hatte, erschien der Preis
zu hoch; aber wieder hatte die Bibliothek Glück: wenige
Jahre später (im Januar 1861) konnte von der Bach-
gesellschaft, in deren Besitz mittlerweile die Partitur
übergegangen war, dieses einzigartige Werk von unschätz-
barem Werte für ganze 150 Taler angekauft werden,
die sogar noch extra vom Ministerium bewilligt wurden.
War in der Hauptsache die Kirchenmusik in den
letzten Jahren besonders gut gefahren, so kam auch 1858
die Oper zu ihrem Recht. Der Generalintendant der
Kgl. Schauspiele, Herr von Hülsen faßte nämlich damals
den Entschluß, die Partituren von denjenigen Opern,
die nicht mehr auf dem Spielplan standen und voraus-
sichtlich in ihn auch nicht wieder aufgenommen werden
würden, der Bibliothek vorbehaltlich des Eigentumsrechts
des Opernhauses zu überweisen, doch verzögerte sich
die Ablieferung bis 1860. Sie erstreckte sich auf
463 Partituren, viele Orchesterstimmen und eine große
Anzahl von Text- und Souffleurbüchern. Ich füge gleich
hinzu, daß eine weitere Spendung von Opernmaterial
seitens der Generalintendantur 1878 erfolgt ist und daß
diese nunmehr endgültig auch die 1860 abgelieferten
Bestände der Bibliothek abtrat, sich allerdings das Recht
der jederzeitigen Benutzung vorbehielt.
Ein besonders glückliches Jahr für die Musiksamm-
lung war 1859. Der Professor des Wiener Konservato-
riums der Musik Joseph Fischhof hatte im Verlauf
von 35 Jahren eine sehr stattliche Bibliothek namentlich
zur Geschichte der Instrumentalmusik zusammengebracht,
neben Drucken auch Handschriften gesammelt, darunter
*) Siehe „Der Kunstwanderer“ 2. Septemberheft 1920.
60 Blätter von Beethoven. Nach seinem Tode (28. Juni
1857) war der Hauptbestandteil in den Besitz des
Berliner Musikalienhändlers Julius Friedländer gelangt.
Dieser überließ alle Werke, an denen der Bibliothek lag,
ihr für 2800 Taler. Übrigens schenkte Fischhofs
Bruder, ein Wiener Bankier, damals eine von Bach selbst
herrührende Abschrift des 1. Teils des wohltemperierten
Klaviers, fügte im Jahre 1860 auch noch einen Brief
Beethovens und die Originalpartitur der Mozart’schen
Oper „II Re Pastore“ hinzu, wofür er den Roten Adler-
orden 4. Klasse bekam.
Noch wichtiger war die Erwerbung der von dem in
Rom verstorbenen Prof. Ludwig Landsberg (eigent-
lich: Landsberger) gesammelten, hauptsächlich dem 16.
und 17. Jahrhundert angehörigen musikalischen Schätze,
über die ein gedruckter Katalog vorliegt. Die Kgl. Biblio-
thek erhielt dadurch unter anderem einen sehr er-
wünschten Zufluß von den ersten mit beweglichen Typen
hergestellten Notendrücken aus der Offizin des P e t r u c c i
und von andern seltenen italienischen Drucken, beson-
ders von Werken Palestrinas. Unter den Auto-
graphen befanden sich auch 37 Lieder und eine Messe
von Franz Schubert, der bis dahin mit seiner
Handschrift in der K. B. noch nicht vertreten gewesen
war. Auch das Salve Regina von Haendel war ein Er-
werb, um den die Bibliothek beneidet werden konnte,
wenngleich Zweifel vorhanden sind, ob es wirklich
autograph ist. Auch als Sammler von theoretischen
Werken hatte Landsberg eine sehr glückliche Hand ge-
habt, sogar einige Inkunabeln, z. B. von G a f u r i u s ,
hatte er besessen. Bezahlt wurden für diese Landsberg-
sche Bibliothek nur 2130 Taler, wovon 1100 extra be-
willigt wurden. Der Kaufpreis hatte so niedrig angesetzt
werden können, weil der Bruder des Sammlers, der
Bankier Landsberger in Breslau, auf die ihm zustehende
74