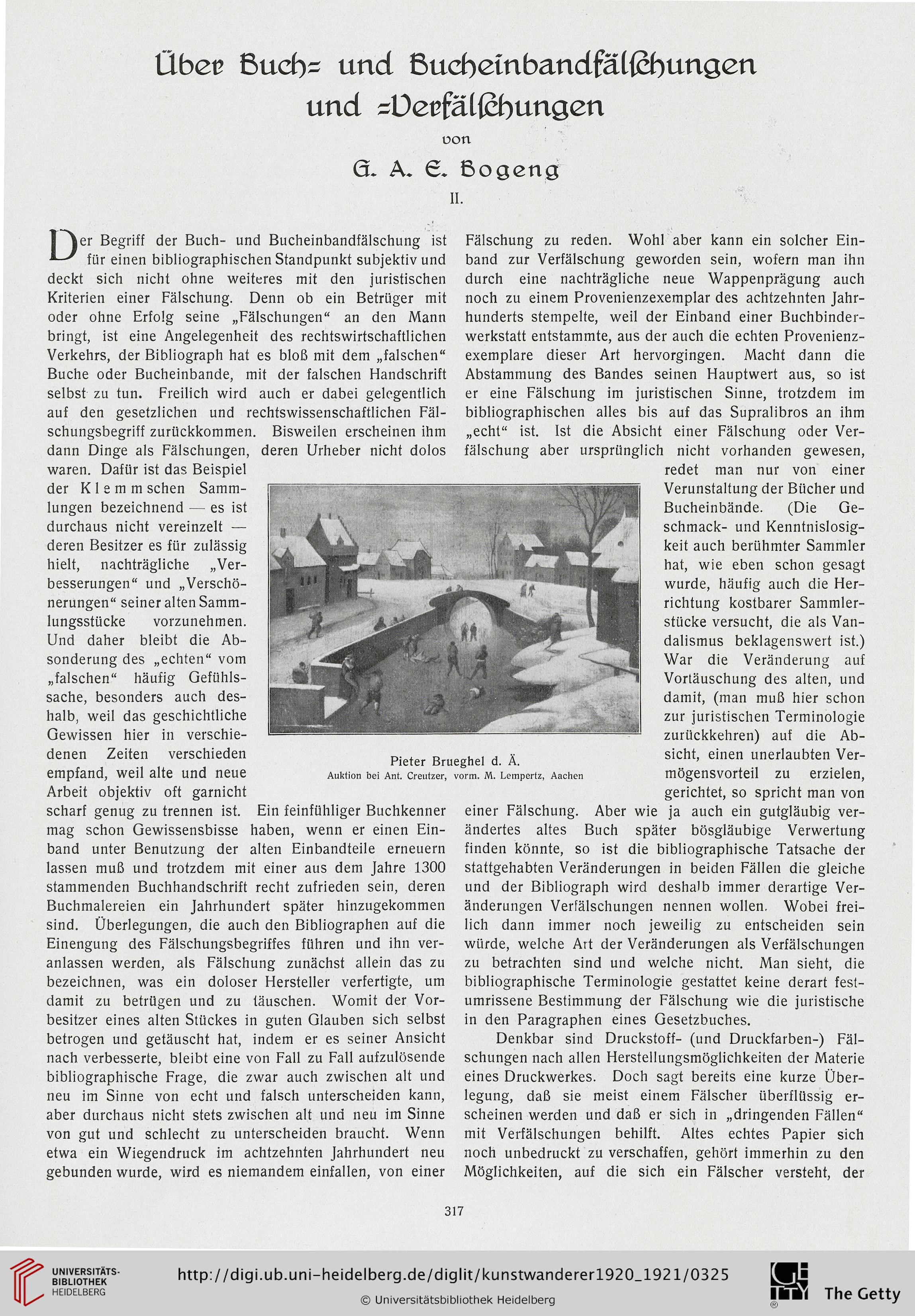Donath, Adolph [Hrsg.]
Der Kunstwanderer: Zeitschrift für alte und neue Kunst, für Kunstmarkt und Sammelwesen
— 2.1920/21
Zitieren dieser Seite
Bitte zitieren Sie diese Seite, indem Sie folgende Adresse (URL)/folgende DOI benutzen:
https://doi.org/10.11588/diglit.27814#0325
DOI Heft:
2. Märzheft
DOI Artikel:Bogeng, Gustav A. E.: Über Buch- und Bucheinbandfälschungen und -Verfälschungen, [3]
DOI Seite / Zitierlink:https://doi.org/10.11588/diglit.27814#0325
Übet? Buch- und Bucbetnbandfälßbungen
und cDet?fäl{ebungen
oon
6. A. 6. ßogcng
ii.
I jer Begriff der Buch- und Bucheinbandfälschung ist
für einen bibliographischen Standpunkt subjektiv und
deckt sich nicht ohne weiteres mit den juristischen
Kriterien einer Fälschung. Denn ob ein Betrüger mit
oder ohne Erfolg seine „Fälschungen“ an den Mann
bringt, ist eine Angelegenheit des rechtswirtschaftlichen
Verkehrs, der Bibliograph hat es bloß mit dem „falschen“
Buche oder Bucheinbände, mit der falschen Handschrift
selbst zu tun. Freilich wird auch er dabei gelegentlich
auf den gesetzlichen und rechtswissenschaftlichen Fäl-
schungsbegriff zurückkommen. Bisweilen erscheinen ihm
dann Dinge als Fälschungen, deren Urheber nicht dolos
waren. Dafür ist das Beispiel
der Klemm sehen Samm-
lungen bezeichnend — es ist
durchaus nicht vereinzelt —
deren Besitzer es für zulässig
hielt, nachträgliche „Ver-
besserungen“ und „Verschö-
nerungen“ seiner alten Samm-
lungsstücke vorzunehmen.
Und daher bleibt die Ab-
sonderung des „echten“ vom
„falschen“ häufig Gefühls-
sache, besonders auch des-
halb, weil das geschichtliche
Gewissen hier in verschie-
denen Zeiten verschieden
empfand, weil alte und neue
Arbeit objektiv oft garnicht
scharf genug zu trennen ist. Ein feinfühliger Buchkenner
mag schon Gewissensbisse haben, wenn er einen Ein-
band unter Benutzung der alten Einbandteile erneuern
lassen muß und trotzdem mit einer aus dem Jahre 1300
stammenden Buchhandschrift recht zufrieden sein, deren
Buchmalereien ein Jahrhundert später hinzugekommen
sind. Überlegungen, die auch den Bibliographen auf die
Einengung des Fälschungsbegriffes führen und ihn ver-
anlassen werden, als Fälschung zunächst allein das zu
bezeichnen, was ein doloser Hersteller verfertigte, um
damit zu betrügen und zu täuschen. Womit der Vor-
besitzer eines alten Stückes in guten Glauben sich selbst
betrogen und getäuscht hat, indem er es seiner Ansicht
nach verbesserte, bleibt eine von Fall zu Fall aufzulösende
bibliographische Frage, die zwar auch zwischen alt und
neu im Sinne von echt und falsch unterscheiden kann,
aber durchaus nicht stets zwischen alt und neu im Sinne
von gut und schlecht zu unterscheiden braucht. Wenn
etwa ein Wiegendruck im achtzehnten Jahrhundert neu
gebunden wurde, wird es niemandem einfallen, von einer
Fälschung zu reden. Wohl aber kann ein solcher Ein-
band zur Verfälschung geworden sein, wofern man ihn
durch eine nachträgliche neue Wappenprägung auch
noch zu einem Provenienzexemplar des achtzehnten Jahr-
hunderts stempelte, weil der Einband einer Buchbinder-
werkstatt entstammte, aus der auch die echten Provenienz-
exemplare dieser Art hervorgingen. Macht dann die
Abstammung des Bandes seinen Hauptwert aus, so ist
er eine Fälschung im juristischen Sinne, trotzdem im
bibliographischen alles bis auf das Supralibros an ihm
„echt“ ist. Ist die Absicht einer Fälschung oder Ver-
fälschung aber ursprünglich nicht vorhanden gewesen,
redet man nur von einer
Verunstaltung der Bücher und
Bucheinbände. (Die Ge-
schmack- und Kenntnislosig-
keit auch berühmter Sammler
hat, wie eben schon gesagt
wurde, häufig auch die Her-
richtung kostbarer Sammler-
stücke versucht, die als Van-
dalismus beklagenswert ist.)
War die Veränderung auf
Vortäuschung des alten, und
damit, (man muß hier schon
zur juristischen Terminologie
zurückkehren) auf die Ab-
sicht, einen unerlaubten Ver-
mögensvorteil zu erzielen,
gerichtet, so spricht man von
einer Fälschung. Aber wie ja auch ein gutgläubig ver-
ändertes altes Buch später bösgläubige Verwertung
finden könnte, so ist die bibliographische Tatsache der
stattgehabten Veränderungen in beiden Fällen die gleiche
und der Bibliograph wird deshalb immer derartige Ver-
änderungen Verfälschungen nennen wollen. Wobei frei-
lich dann immer noch jeweilig zu entscheiden sein
würde, welche Art der Veränderungen als Verfälschungen
zu betrachten sind und welche nicht. Man sieht, die
bibliographische Terminologie gestattet keine derart fest-
umrissene Bestimmung der Fälschung wie die juristische
in den Paragraphen eines Gesetzbuches.
Denkbar sind Druckstoff- (und Druckfarben-) Fäl-
schungen nach allen Herstellungsmöglichkeiten der Materie
eines Druckwerkes. Doch sagt bereits eine kurze Über-
legung, daß sie meist einem Fälscher überflüssig er-
scheinen werden und daß er sich in „dringenden Fällen“
mit Verfälschungen behilft. Altes echtes Papier sich
noch unbedruckt zu verschaffen, gehört immerhin zu den
Möglichkeiten, auf die sich ein Fälscher versteht, der
Pieter Brueghel d. Ä.
Auktion bei Ant. Creutzer, vorm. M. Lempertz, Aachen
317
und cDet?fäl{ebungen
oon
6. A. 6. ßogcng
ii.
I jer Begriff der Buch- und Bucheinbandfälschung ist
für einen bibliographischen Standpunkt subjektiv und
deckt sich nicht ohne weiteres mit den juristischen
Kriterien einer Fälschung. Denn ob ein Betrüger mit
oder ohne Erfolg seine „Fälschungen“ an den Mann
bringt, ist eine Angelegenheit des rechtswirtschaftlichen
Verkehrs, der Bibliograph hat es bloß mit dem „falschen“
Buche oder Bucheinbände, mit der falschen Handschrift
selbst zu tun. Freilich wird auch er dabei gelegentlich
auf den gesetzlichen und rechtswissenschaftlichen Fäl-
schungsbegriff zurückkommen. Bisweilen erscheinen ihm
dann Dinge als Fälschungen, deren Urheber nicht dolos
waren. Dafür ist das Beispiel
der Klemm sehen Samm-
lungen bezeichnend — es ist
durchaus nicht vereinzelt —
deren Besitzer es für zulässig
hielt, nachträgliche „Ver-
besserungen“ und „Verschö-
nerungen“ seiner alten Samm-
lungsstücke vorzunehmen.
Und daher bleibt die Ab-
sonderung des „echten“ vom
„falschen“ häufig Gefühls-
sache, besonders auch des-
halb, weil das geschichtliche
Gewissen hier in verschie-
denen Zeiten verschieden
empfand, weil alte und neue
Arbeit objektiv oft garnicht
scharf genug zu trennen ist. Ein feinfühliger Buchkenner
mag schon Gewissensbisse haben, wenn er einen Ein-
band unter Benutzung der alten Einbandteile erneuern
lassen muß und trotzdem mit einer aus dem Jahre 1300
stammenden Buchhandschrift recht zufrieden sein, deren
Buchmalereien ein Jahrhundert später hinzugekommen
sind. Überlegungen, die auch den Bibliographen auf die
Einengung des Fälschungsbegriffes führen und ihn ver-
anlassen werden, als Fälschung zunächst allein das zu
bezeichnen, was ein doloser Hersteller verfertigte, um
damit zu betrügen und zu täuschen. Womit der Vor-
besitzer eines alten Stückes in guten Glauben sich selbst
betrogen und getäuscht hat, indem er es seiner Ansicht
nach verbesserte, bleibt eine von Fall zu Fall aufzulösende
bibliographische Frage, die zwar auch zwischen alt und
neu im Sinne von echt und falsch unterscheiden kann,
aber durchaus nicht stets zwischen alt und neu im Sinne
von gut und schlecht zu unterscheiden braucht. Wenn
etwa ein Wiegendruck im achtzehnten Jahrhundert neu
gebunden wurde, wird es niemandem einfallen, von einer
Fälschung zu reden. Wohl aber kann ein solcher Ein-
band zur Verfälschung geworden sein, wofern man ihn
durch eine nachträgliche neue Wappenprägung auch
noch zu einem Provenienzexemplar des achtzehnten Jahr-
hunderts stempelte, weil der Einband einer Buchbinder-
werkstatt entstammte, aus der auch die echten Provenienz-
exemplare dieser Art hervorgingen. Macht dann die
Abstammung des Bandes seinen Hauptwert aus, so ist
er eine Fälschung im juristischen Sinne, trotzdem im
bibliographischen alles bis auf das Supralibros an ihm
„echt“ ist. Ist die Absicht einer Fälschung oder Ver-
fälschung aber ursprünglich nicht vorhanden gewesen,
redet man nur von einer
Verunstaltung der Bücher und
Bucheinbände. (Die Ge-
schmack- und Kenntnislosig-
keit auch berühmter Sammler
hat, wie eben schon gesagt
wurde, häufig auch die Her-
richtung kostbarer Sammler-
stücke versucht, die als Van-
dalismus beklagenswert ist.)
War die Veränderung auf
Vortäuschung des alten, und
damit, (man muß hier schon
zur juristischen Terminologie
zurückkehren) auf die Ab-
sicht, einen unerlaubten Ver-
mögensvorteil zu erzielen,
gerichtet, so spricht man von
einer Fälschung. Aber wie ja auch ein gutgläubig ver-
ändertes altes Buch später bösgläubige Verwertung
finden könnte, so ist die bibliographische Tatsache der
stattgehabten Veränderungen in beiden Fällen die gleiche
und der Bibliograph wird deshalb immer derartige Ver-
änderungen Verfälschungen nennen wollen. Wobei frei-
lich dann immer noch jeweilig zu entscheiden sein
würde, welche Art der Veränderungen als Verfälschungen
zu betrachten sind und welche nicht. Man sieht, die
bibliographische Terminologie gestattet keine derart fest-
umrissene Bestimmung der Fälschung wie die juristische
in den Paragraphen eines Gesetzbuches.
Denkbar sind Druckstoff- (und Druckfarben-) Fäl-
schungen nach allen Herstellungsmöglichkeiten der Materie
eines Druckwerkes. Doch sagt bereits eine kurze Über-
legung, daß sie meist einem Fälscher überflüssig er-
scheinen werden und daß er sich in „dringenden Fällen“
mit Verfälschungen behilft. Altes echtes Papier sich
noch unbedruckt zu verschaffen, gehört immerhin zu den
Möglichkeiten, auf die sich ein Fälscher versteht, der
Pieter Brueghel d. Ä.
Auktion bei Ant. Creutzer, vorm. M. Lempertz, Aachen
317