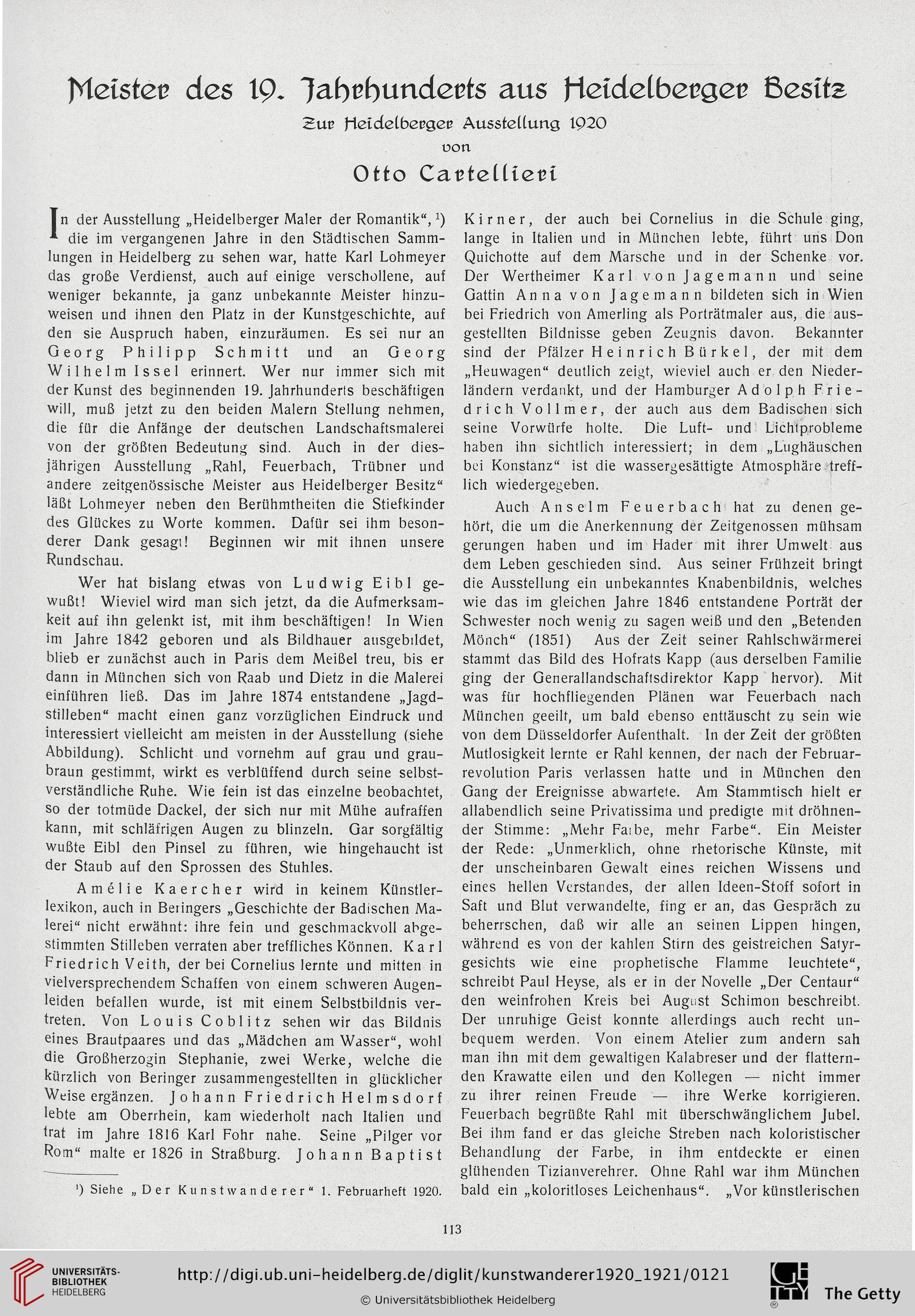Jvtetstet? des 19. 7abt?btmdet?ts aus fieidelbztQev Besite
Hut? jicidelbettgep Ausstellung 1920
oori
Otto Cavtelltevi
ln der Ausstellung „Heidelberger Maler der Romantik“,1)
* die im vergangenen Jahre in den Städtischen Samm-
lungen in Heidelberg zu sehen war, hatte Karl Lohmeyer
das große Verdienst, auch auf einige verschollene, auf
weniger bekannte, ja ganz unbekannte Meister hinzu-
weisen und ihnen den Platz in der Kunstgeschichte, auf
den sie Auspruch haben, einzuräumen. Es sei nur an
Georg Philipp Schmitt und an Georg
Wilhelm Issel erinnert. Wer nur immer sich mit
der Kunst des beginnenden 19. Jahrhunderts beschäftigen
will, muß jetzt zu den beiden Malern Stellung nehmen,
die für die Anfänge der deutschen Landschaftsmalerei
von der größten Bedeutung sind. Auch in der dies-
jährigen Ausstellung „Rah!, Feuerbach, Trübner und
andere zeitgenössische Meister aus Heidelberger Besitz“
läßt Lohmeyer neben den Berühmtheiten die Stiefkinder
des Glückes zu Worte kommen. Dafür sei ihm beson-
derer Dank gesagt! Beginnen wir mit ihnen unsere
Rundschau.
Wer hat bislang etwas von Ludwig Eibl ge-
wußt! Wieviel wird man sich jetzt, da die Aufmerksam-
keit auf ihn gelenkt ist, mit ihm beschäftigen! In Wien
im Jahre 1842 geboren und als Bildhauer ausgebildet,
blieb er zunächst auch in Paris dem Meißel treu, bis er
dann in München sich von Raab und Dietz in die Malerei
einführen ließ. Das im Jahre 1874 entstandene „Jagd-
stilleben“ macht einen ganz vorzüglichen Eindruck und
interessiert vielleicht am meisten in der Ausstellung (siehe
Abbildung). Schlicht und vornehm auf grau und grau-
braun gestimmt, wirkt es verblüffend durch seine selbst-
verständliche Ruhe. Wie fein ist das einzelne beobachtet,
so der totmüde Dackel, der sich nur mit Mühe aufraffen
kann, mit schläfrigen Augen zu blinzeln. Gar sorgfältig
wußte Eibl den Pinsel zu führen, wie hingehaucht ist
der Staub auf den Sprossen des Stuhles.
Amalie Kaercher wird in keinem Künstler-
lexikon, auch in Beringers „Geschichte der Badischen Ma-
lerei“ nicht erwähnt: ihre fein und geschmackvoll abge-
stimmten Stilleben verraten aber treffliches Können. Karl
Friedrich Veith, der bei Cornelius lernte und mitten in
vielversprechendem Schaffen von einem schweren Augen-
leiden befallen wurde, ist mit einem Selbstbildnis ver-
treten. Von Louis Coblitz sehen wir das Bildnis
eines Brautpaares und das „Mädchen am Wasser“, wohl
die Großherzogin Stephanie, zwei Werke, welche die
kürzlich von Beringer zusammengestellten in glücklicher
Weise ergänzen. Johann Friedrich Helmsdorf
•ebte am Oberrhein, kam wiederholt nach Italien und
trat im Jahre 1816 Karl Fohr nahe. Seine „Pilger vor
Rom“ malte er 1826 in Straßburg. Johann Baptist
') Siehe „Der Kunstwanderer“ 1. Februarheft 1920.
Kirner, der auch bei Cornelius in die Schule ging,
lange in Italien und in München lebte, führt uns Don
Quichotte auf dem Marsche und in der Schenke vor.
Der Wertheimer Karl von Jagemann und seine
Gattin Anna von Jagemann bildeten sich in Wien
bei Friedrich von Amerling als Porträtmaler aus, die aus-
gestellten Bildnisse geben Zeugnis davon. Bekannter
sind der Pfälzer Heinrich Bürkel, der mit dem
„Heuwagen“ deutlich zeigt, wieviel auch er den Nieder-
ländern verdankt, und der Hamburger Adolph Frie-
drich Vollmer, der auch aus dem Badischen sich
seine Vorwürfe holte. Die Luft- und Lichtprobleme
haben ihn sichtlich interessiert; in dem „Lughäuschen
bei Konstanz“ ist die wassergesättigte Atmosphäre treff-
lich wiedergegeben.
Auch Anselm Feuerbach hat zu denen ge-
hört, die um die Anerkennung der Zeitgenossen mühsam
gerungen haben und im Hader mit ihrer Umwelt aus
dem Leben geschieden sind. Aus seiner Frühzeit bringt
die Ausstellung ein unbekanntes Knabenbildnis, welches
wie das im gleichen Jahre 1846 entstandene Porträt der
Schwester noch wenig zu sagen weiß und den „Betenden
Mönch“ (1851) Aus der Zeit seiner Rahlschwärmerei
stammt das Bild des Hofrats Kapp (aus derselben Familie
ging der Generallandschaftsdirektor Kapp hervor). Mit
was für hochfliegenden Plänen war Feuerbach nach
München geeilt, um bald ebenso enttäuscht zu sein wie
von dem Düsseldorfer Aufenthalt. In der Zeit der größten
Mutlosigkeit lernte er Rahl kennen, der nach der Februar-
revolution Paris verlassen hatte und in München den
Gang der Ereignisse abwartete. Am Stammtisch hielt er
allabendlich seine Privatissima und predigte mit dröhnen-
der Stimme: „Mehr Faibe, mehr Farbe“. Ein Meister
der Rede: „Unmerklich, ohne rhetorische Künste, mit
der unscheinbaren Gewalt eines reichen Wissens und
eines hellen Verstandes, der allen Ideen-Stoff sofort in
Saft und Blut verwandelte, fing er an, das Gespräch zu
beherrschen, daß wir alle an seinen Lippen hingen,
während es von der kahlen Stirn des geistreichen Salyr-
gesichts wie eine prophetische Flamme leuchtete“,
schreibt Paul Heyse, als er in der Novelle „Der Centaur“
den weinfrohen Kreis bei August Schimon beschreibt.
Der unruhige Geist konnte allerdings auch recht un-
bequem werden. Von einem Atelier zum andern sah
man ihn mit dem gewaltigen Kalabreser und der flattern-
den Krawatte eilen und den Kollegen — nicht immer
zu ihrer reinen Freude — ihre Werke korrigieren.
Feuerbach begrüßte Rahl mit überschwänglichem Jubel.
Bei ihm fand er das gleiche Streben nach koloristischer
Behandlung der Farbe, in ihm entdeckte er einen
glühenden Tizianverehrer. Ohne Rahl war ihm München
bald ein „koloritloses Leichenhaus“. „Vor künstlerischen
113
Hut? jicidelbettgep Ausstellung 1920
oori
Otto Cavtelltevi
ln der Ausstellung „Heidelberger Maler der Romantik“,1)
* die im vergangenen Jahre in den Städtischen Samm-
lungen in Heidelberg zu sehen war, hatte Karl Lohmeyer
das große Verdienst, auch auf einige verschollene, auf
weniger bekannte, ja ganz unbekannte Meister hinzu-
weisen und ihnen den Platz in der Kunstgeschichte, auf
den sie Auspruch haben, einzuräumen. Es sei nur an
Georg Philipp Schmitt und an Georg
Wilhelm Issel erinnert. Wer nur immer sich mit
der Kunst des beginnenden 19. Jahrhunderts beschäftigen
will, muß jetzt zu den beiden Malern Stellung nehmen,
die für die Anfänge der deutschen Landschaftsmalerei
von der größten Bedeutung sind. Auch in der dies-
jährigen Ausstellung „Rah!, Feuerbach, Trübner und
andere zeitgenössische Meister aus Heidelberger Besitz“
läßt Lohmeyer neben den Berühmtheiten die Stiefkinder
des Glückes zu Worte kommen. Dafür sei ihm beson-
derer Dank gesagt! Beginnen wir mit ihnen unsere
Rundschau.
Wer hat bislang etwas von Ludwig Eibl ge-
wußt! Wieviel wird man sich jetzt, da die Aufmerksam-
keit auf ihn gelenkt ist, mit ihm beschäftigen! In Wien
im Jahre 1842 geboren und als Bildhauer ausgebildet,
blieb er zunächst auch in Paris dem Meißel treu, bis er
dann in München sich von Raab und Dietz in die Malerei
einführen ließ. Das im Jahre 1874 entstandene „Jagd-
stilleben“ macht einen ganz vorzüglichen Eindruck und
interessiert vielleicht am meisten in der Ausstellung (siehe
Abbildung). Schlicht und vornehm auf grau und grau-
braun gestimmt, wirkt es verblüffend durch seine selbst-
verständliche Ruhe. Wie fein ist das einzelne beobachtet,
so der totmüde Dackel, der sich nur mit Mühe aufraffen
kann, mit schläfrigen Augen zu blinzeln. Gar sorgfältig
wußte Eibl den Pinsel zu führen, wie hingehaucht ist
der Staub auf den Sprossen des Stuhles.
Amalie Kaercher wird in keinem Künstler-
lexikon, auch in Beringers „Geschichte der Badischen Ma-
lerei“ nicht erwähnt: ihre fein und geschmackvoll abge-
stimmten Stilleben verraten aber treffliches Können. Karl
Friedrich Veith, der bei Cornelius lernte und mitten in
vielversprechendem Schaffen von einem schweren Augen-
leiden befallen wurde, ist mit einem Selbstbildnis ver-
treten. Von Louis Coblitz sehen wir das Bildnis
eines Brautpaares und das „Mädchen am Wasser“, wohl
die Großherzogin Stephanie, zwei Werke, welche die
kürzlich von Beringer zusammengestellten in glücklicher
Weise ergänzen. Johann Friedrich Helmsdorf
•ebte am Oberrhein, kam wiederholt nach Italien und
trat im Jahre 1816 Karl Fohr nahe. Seine „Pilger vor
Rom“ malte er 1826 in Straßburg. Johann Baptist
') Siehe „Der Kunstwanderer“ 1. Februarheft 1920.
Kirner, der auch bei Cornelius in die Schule ging,
lange in Italien und in München lebte, führt uns Don
Quichotte auf dem Marsche und in der Schenke vor.
Der Wertheimer Karl von Jagemann und seine
Gattin Anna von Jagemann bildeten sich in Wien
bei Friedrich von Amerling als Porträtmaler aus, die aus-
gestellten Bildnisse geben Zeugnis davon. Bekannter
sind der Pfälzer Heinrich Bürkel, der mit dem
„Heuwagen“ deutlich zeigt, wieviel auch er den Nieder-
ländern verdankt, und der Hamburger Adolph Frie-
drich Vollmer, der auch aus dem Badischen sich
seine Vorwürfe holte. Die Luft- und Lichtprobleme
haben ihn sichtlich interessiert; in dem „Lughäuschen
bei Konstanz“ ist die wassergesättigte Atmosphäre treff-
lich wiedergegeben.
Auch Anselm Feuerbach hat zu denen ge-
hört, die um die Anerkennung der Zeitgenossen mühsam
gerungen haben und im Hader mit ihrer Umwelt aus
dem Leben geschieden sind. Aus seiner Frühzeit bringt
die Ausstellung ein unbekanntes Knabenbildnis, welches
wie das im gleichen Jahre 1846 entstandene Porträt der
Schwester noch wenig zu sagen weiß und den „Betenden
Mönch“ (1851) Aus der Zeit seiner Rahlschwärmerei
stammt das Bild des Hofrats Kapp (aus derselben Familie
ging der Generallandschaftsdirektor Kapp hervor). Mit
was für hochfliegenden Plänen war Feuerbach nach
München geeilt, um bald ebenso enttäuscht zu sein wie
von dem Düsseldorfer Aufenthalt. In der Zeit der größten
Mutlosigkeit lernte er Rahl kennen, der nach der Februar-
revolution Paris verlassen hatte und in München den
Gang der Ereignisse abwartete. Am Stammtisch hielt er
allabendlich seine Privatissima und predigte mit dröhnen-
der Stimme: „Mehr Faibe, mehr Farbe“. Ein Meister
der Rede: „Unmerklich, ohne rhetorische Künste, mit
der unscheinbaren Gewalt eines reichen Wissens und
eines hellen Verstandes, der allen Ideen-Stoff sofort in
Saft und Blut verwandelte, fing er an, das Gespräch zu
beherrschen, daß wir alle an seinen Lippen hingen,
während es von der kahlen Stirn des geistreichen Salyr-
gesichts wie eine prophetische Flamme leuchtete“,
schreibt Paul Heyse, als er in der Novelle „Der Centaur“
den weinfrohen Kreis bei August Schimon beschreibt.
Der unruhige Geist konnte allerdings auch recht un-
bequem werden. Von einem Atelier zum andern sah
man ihn mit dem gewaltigen Kalabreser und der flattern-
den Krawatte eilen und den Kollegen — nicht immer
zu ihrer reinen Freude — ihre Werke korrigieren.
Feuerbach begrüßte Rahl mit überschwänglichem Jubel.
Bei ihm fand er das gleiche Streben nach koloristischer
Behandlung der Farbe, in ihm entdeckte er einen
glühenden Tizianverehrer. Ohne Rahl war ihm München
bald ein „koloritloses Leichenhaus“. „Vor künstlerischen
113