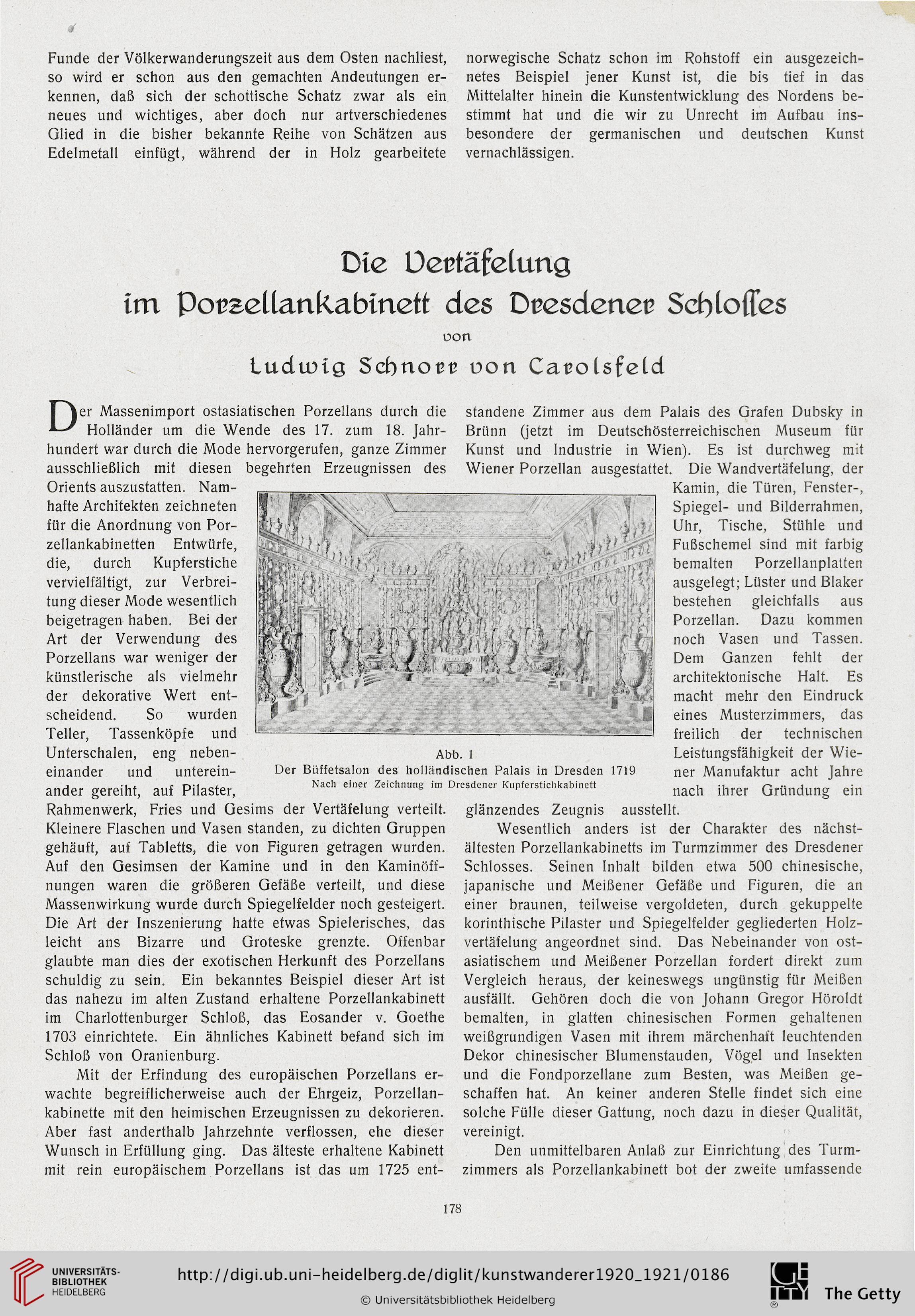Donath, Adolph [Hrsg.]
Der Kunstwanderer: Zeitschrift für alte und neue Kunst, für Kunstmarkt und Sammelwesen
— 2.1920/21
Zitieren dieser Seite
Bitte zitieren Sie diese Seite, indem Sie folgende Adresse (URL)/folgende DOI benutzen:
https://doi.org/10.11588/diglit.27814#0186
DOI Heft:
1. Januarheft
DOI Artikel:Strzygowski, Josef: Ein neuer Schatzfund der Völkerwanderungszeit
DOI Artikel:Schnorr von Carolsfeld, Ludwig: Die Vertäfelung im Porzellankabinett des Dresdener Schlosses
DOI Seite / Zitierlink:https://doi.org/10.11588/diglit.27814#0186
*
Funde der Völkerwanderungszeit aus dem Osten nachliest,
so wird er schon aus den gemachten Andeutungen er-
kennen, daß sich der schottische Schatz zwar als ein
neues und wichtiges, aber doch nur artverschiedenes
Glied in die bisher bekannte Reihe von Schätzen aus
Edelmetall einfügt, während der in Holz gearbeitete
norwegische Schatz schon im Rohstoff ein ausgezeich-
netes Beispiel jener Kunst ist, die bis tief in das
Mittelalter hinein die Kunstentwicklung des Nordens be-
stimmt hat und die wir zu Unrecht im Aufbau ins-
besondere der germanischen und deutschen Kunst
vernachlässigen.
Die Deetäfetung
im PoeEeltankabinett des Dresdener Sebtofles
oon
Ludung Scbnot’t? oon Cat?olsfeld
[|er Massenimport ostasiatischen Porzellans durch die
Holländer um die Wende des 17. zum 18. Jahr-
hundert war durch die Mode hervorgerufen, ganze Zimmer
ausschließlich mit diesen begehrten Erzeugnissen des
Orients auszustatten. Nam-
hafte Architekten zeichneten
für die Anordnung von Por-
zellankabinetten Entwürfe,
die, durch Kupferstiche
vervielfältigt, zur Verbrei-
tung dieser Mode wesentlich
beigetragen haben. Bei der
Art der Verwendung des
Porzellans war weniger der
künstlerische als vielmehr
der dekorative Wert ent-
scheidend. So wurden
Teller, Tassenköpfe und
Unterschalen, eng neben-
einander und unterein-
ander gereiht, auf Pilaster,
Rahmenwerk, Fries und Gesims der Vertäfelung verteilt.
Kleinere Flaschen und Vasen standen, zu dichten Gruppen
gehäuft, auf Tabletts, die von Figuren getragen wurden.
Auf den Gesimsen der Kamine und in den Kaminöff-
nungen waren die größeren Gefäße verteilt, und diese
Massenwirkung wurde durch Spiegelfelder noch gesteigert.
Die Art der Inszenierung hatte etwas Spielerisches, das
leicht ans Bizarre und Groteske grenzte. Offenbar
glaubte man dies der exotischen Herkunft des Porzellans
schuldig zu sein. Ein bekanntes Beispiel dieser Art ist
das nahezu im alten Zustand erhaltene Porzellankabinett
im Charlottenburger Schloß, das Eosander v. Goethe
1703 einrichtete. Ein ähnliches Kabinett befand sich im
Schloß von Oranienburg.
Mit der Erfindung des europäischen Porzellans er-
wachte begreiflicherweise auch der Ehrgeiz, Porzellan-
kabinette mit den heimischen Erzeugnissen zu dekorieren.
Aber fast anderthalb Jahrzehnte verflossen, ehe dieser
Wunsch in Erfüllung ging. Das älteste erhaltene Kabinett
mit rein europäischem Porzellans ist das um 1725 ent-
standene Zimmer aus dem Palais des Grafen Dubsky in
Brünn (jetzt im Deutschösterreichischen Museum für
Kunst und Industrie in Wien). Es ist durchweg mit
Wiener Porzellan ausgestattet. Die Wandvertäfelung, der
Kamin, die Türen, Fenster-,
Spiegel- und Bilderrahmen,
Uhr, Tische, Stühle und
Fußschemel sind mit farbig
bemalten Porzellanplatten
ausgelegt; Lüster und Blaker
bestehen gleichfalls aus
Porzellan. Dazu kommen
noch Vasen und Tassen.
Dem Ganzen fehlt der
architektonische Halt. Es
macht mehr den Eindruck
eines Musterzimmers, das
freilich der technischen
Leistungsfähigkeit der Wie-
ner Manufaktur acht Jahre
nach ihrer Gründung ein
glänzendes Zeugnis ausstellt.
Wesentlich anders ist der Charakter des nächst-
ältesten Porzellankabinetts im Turmzimmer des Dresdener
Schlosses. Seinen Inhalt bilden etwa 500 chinesische,
japanische und Meißener Gefäße und Figuren, die an
einer braunen, teilweise vergoldeten, durch gekuppelte
korinthische Pilaster und Spiegelfelder gegliederten Holz-
vertäfelung angeordnet sind. Das Nebeinander von ost-
asiatischem und Meißener Porzellan fordert direkt zum
Vergleich heraus, der keineswegs ungünstig für Meißen
ausfällt. Gehören doch die von Johann Gregor Höroldt
bemalten, in glatten chinesischen Formen gehaltenen
weißgrundigen Vasen mit ihrem märchenhaft leuchtenden
Dekor chinesischer Blumenstauden, Vögel und Insekten
und die Fondporzellane zum Besten, was Meißen ge-
schaffen hat. An keiner anderen Stelle findet sich eine
solche Fülle dieser Gattung, noch dazu in dieser Qualität,
vereinigt.
Den unmittelbaren Anlaß zur Einrichtung des Turm-
zimmers als Porzellankabinett bot der zweite umfassende
Abb. 1
Der Büffetsalon des holländischen Palais in Dresden 1719
Nach einer Zeichnung im Dresdener Kupferstichkabinett
178
Funde der Völkerwanderungszeit aus dem Osten nachliest,
so wird er schon aus den gemachten Andeutungen er-
kennen, daß sich der schottische Schatz zwar als ein
neues und wichtiges, aber doch nur artverschiedenes
Glied in die bisher bekannte Reihe von Schätzen aus
Edelmetall einfügt, während der in Holz gearbeitete
norwegische Schatz schon im Rohstoff ein ausgezeich-
netes Beispiel jener Kunst ist, die bis tief in das
Mittelalter hinein die Kunstentwicklung des Nordens be-
stimmt hat und die wir zu Unrecht im Aufbau ins-
besondere der germanischen und deutschen Kunst
vernachlässigen.
Die Deetäfetung
im PoeEeltankabinett des Dresdener Sebtofles
oon
Ludung Scbnot’t? oon Cat?olsfeld
[|er Massenimport ostasiatischen Porzellans durch die
Holländer um die Wende des 17. zum 18. Jahr-
hundert war durch die Mode hervorgerufen, ganze Zimmer
ausschließlich mit diesen begehrten Erzeugnissen des
Orients auszustatten. Nam-
hafte Architekten zeichneten
für die Anordnung von Por-
zellankabinetten Entwürfe,
die, durch Kupferstiche
vervielfältigt, zur Verbrei-
tung dieser Mode wesentlich
beigetragen haben. Bei der
Art der Verwendung des
Porzellans war weniger der
künstlerische als vielmehr
der dekorative Wert ent-
scheidend. So wurden
Teller, Tassenköpfe und
Unterschalen, eng neben-
einander und unterein-
ander gereiht, auf Pilaster,
Rahmenwerk, Fries und Gesims der Vertäfelung verteilt.
Kleinere Flaschen und Vasen standen, zu dichten Gruppen
gehäuft, auf Tabletts, die von Figuren getragen wurden.
Auf den Gesimsen der Kamine und in den Kaminöff-
nungen waren die größeren Gefäße verteilt, und diese
Massenwirkung wurde durch Spiegelfelder noch gesteigert.
Die Art der Inszenierung hatte etwas Spielerisches, das
leicht ans Bizarre und Groteske grenzte. Offenbar
glaubte man dies der exotischen Herkunft des Porzellans
schuldig zu sein. Ein bekanntes Beispiel dieser Art ist
das nahezu im alten Zustand erhaltene Porzellankabinett
im Charlottenburger Schloß, das Eosander v. Goethe
1703 einrichtete. Ein ähnliches Kabinett befand sich im
Schloß von Oranienburg.
Mit der Erfindung des europäischen Porzellans er-
wachte begreiflicherweise auch der Ehrgeiz, Porzellan-
kabinette mit den heimischen Erzeugnissen zu dekorieren.
Aber fast anderthalb Jahrzehnte verflossen, ehe dieser
Wunsch in Erfüllung ging. Das älteste erhaltene Kabinett
mit rein europäischem Porzellans ist das um 1725 ent-
standene Zimmer aus dem Palais des Grafen Dubsky in
Brünn (jetzt im Deutschösterreichischen Museum für
Kunst und Industrie in Wien). Es ist durchweg mit
Wiener Porzellan ausgestattet. Die Wandvertäfelung, der
Kamin, die Türen, Fenster-,
Spiegel- und Bilderrahmen,
Uhr, Tische, Stühle und
Fußschemel sind mit farbig
bemalten Porzellanplatten
ausgelegt; Lüster und Blaker
bestehen gleichfalls aus
Porzellan. Dazu kommen
noch Vasen und Tassen.
Dem Ganzen fehlt der
architektonische Halt. Es
macht mehr den Eindruck
eines Musterzimmers, das
freilich der technischen
Leistungsfähigkeit der Wie-
ner Manufaktur acht Jahre
nach ihrer Gründung ein
glänzendes Zeugnis ausstellt.
Wesentlich anders ist der Charakter des nächst-
ältesten Porzellankabinetts im Turmzimmer des Dresdener
Schlosses. Seinen Inhalt bilden etwa 500 chinesische,
japanische und Meißener Gefäße und Figuren, die an
einer braunen, teilweise vergoldeten, durch gekuppelte
korinthische Pilaster und Spiegelfelder gegliederten Holz-
vertäfelung angeordnet sind. Das Nebeinander von ost-
asiatischem und Meißener Porzellan fordert direkt zum
Vergleich heraus, der keineswegs ungünstig für Meißen
ausfällt. Gehören doch die von Johann Gregor Höroldt
bemalten, in glatten chinesischen Formen gehaltenen
weißgrundigen Vasen mit ihrem märchenhaft leuchtenden
Dekor chinesischer Blumenstauden, Vögel und Insekten
und die Fondporzellane zum Besten, was Meißen ge-
schaffen hat. An keiner anderen Stelle findet sich eine
solche Fülle dieser Gattung, noch dazu in dieser Qualität,
vereinigt.
Den unmittelbaren Anlaß zur Einrichtung des Turm-
zimmers als Porzellankabinett bot der zweite umfassende
Abb. 1
Der Büffetsalon des holländischen Palais in Dresden 1719
Nach einer Zeichnung im Dresdener Kupferstichkabinett
178