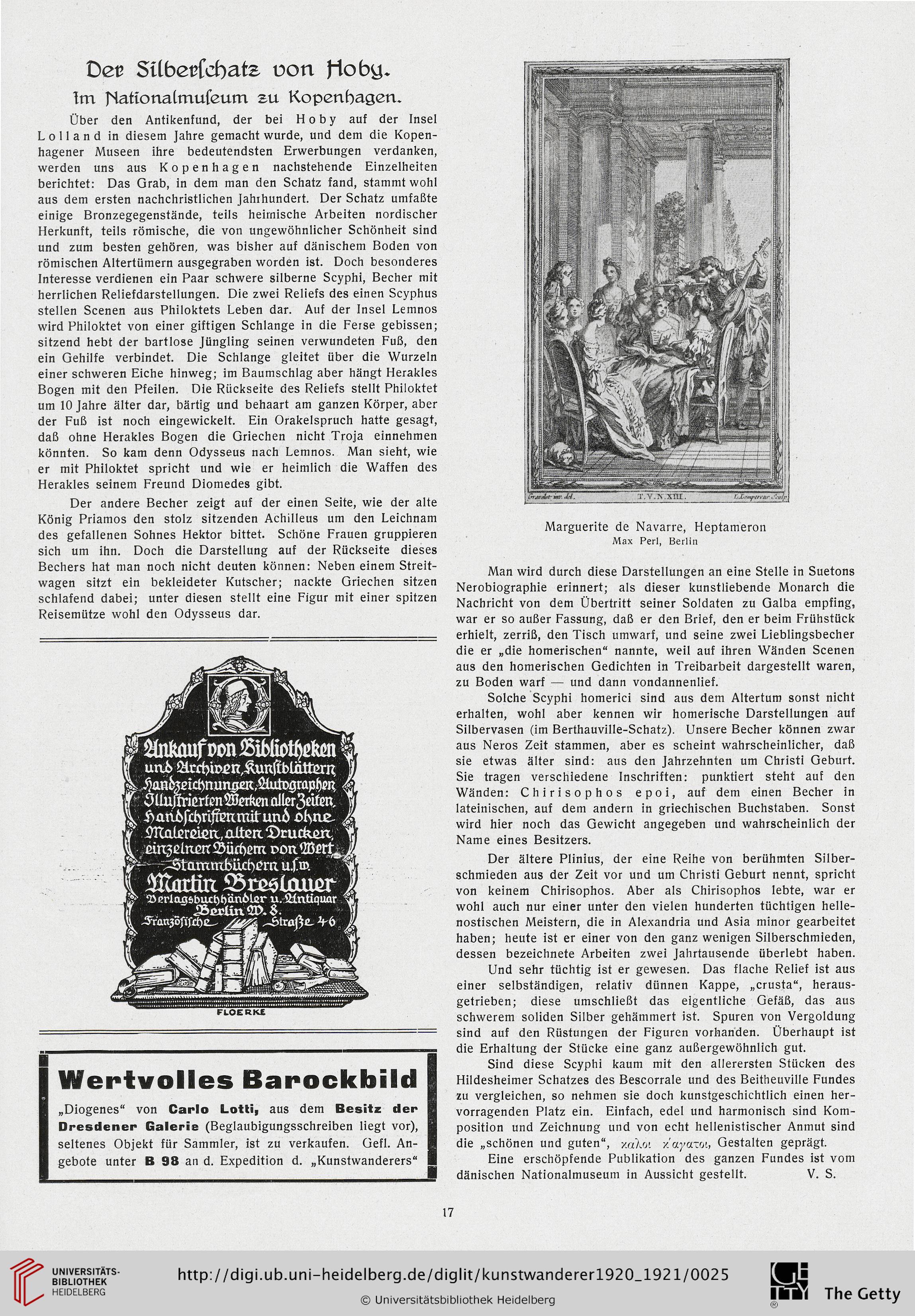Donath, Adolph [Hrsg.]
Der Kunstwanderer: Zeitschrift für alte und neue Kunst, für Kunstmarkt und Sammelwesen
— 2.1920/21
Zitieren dieser Seite
Bitte zitieren Sie diese Seite, indem Sie folgende Adresse (URL)/folgende DOI benutzen:
https://doi.org/10.11588/diglit.27814#0025
DOI Heft:
1. Septemberheft
DOI Artikel:Aus der Museums- und Sammlerwelt / Kunstausstellungen / Wettbewerb / Kunstauktionen / Aus dem Pariser Kunstleben / Schweizerische Kunstchronik / Londoner Kunstschau / Der Silberschatz von Hoby / Die Kunstbewegung in Bulgarien / Rudolf Mosse als Kunstsammler / Frankfurter Kunstmesse
DOI Seite / Zitierlink:https://doi.org/10.11588/diglit.27814#0025
Det? Sltbeüfcbats oon jioby.
Im Hationalmufeum zu Kopenhagen.
Über den Antikenfund, der bei Hoby auf der Insel
Lolland in diesem Jahre gemacht wurde, und dem die Kopen-
hagener Museen ihre bedeutendsten Erwerbungen verdanken,
werden uns aus Kopenhagen nachstehende Einzelheiten
berichtet: Das Grab, in dem man den Schatz fand, stammt wohl
aus dem ersten nachchristlichen Jahrhundert. Der Schatz umfaßte
einige Bronzegegenstände, teils heimische Arbeiten nordischer
Herkunft, teils römische, die von ungewöhnlicher Schönheit sind
und zum besten gehören, was bisher auf dänischem Boden von
römischen Altertümern ausgegraben worden ist. Doch besonderes
Interesse verdienen ein Paar schwere silberne Scyphl, Becher mit
herrlichen Reliefdarstellungen. Die zwei Reliefs des einen Scyphus
stellen Scenen aus Philoktets Leben dar. Auf der Insel Lemnos
wird Philoktet von einer giftigen Schlange in die Ferse gebissen;
sitzend hebt der bartlose Jüngling seinen verwundeten Fuß, den
ein Gehilfe verbindet. Die Schlange gleitet über die Wurzeln
einer schweren Eiche hinweg; im Baumschlag aber hängt Herakles
Bogen mit den Pfeilen. Die Rückseite des Reliefs stellt Philoktet
um 10 Jahre älter dar, bärtig und behaart am ganzen Körper, aber
der Fuß ist noch eingewickelt. Ein Orakelspruch hatte gesagt,
daß ohne Herakles Bogen die Griechen nicht Troja einnehmen
könnten. So kam denn Odysseus nach Lemnos. Man sieht, wie
er mit Philoktet spricht und wie er heimlich die Waffen des
Herakles seinem Freund Diomedes gibt.
Der andere Becher zeigt auf der einen Seite, wie der alte
König Priamos den stolz sitzenden Achilleus um den Leichnam
des gefallenen Sohnes Hektor bittet. Schöne Frauen gruppieren
sich um ihn. Doch die Darstellung auf der Rückseite dieses
Bechers hat man noch nicht deuten können: Neben einem Streit-
wagen sitzt ein bekleideter Kutscher; nackte Griechen sitzen
schlafend dabei; unter diesen stellt eine Figur mit einer spitzen
Reisemütze wohl den Odysseus dar.
Wertvolles Barockbild
„Diogenes“ von Carlo Lotti, aus dem Besitz der
Dresdener Galerie (Beglaubigungsschreiben liegt vor),
seltenes Objekt für Sammler, ist zu verkaufen. Gefl. An-
gebote unter B 98 an d. Expedition d. „Kunstwanderers“
Marguerite de Navarre, Heptameron
Max Perl, Berlin
Man wird durch diese Darstellungen an eine Stelle in Suetons
Nerobiographie erinnert; als dieser kunstliebende Monarch die
Nachricht von dem Übertritt seiner Soldaten zu Galba empfing,
war er so außer Fassung, daß er den Brief, den er beim Frühstück
erhielt, zerriß, den Tisch umwarf, und seine zwei Lieblingsbecher
die er „die homerischen“ nannte, weil auf ihren Wänden Scenen
aus den homerischen Gedichten in Treibarbeit dargestellt waren,
zu Boden warf — und dann vondannenlief.
Solche Scyphi homerici sind aus dem Altertum sonst nicht
erhalten, wohl aber kennen wir homerische Darstellungen auf
Silbervasen (im Berthauville-Schatz). Unsere Becher können zwar
aus Neros Zeit stammen, aber es scheint wahrscheinlicher, daß
sie etwas älter sind: aus den Jahrzehnten um Christi Geburt.
Sie tragen verschiedene Inschriften: punktiert steht auf den
Wänden: Chirisophos epoi, auf dem einen Becher in
lateinischen, auf dem andern in griechischen Buchstaben. Sonst
wird hier noch das Gewicht angegeben und wahrscheinlich der
Name eines Besitzers.
Der ältere Plinius, der eine Reihe von berühmten Silber-
schmieden aus der Zeit vor und um Christi Geburt nennt, spricht
von keinem Chirisophos. Aber als Chirisophos lebte, war er
wohl auch nur einer unter den vielen hunderten tüchtigen helle-
nostischen Meistern, die in Alexandria und Asia minor gearbeitet
haben; heute ist er einer von den ganz wenigen Silberschmieden,
dessen bezeichnete Arbeiten zwei Jahrtausende überlebt haben.
Und sehr tüchtig ist er gewesen. Das flache Relief ist aus
einer selbständigen, relativ dünnen Kappe, „crusta“, heraus-
getrieben; diese umschließt das eigentliche Gefäß, das aus
schwerem soliden Silber gehämmert ist. Spuren von Vergoldung
sind auf den Rüstungen der Figuren vorhanden. Überhaupt ist
die Erhaltung der Stücke eine ganz außergewöhnlich gut.
Sind diese Scyphi kaum mit den allerersten Stücken des
Hildesheimer Schatzes des Bescorrale und des Beitheuville Fundes
zu vergleichen, so nehmen sie doch kunstgeschichtlich einen her-
vorragenden Platz ein. Einfach, edel und harmonisch sind Kom-
position und Zeichnung und von echt hellenistischer Anmut sind
die „schönen und guten“, xaXoi y'ayaxoi, Gestalten geprägt.
Eine erschöpfende Publikation des ganzen Fundes ist vom
dänischen Nationalmuseum in Aussicht gestellt. V. S.
17
Im Hationalmufeum zu Kopenhagen.
Über den Antikenfund, der bei Hoby auf der Insel
Lolland in diesem Jahre gemacht wurde, und dem die Kopen-
hagener Museen ihre bedeutendsten Erwerbungen verdanken,
werden uns aus Kopenhagen nachstehende Einzelheiten
berichtet: Das Grab, in dem man den Schatz fand, stammt wohl
aus dem ersten nachchristlichen Jahrhundert. Der Schatz umfaßte
einige Bronzegegenstände, teils heimische Arbeiten nordischer
Herkunft, teils römische, die von ungewöhnlicher Schönheit sind
und zum besten gehören, was bisher auf dänischem Boden von
römischen Altertümern ausgegraben worden ist. Doch besonderes
Interesse verdienen ein Paar schwere silberne Scyphl, Becher mit
herrlichen Reliefdarstellungen. Die zwei Reliefs des einen Scyphus
stellen Scenen aus Philoktets Leben dar. Auf der Insel Lemnos
wird Philoktet von einer giftigen Schlange in die Ferse gebissen;
sitzend hebt der bartlose Jüngling seinen verwundeten Fuß, den
ein Gehilfe verbindet. Die Schlange gleitet über die Wurzeln
einer schweren Eiche hinweg; im Baumschlag aber hängt Herakles
Bogen mit den Pfeilen. Die Rückseite des Reliefs stellt Philoktet
um 10 Jahre älter dar, bärtig und behaart am ganzen Körper, aber
der Fuß ist noch eingewickelt. Ein Orakelspruch hatte gesagt,
daß ohne Herakles Bogen die Griechen nicht Troja einnehmen
könnten. So kam denn Odysseus nach Lemnos. Man sieht, wie
er mit Philoktet spricht und wie er heimlich die Waffen des
Herakles seinem Freund Diomedes gibt.
Der andere Becher zeigt auf der einen Seite, wie der alte
König Priamos den stolz sitzenden Achilleus um den Leichnam
des gefallenen Sohnes Hektor bittet. Schöne Frauen gruppieren
sich um ihn. Doch die Darstellung auf der Rückseite dieses
Bechers hat man noch nicht deuten können: Neben einem Streit-
wagen sitzt ein bekleideter Kutscher; nackte Griechen sitzen
schlafend dabei; unter diesen stellt eine Figur mit einer spitzen
Reisemütze wohl den Odysseus dar.
Wertvolles Barockbild
„Diogenes“ von Carlo Lotti, aus dem Besitz der
Dresdener Galerie (Beglaubigungsschreiben liegt vor),
seltenes Objekt für Sammler, ist zu verkaufen. Gefl. An-
gebote unter B 98 an d. Expedition d. „Kunstwanderers“
Marguerite de Navarre, Heptameron
Max Perl, Berlin
Man wird durch diese Darstellungen an eine Stelle in Suetons
Nerobiographie erinnert; als dieser kunstliebende Monarch die
Nachricht von dem Übertritt seiner Soldaten zu Galba empfing,
war er so außer Fassung, daß er den Brief, den er beim Frühstück
erhielt, zerriß, den Tisch umwarf, und seine zwei Lieblingsbecher
die er „die homerischen“ nannte, weil auf ihren Wänden Scenen
aus den homerischen Gedichten in Treibarbeit dargestellt waren,
zu Boden warf — und dann vondannenlief.
Solche Scyphi homerici sind aus dem Altertum sonst nicht
erhalten, wohl aber kennen wir homerische Darstellungen auf
Silbervasen (im Berthauville-Schatz). Unsere Becher können zwar
aus Neros Zeit stammen, aber es scheint wahrscheinlicher, daß
sie etwas älter sind: aus den Jahrzehnten um Christi Geburt.
Sie tragen verschiedene Inschriften: punktiert steht auf den
Wänden: Chirisophos epoi, auf dem einen Becher in
lateinischen, auf dem andern in griechischen Buchstaben. Sonst
wird hier noch das Gewicht angegeben und wahrscheinlich der
Name eines Besitzers.
Der ältere Plinius, der eine Reihe von berühmten Silber-
schmieden aus der Zeit vor und um Christi Geburt nennt, spricht
von keinem Chirisophos. Aber als Chirisophos lebte, war er
wohl auch nur einer unter den vielen hunderten tüchtigen helle-
nostischen Meistern, die in Alexandria und Asia minor gearbeitet
haben; heute ist er einer von den ganz wenigen Silberschmieden,
dessen bezeichnete Arbeiten zwei Jahrtausende überlebt haben.
Und sehr tüchtig ist er gewesen. Das flache Relief ist aus
einer selbständigen, relativ dünnen Kappe, „crusta“, heraus-
getrieben; diese umschließt das eigentliche Gefäß, das aus
schwerem soliden Silber gehämmert ist. Spuren von Vergoldung
sind auf den Rüstungen der Figuren vorhanden. Überhaupt ist
die Erhaltung der Stücke eine ganz außergewöhnlich gut.
Sind diese Scyphi kaum mit den allerersten Stücken des
Hildesheimer Schatzes des Bescorrale und des Beitheuville Fundes
zu vergleichen, so nehmen sie doch kunstgeschichtlich einen her-
vorragenden Platz ein. Einfach, edel und harmonisch sind Kom-
position und Zeichnung und von echt hellenistischer Anmut sind
die „schönen und guten“, xaXoi y'ayaxoi, Gestalten geprägt.
Eine erschöpfende Publikation des ganzen Fundes ist vom
dänischen Nationalmuseum in Aussicht gestellt. V. S.
17