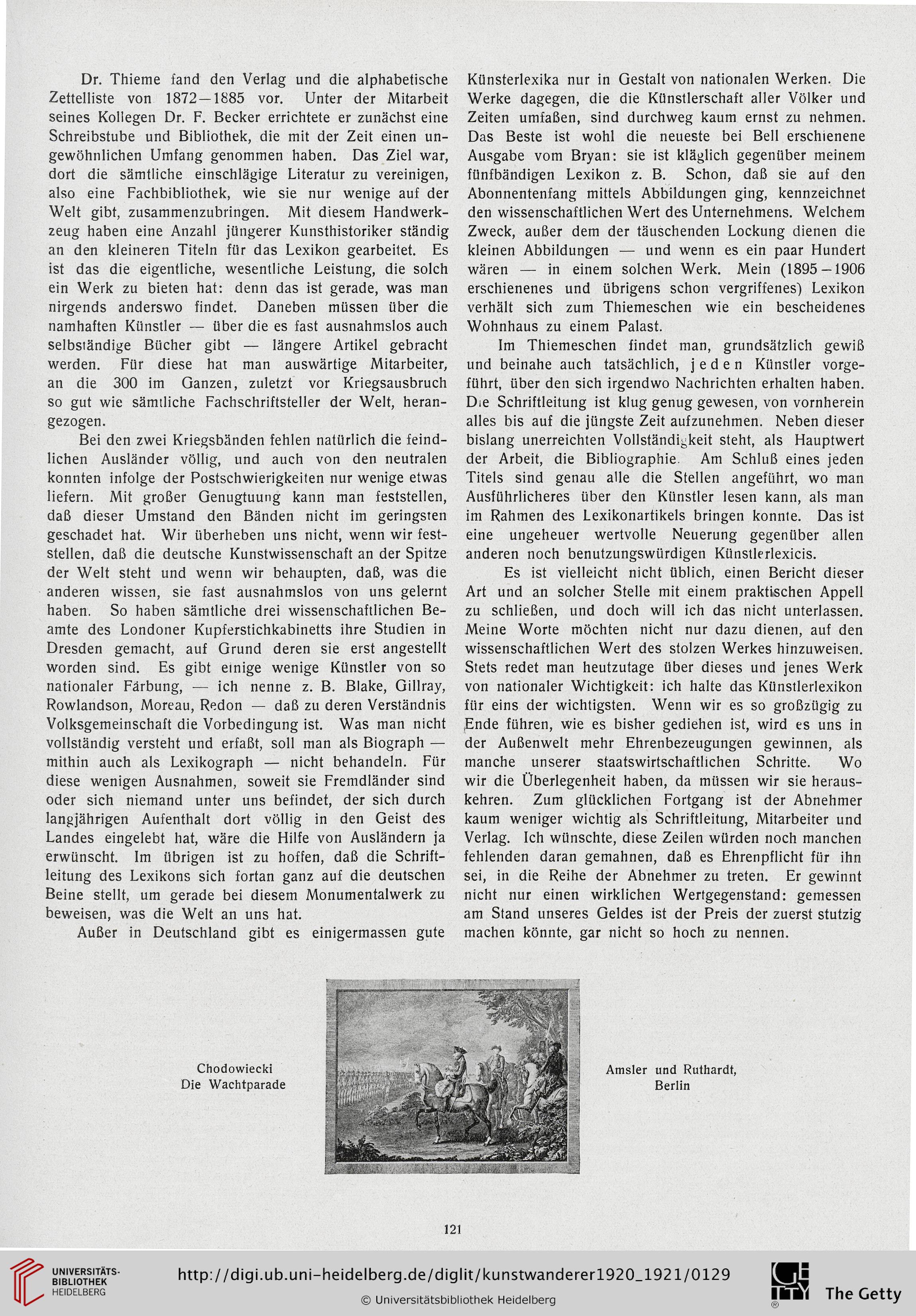Dr. Thieme fand den Verlag und die alphabetische
Zettelliste von 1872 — 1885 vor. Unter der Mitarbeit
seines Kollegen Dr. F. Becker errichtete er zunächst eine
Schreibstube und Bibliothek, die mit der Zeit einen un-
gewöhnlichen Umfang genommen haben. Das Ziel war,
dort die sämtliche einschlägige Literatur zu vereinigen,
also eine Fachbibliothek, wie sie nur wenige auf der
Welt gibt, zusammenzubringen. Mit diesem Handwerk-
zeug haben eine Anzahl jüngerer Kunsthistoriker ständig
an den kleineren Titeln für das Lexikon gearbeitet. Es
ist das die eigentliche, wesentliche Leistung, die solch
ein Werk zu bieten hat: denn das ist gerade, was man
nirgends anderswo findet. Daneben müssen über die
namhaften Künstler — über die es fast ausnahmslos auch
selbsiändige Bücher gibt — längere Artikel gebracht
werden. Für diese hat man auswärtige Mitarbeiter,
an die 300 im Ganzen, zuletzt vor Kriegsausbruch
so gut wie sämtliche Fachschriftsteller der Welt, heran-
gezogen.
Bei den zwei Kriegsbänden fehlen natürlich die feind-
lichen Ausländer völlig, und auch von den neutralen
konnten infolge der Postschwierigkeiten nur wenige etwas
liefern. Mit großer Genugtuung kann man feststellen,
daß dieser Umstand den Bänden nicht im geringsten
geschadet hat. Wir überheben uns nicht, wenn wir fest-
stellen, daß die deutsche Kunstwissenschaft an der Spitze
der Welt steht und wenn wir behaupten, daß, was die
anderen wissen, sie fast ausnahmslos von uns gelernt
haben. So haben sämtliche drei wissenschaftlichen Be-
amte des Londoner Kupferstichkabinetts ihre Studien in
Dresden gemacht, auf Grund deren sie erst angestellt
worden sind. Es gibt einige wenige Künstler von so
nationaler Färbung, — ich nenne z. B. Blake, Gillray,
Rowlandson, Moreau, Redon — daß zu deren Verständnis
Volksgemeinschaft die Vorbedingung ist. Was man nicht
vollständig versteht und erfaßt, soll man als Biograph —
mithin auch als Lexikograph — nicht behandeln. Für
diese wenigen Ausnahmen, soweit sie Fremdländer sind
oder sich niemand unter uns befindet, der sich durch
langjährigen Aufenthalt dort völlig in den Geist des
Landes eingelebt hat, wäre die Hilfe von Ausländern ja
erwünscht. Im übrigen ist zu hoffen, daß die Schrift-
leitung des Lexikons sich fortan ganz auf die deutschen
Beine stellt, um gerade bei diesem Monumentalwerk zu
beweisen, was die Welt an uns hat.
Außer in Deutschland gibt es einigermassen gute
Künsterlexika nur in Gestalt von nationalen Werken. Die
Werke dagegen, die die Künstlerschaft aller Völker und
Zeiten umfaßen, sind durchweg kaum ernst zu nehmen.
Das Beste ist wohl die neueste bei Bell erschienene
Ausgabe vom Bryan: sie ist kläglich gegenüber meinem
fünfbändigen Lexikon z. B. Schon, daß sie auf den
Abonnentenfang mittels Abbildungen ging, kennzeichnet
den wissenschaftlichen Wert des Unternehmens. Welchem
Zweck, außer dem der täuschenden Lockung dienen die
kleinen Abbildungen •— und wenn es ein paar Hundert
wären — in einem solchen Werk. Mein (1895 — 1906
erschienenes und übrigens schon vergriffenes) Lexikon
verhält sich zum Thiemeschen wie ein bescheidenes
Wohnhaus zu einem Palast.
Im Thiemeschen findet man, grundsätzlich gewiß
und beinahe auch tatsächlich, jeden Künstler vorge-
führt, über den sich irgendwo Nachrichten erhalten haben.
Die Schriftleitung ist klug genug gewesen, von vornherein
alles bis auf die jüngste Zeit aufzunehmen. Neben dieser
bislang unerreichten Vollständigkeit steht, als Hauptwert
der Arbeit, die Bibliographie. Am Schluß eines jeden
Titels sind genau alle die Stellen angeführt, wo man
Ausführlicheres über den Künstler lesen kann, als man
im Rahmen des Lexikonartikels bringen konnie. Das ist
eine ungeheuer wertvolle Neuerung gegenüber allen
anderen noch benutzungswürdigen Künstlerlexicis.
Es ist vielleicht nicht üblich, einen Bericht dieser
Art und an solcher Stelle mit einem praktischen Appell
zu schließen, und doch will ich das nicht unterlassen.
Meine Worte möchten nicht nur dazu dienen, auf den
wissenschaftlichen Wert des stolzen Werkes hinzuweisen.
Stets redet man heutzutage über dieses und jenes Werk
von nationaler Wichtigkeit: ich halte das Künstlerlexikon
für eins der wichtigsten. Wenn wir es so großzügig zu
Ende führen, wie es bisher gediehen ist, wird es uns in
der Außenwelt mehr Ehrenbezeugungen gewinnen, als
manche unserer staatswirtschaftlichen Schritte. Wo
wir die Überlegenheit haben, da müssen wir sie heraus-
kehren. Zum glücklichen Fortgang ist der Abnehmer
kaum weniger wichtig als Schriftleitung, Mitarbeiter und
Verlag. Ich wünschte, diese Zeilen würden noch manchen
fehlenden daran gemahnen, daß es Ehrenpflicht für ihn
sei, in die Reihe der Abnehmer zu treten. Er gewinnt
nicht nur einen wirklichen Wertgegenstand: gemessen
am Stand unseres Geldes ist der Preis der zuerst stutzig
machen könnte, gar nicht so hoch zu nennen.
121
Zettelliste von 1872 — 1885 vor. Unter der Mitarbeit
seines Kollegen Dr. F. Becker errichtete er zunächst eine
Schreibstube und Bibliothek, die mit der Zeit einen un-
gewöhnlichen Umfang genommen haben. Das Ziel war,
dort die sämtliche einschlägige Literatur zu vereinigen,
also eine Fachbibliothek, wie sie nur wenige auf der
Welt gibt, zusammenzubringen. Mit diesem Handwerk-
zeug haben eine Anzahl jüngerer Kunsthistoriker ständig
an den kleineren Titeln für das Lexikon gearbeitet. Es
ist das die eigentliche, wesentliche Leistung, die solch
ein Werk zu bieten hat: denn das ist gerade, was man
nirgends anderswo findet. Daneben müssen über die
namhaften Künstler — über die es fast ausnahmslos auch
selbsiändige Bücher gibt — längere Artikel gebracht
werden. Für diese hat man auswärtige Mitarbeiter,
an die 300 im Ganzen, zuletzt vor Kriegsausbruch
so gut wie sämtliche Fachschriftsteller der Welt, heran-
gezogen.
Bei den zwei Kriegsbänden fehlen natürlich die feind-
lichen Ausländer völlig, und auch von den neutralen
konnten infolge der Postschwierigkeiten nur wenige etwas
liefern. Mit großer Genugtuung kann man feststellen,
daß dieser Umstand den Bänden nicht im geringsten
geschadet hat. Wir überheben uns nicht, wenn wir fest-
stellen, daß die deutsche Kunstwissenschaft an der Spitze
der Welt steht und wenn wir behaupten, daß, was die
anderen wissen, sie fast ausnahmslos von uns gelernt
haben. So haben sämtliche drei wissenschaftlichen Be-
amte des Londoner Kupferstichkabinetts ihre Studien in
Dresden gemacht, auf Grund deren sie erst angestellt
worden sind. Es gibt einige wenige Künstler von so
nationaler Färbung, — ich nenne z. B. Blake, Gillray,
Rowlandson, Moreau, Redon — daß zu deren Verständnis
Volksgemeinschaft die Vorbedingung ist. Was man nicht
vollständig versteht und erfaßt, soll man als Biograph —
mithin auch als Lexikograph — nicht behandeln. Für
diese wenigen Ausnahmen, soweit sie Fremdländer sind
oder sich niemand unter uns befindet, der sich durch
langjährigen Aufenthalt dort völlig in den Geist des
Landes eingelebt hat, wäre die Hilfe von Ausländern ja
erwünscht. Im übrigen ist zu hoffen, daß die Schrift-
leitung des Lexikons sich fortan ganz auf die deutschen
Beine stellt, um gerade bei diesem Monumentalwerk zu
beweisen, was die Welt an uns hat.
Außer in Deutschland gibt es einigermassen gute
Künsterlexika nur in Gestalt von nationalen Werken. Die
Werke dagegen, die die Künstlerschaft aller Völker und
Zeiten umfaßen, sind durchweg kaum ernst zu nehmen.
Das Beste ist wohl die neueste bei Bell erschienene
Ausgabe vom Bryan: sie ist kläglich gegenüber meinem
fünfbändigen Lexikon z. B. Schon, daß sie auf den
Abonnentenfang mittels Abbildungen ging, kennzeichnet
den wissenschaftlichen Wert des Unternehmens. Welchem
Zweck, außer dem der täuschenden Lockung dienen die
kleinen Abbildungen •— und wenn es ein paar Hundert
wären — in einem solchen Werk. Mein (1895 — 1906
erschienenes und übrigens schon vergriffenes) Lexikon
verhält sich zum Thiemeschen wie ein bescheidenes
Wohnhaus zu einem Palast.
Im Thiemeschen findet man, grundsätzlich gewiß
und beinahe auch tatsächlich, jeden Künstler vorge-
führt, über den sich irgendwo Nachrichten erhalten haben.
Die Schriftleitung ist klug genug gewesen, von vornherein
alles bis auf die jüngste Zeit aufzunehmen. Neben dieser
bislang unerreichten Vollständigkeit steht, als Hauptwert
der Arbeit, die Bibliographie. Am Schluß eines jeden
Titels sind genau alle die Stellen angeführt, wo man
Ausführlicheres über den Künstler lesen kann, als man
im Rahmen des Lexikonartikels bringen konnie. Das ist
eine ungeheuer wertvolle Neuerung gegenüber allen
anderen noch benutzungswürdigen Künstlerlexicis.
Es ist vielleicht nicht üblich, einen Bericht dieser
Art und an solcher Stelle mit einem praktischen Appell
zu schließen, und doch will ich das nicht unterlassen.
Meine Worte möchten nicht nur dazu dienen, auf den
wissenschaftlichen Wert des stolzen Werkes hinzuweisen.
Stets redet man heutzutage über dieses und jenes Werk
von nationaler Wichtigkeit: ich halte das Künstlerlexikon
für eins der wichtigsten. Wenn wir es so großzügig zu
Ende führen, wie es bisher gediehen ist, wird es uns in
der Außenwelt mehr Ehrenbezeugungen gewinnen, als
manche unserer staatswirtschaftlichen Schritte. Wo
wir die Überlegenheit haben, da müssen wir sie heraus-
kehren. Zum glücklichen Fortgang ist der Abnehmer
kaum weniger wichtig als Schriftleitung, Mitarbeiter und
Verlag. Ich wünschte, diese Zeilen würden noch manchen
fehlenden daran gemahnen, daß es Ehrenpflicht für ihn
sei, in die Reihe der Abnehmer zu treten. Er gewinnt
nicht nur einen wirklichen Wertgegenstand: gemessen
am Stand unseres Geldes ist der Preis der zuerst stutzig
machen könnte, gar nicht so hoch zu nennen.
121