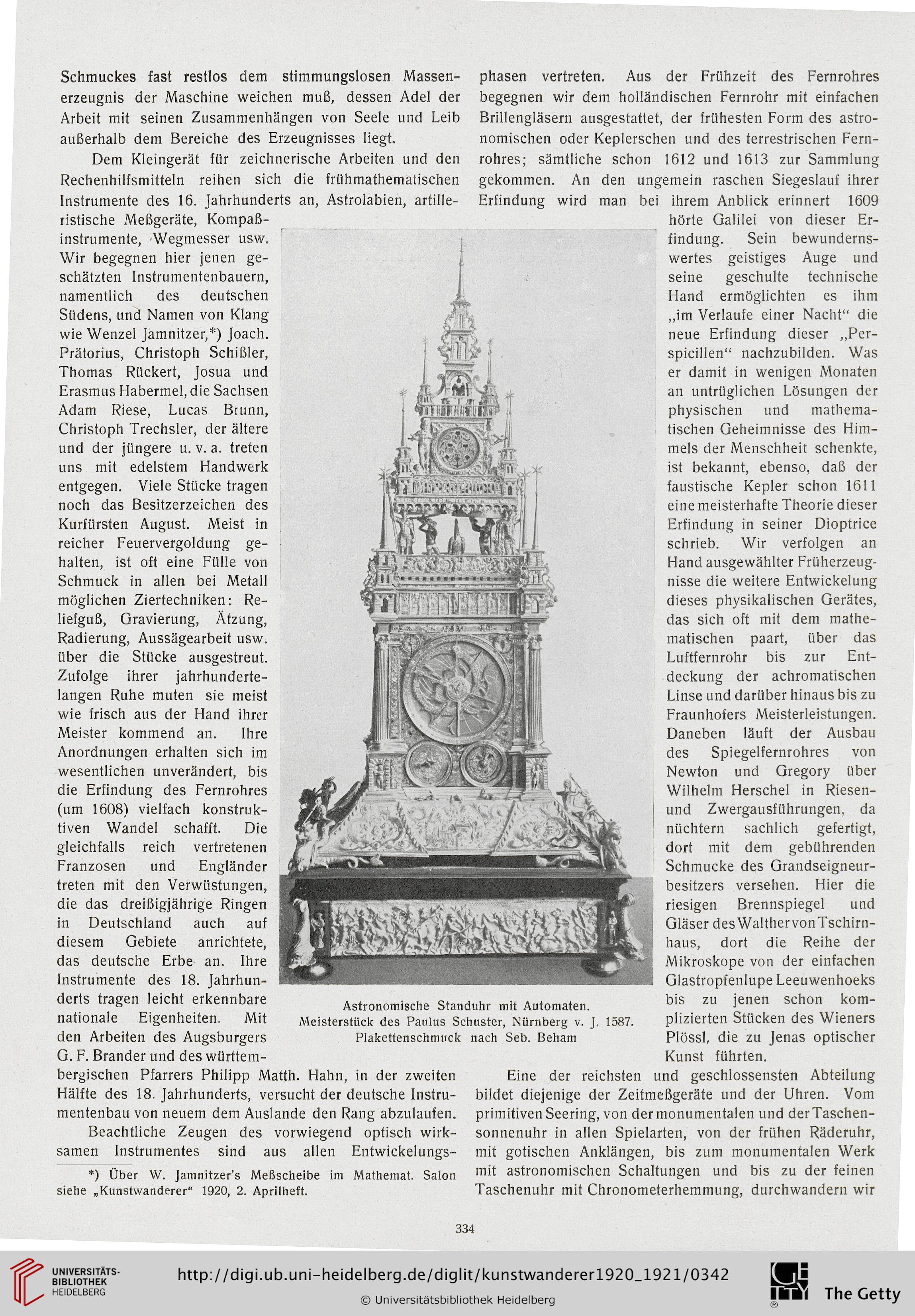Donath, Adolph [Editor]
Der Kunstwanderer: Zeitschrift für alte und neue Kunst, für Kunstmarkt und Sammelwesen
— 2.1920/21
Cite this page
Please cite this page by using the following URL/DOI:
https://doi.org/10.11588/diglit.27814#0342
DOI issue:
2. Aprilheft
DOI article:Engelmann, Max: Der Mathematisch-Physikalische Salon in Dresden, [2]
DOI Page / Citation link:https://doi.org/10.11588/diglit.27814#0342
Schmuckes fast restlos dem stimmungslosen Massen-
erzeugnis der Maschine weichen muß, dessen Adel der
Arbeit mit seinen Zusammenhängen von Seele und Leib
außerhalb dem Bereiche des Erzeugnisses liegt.
Dem Kleingerät für zeichnerische Arbeiten und den
Rechenhilfsmitteln reihen sich die frühmathematischen
Instrumente des 16. Jahrhunderts an, Astrolabien, artille-
ristische Meßgeräte, Kompaß-
instrumente, Wegmesser usw.
Wir begegnen hier jenen ge-
schätzten Instrumentenbauern,
namentlich des deutschen
Südens, und Namen von Klang
wie Wenzel jamnitzer,*) Joach.
Prätorius, Christoph Schißler,
Thomas Rückert, Josua und
Erasmus Habermel, die Sachsen
Adam Riese, Lucas Brunn,
Christoph Trechsler, der ältere
und der jüngere u. v. a. treten
uns mit edelstem Handwerk
entgegen. Viele Stücke tragen
noch das Besitzerzeichen des
Kurfürsten August. Meist in
reicher Feuervergoldung ge-
halten, ist oft eine Fülle von
Schmuck in allen bei Metall
möglichen Ziertechniken: Re-
liefguß, Gravierung, Ätzung,
Radierung, Aussägearbeit usw.
über die Stücke ausgestreut.
Zufolge ihrer jahrhunderte-
langen Ruhe muten sie meist
wie frisch aus der Hand ihrer
Meister kommend an. Ihre
Anordnungen erhalten sich im
wesentlichen unverändert, bis
die Erfindung des Fernrohres
(um 1608) vielfach konstruk-
tiven Wandel schafft. Die
gleichfalls reich vertretenen
Franzosen und Engländer
treten mit den Verwüstungen,
die das dreißigjährige Ringen
in Deutschland auch auf
diesem Gebiete anrichtete,
das deutsche Erbe an. Ihre
Instrumente des 18. Jahrhun-
derts tragen leicht erkennbare
nationale Eigenheiten. Mit
den Arbeiten des Augsburgers
G. F. Brander und des württem-
bergischen Pfarrers Philipp Matth. Hahn, in der zweiten
Hälfte des 18. Jahrhunderts, versucht der deutsche Instru-
mentenbau von neuem dem Auslande den Rang abzulaufen.
Beachtliche Zeugen des vorwiegend optisch wirk-
samen Instrumentes sind aus allen Entwickelungs-
*) Über W. Jamnitzer’s Meßscheibe im Mathemat. Salon
siehe „Kunstwanderer“ 1920, 2. Aprilheft.
phasen vertreten. Aus der Frühzeit des Fernrohres
begegnen wir dem holländischen Fernrohr mit einfachen
Brillengläsern ausgestattet, der frühesten Form des astro-
nomischen oder Keplerschen und des terrestrischen Fern-
rohres; sämtliche schon 1612 und 1613 zur Sammlung
gekommen. An den ungemein raschen Siegeslauf ihrer
Erfindung wird man bei ihrem Anblick erinnert 1609
hörte Galilei von dieser Er-
findung. Sein bewunderns-
wertes geistiges Auge und
seine geschulte technische
Hand ermöglichten es ihm
„im Verlaufe einer Nacht“ die
neue Erfindung dieser „Per-
spicillen“ nachzubilden. Was
er damit in wenigen Monaten
an untrüglichen Lösungen der
physischen und mathema-
tischen Geheimnisse des Him-
mels der Menschheit schenkte,
ist bekannt, ebenso, daß der
faustische Kepler schon 1611
eine meisterhafte Theorie dieser
Erfindung in seiner Dioptrice
schrieb. Wir verfolgen an
Hand ausgewählter Früherzeug-
nisse die weitere Entwickelung
dieses physikalischen Gerätes,
das sich oft mit dem mathe-
matischen paart, über das
Luftfernrohr bis zur Ent-
deckung der achromatischen
Linse und darüber hinaus bis zu
Fraunhofers Meisterleistungen.
Daneben läuft der Ausbau
des Spiegelfernrohres von
Newton und Gregory über
Wilhelm Herschel in Riesen-
und Zwergausführungen, da
nüchtern sachlich gefertigt,
dort mit dem gebührenden
Schmucke des Grandseigneur-
besitzers versehen. Hier die
riesigen Brennspiegel und
Gläser desWalthervonTschirn-
haus, dort die Reihe der
Mikroskope von der einfachen
Glastropfenlupe Leeuwenhoeks
bis zu jenen schon kom-
plizierten Stücken des Wieners
Plössl, die zu Jenas optischer
Kunst führten.
Eine der reichsten und geschlossensten Abteilung
bildet diejenige der Zeitmeßgeräte und der Uhren. Vom
primitiven Seering, von der monumentalen und derTaschen-
sonnenuhr in allen Spielarten, von der frühen Räderuhr,
mit gotischen Anklängen, bis zum monumentalen Werk
mit astronomischen Schaltungen und bis zu der feinen
Taschenuhr mit Chronometerhemmung, durchwandern wir
r.T~. • -■fW l'"
Astronomische Standuhr mit Automaten.
Meisterstück des Paulus Schuster, Nürnberg v. J. 1587.
Piakettenschmuck nach Seb. Beham
334
erzeugnis der Maschine weichen muß, dessen Adel der
Arbeit mit seinen Zusammenhängen von Seele und Leib
außerhalb dem Bereiche des Erzeugnisses liegt.
Dem Kleingerät für zeichnerische Arbeiten und den
Rechenhilfsmitteln reihen sich die frühmathematischen
Instrumente des 16. Jahrhunderts an, Astrolabien, artille-
ristische Meßgeräte, Kompaß-
instrumente, Wegmesser usw.
Wir begegnen hier jenen ge-
schätzten Instrumentenbauern,
namentlich des deutschen
Südens, und Namen von Klang
wie Wenzel jamnitzer,*) Joach.
Prätorius, Christoph Schißler,
Thomas Rückert, Josua und
Erasmus Habermel, die Sachsen
Adam Riese, Lucas Brunn,
Christoph Trechsler, der ältere
und der jüngere u. v. a. treten
uns mit edelstem Handwerk
entgegen. Viele Stücke tragen
noch das Besitzerzeichen des
Kurfürsten August. Meist in
reicher Feuervergoldung ge-
halten, ist oft eine Fülle von
Schmuck in allen bei Metall
möglichen Ziertechniken: Re-
liefguß, Gravierung, Ätzung,
Radierung, Aussägearbeit usw.
über die Stücke ausgestreut.
Zufolge ihrer jahrhunderte-
langen Ruhe muten sie meist
wie frisch aus der Hand ihrer
Meister kommend an. Ihre
Anordnungen erhalten sich im
wesentlichen unverändert, bis
die Erfindung des Fernrohres
(um 1608) vielfach konstruk-
tiven Wandel schafft. Die
gleichfalls reich vertretenen
Franzosen und Engländer
treten mit den Verwüstungen,
die das dreißigjährige Ringen
in Deutschland auch auf
diesem Gebiete anrichtete,
das deutsche Erbe an. Ihre
Instrumente des 18. Jahrhun-
derts tragen leicht erkennbare
nationale Eigenheiten. Mit
den Arbeiten des Augsburgers
G. F. Brander und des württem-
bergischen Pfarrers Philipp Matth. Hahn, in der zweiten
Hälfte des 18. Jahrhunderts, versucht der deutsche Instru-
mentenbau von neuem dem Auslande den Rang abzulaufen.
Beachtliche Zeugen des vorwiegend optisch wirk-
samen Instrumentes sind aus allen Entwickelungs-
*) Über W. Jamnitzer’s Meßscheibe im Mathemat. Salon
siehe „Kunstwanderer“ 1920, 2. Aprilheft.
phasen vertreten. Aus der Frühzeit des Fernrohres
begegnen wir dem holländischen Fernrohr mit einfachen
Brillengläsern ausgestattet, der frühesten Form des astro-
nomischen oder Keplerschen und des terrestrischen Fern-
rohres; sämtliche schon 1612 und 1613 zur Sammlung
gekommen. An den ungemein raschen Siegeslauf ihrer
Erfindung wird man bei ihrem Anblick erinnert 1609
hörte Galilei von dieser Er-
findung. Sein bewunderns-
wertes geistiges Auge und
seine geschulte technische
Hand ermöglichten es ihm
„im Verlaufe einer Nacht“ die
neue Erfindung dieser „Per-
spicillen“ nachzubilden. Was
er damit in wenigen Monaten
an untrüglichen Lösungen der
physischen und mathema-
tischen Geheimnisse des Him-
mels der Menschheit schenkte,
ist bekannt, ebenso, daß der
faustische Kepler schon 1611
eine meisterhafte Theorie dieser
Erfindung in seiner Dioptrice
schrieb. Wir verfolgen an
Hand ausgewählter Früherzeug-
nisse die weitere Entwickelung
dieses physikalischen Gerätes,
das sich oft mit dem mathe-
matischen paart, über das
Luftfernrohr bis zur Ent-
deckung der achromatischen
Linse und darüber hinaus bis zu
Fraunhofers Meisterleistungen.
Daneben läuft der Ausbau
des Spiegelfernrohres von
Newton und Gregory über
Wilhelm Herschel in Riesen-
und Zwergausführungen, da
nüchtern sachlich gefertigt,
dort mit dem gebührenden
Schmucke des Grandseigneur-
besitzers versehen. Hier die
riesigen Brennspiegel und
Gläser desWalthervonTschirn-
haus, dort die Reihe der
Mikroskope von der einfachen
Glastropfenlupe Leeuwenhoeks
bis zu jenen schon kom-
plizierten Stücken des Wieners
Plössl, die zu Jenas optischer
Kunst führten.
Eine der reichsten und geschlossensten Abteilung
bildet diejenige der Zeitmeßgeräte und der Uhren. Vom
primitiven Seering, von der monumentalen und derTaschen-
sonnenuhr in allen Spielarten, von der frühen Räderuhr,
mit gotischen Anklängen, bis zum monumentalen Werk
mit astronomischen Schaltungen und bis zu der feinen
Taschenuhr mit Chronometerhemmung, durchwandern wir
r.T~. • -■fW l'"
Astronomische Standuhr mit Automaten.
Meisterstück des Paulus Schuster, Nürnberg v. J. 1587.
Piakettenschmuck nach Seb. Beham
334