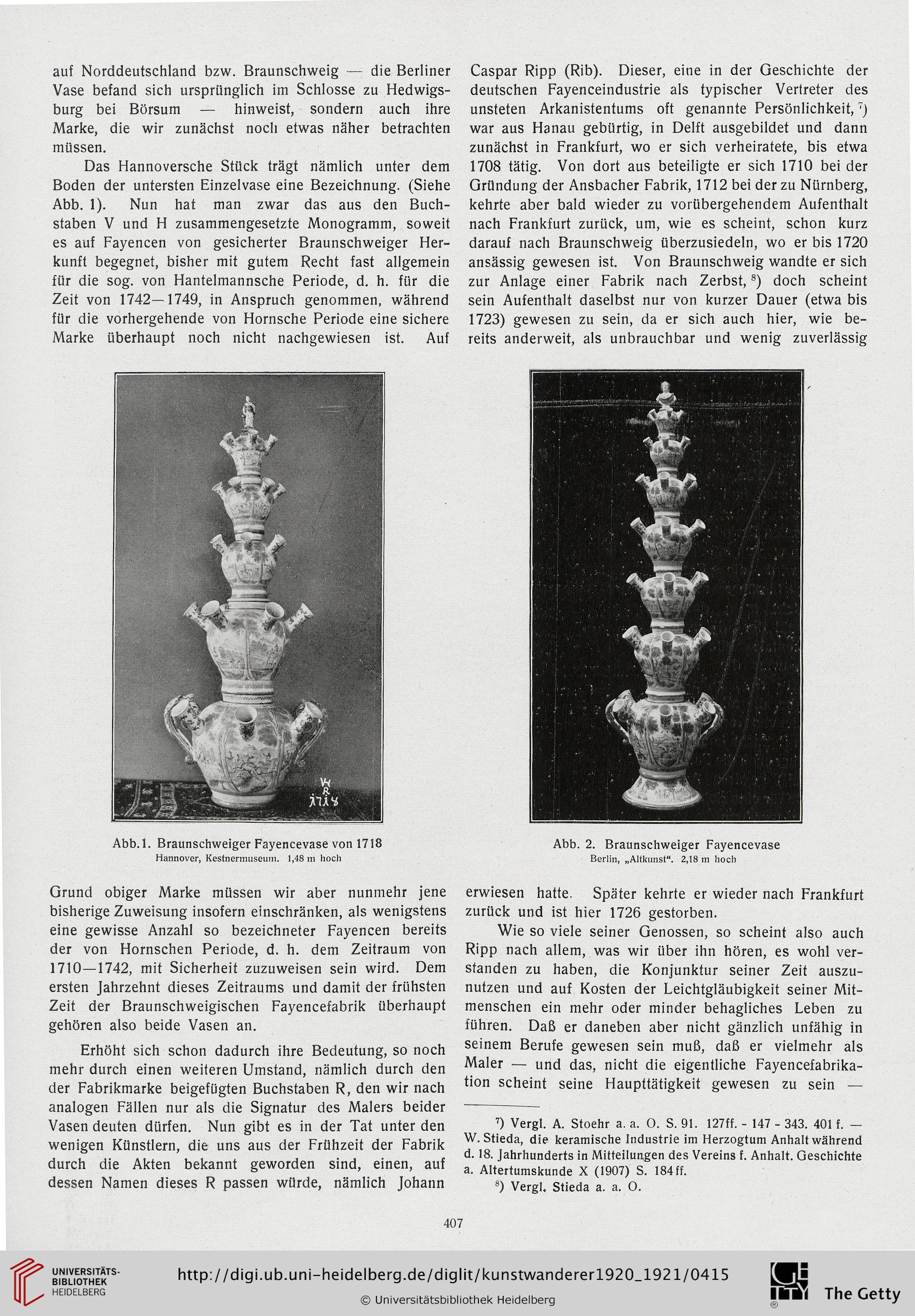Donath, Adolph [Hrsg.]
Der Kunstwanderer: Zeitschrift für alte und neue Kunst, für Kunstmarkt und Sammelwesen
— 2.1920/21
Zitieren dieser Seite
Bitte zitieren Sie diese Seite, indem Sie folgende Adresse (URL)/folgende DOI benutzen:
https://doi.org/10.11588/diglit.27814#0415
DOI Heft:
1./2. Juniheft
DOI Artikel:Scherer, Christian: Braunschweiger Fayencen
DOI Seite / Zitierlink:https://doi.org/10.11588/diglit.27814#0415
auf Norddeutschland bzw. Braunschweig — die Berliner
Vase befand sich ursprünglich im Schlosse zu Hedwigs-
burg bei Börsum — hinweist, sondern auch ihre
Marke, die wir zunächst noch etwas näher betrachten
müssen.
Das Hannoversche Stück trägt nämlich unter dem
Boden der untersten Einzelvase eine Bezeichnung. (Siehe
Abb. 1). Nun hat man zwar das aus den Buch-
staben V und H zusammengesetzte Monogramm, soweit
es auf Fayencen von gesicherter Braunschweiger Her-
kunft begegnet, bisher mit gutem Recht fast allgemein
für die sog. von Hantelmannsche Periode, d. h. für die
Zeit von 1742—1749, in Anspruch genommen, während
für die vorhergehende von Hornsche Periode eine sichere
Marke überhaupt noch nicht nachgewiesen ist. Auf
Abb.l. Braunschweiger Fayencevase von 1718
Hannover, Kestnermuseum. 1,48 m hoch
Grund obiger Marke müssen wir aber nunmehr jene
bisherige Zuweisung insofern einschränken, als wenigstens
eine gewisse Anzahl so bezeichneter Fayencen bereits
der von Hornschen Periode, d. h. dem Zeitraum von
1710—1742, mit Sicherheit zuzuweisen sein wird. Dem
ersten Jahrzehnt dieses Zeitraums und damit der frühsten
Zeit der Braunschweigischen Fayencefabrik überhaupt
gehören also beide Vasen an.
Erhöht sich schon dadurch ihre Bedeutung, so noch
mehr durch einen weiteren Umstand, nämlich durch den
der Fabrikmarke beigefügten Buchstaben R, den wir nach
analogen Fällen nur als die Signatur des Malers beider
Vasen deuten dürfen. Nun gibt es in der Tat unter den
wenigen Künstlern, die uns aus der Frühzeit der Fabrik
durch die Akten bekannt geworden sind, einen, auf
dessen Namen dieses R passen würde, nämlich Johann
Caspar Ripp (Rib). Dieser, eine in der Geschichte der
deutschen Fayenceindustrie als typischer Vertreter des
unsteten Arkanistentums oft genannte Persönlichkeit,7)
war aus Hanau gebürtig, in Delft ausgebildet und dann
zunächst in Frankfurt, wo er sich verheiratete, bis etwa
1708 tätig. Von dort aus beteiligte er sich 1710 bei der
Gründung der Ansbacher Fabrik, 1712 bei der zu Nürnberg,
kehrte aber bald wieder zu vorübergehendem Aufenthalt
nach Frankfurt zurück, um, wie es scheint, schon kurz
darauf nach Braunschweig überzusiedeln, wo er bis 1720
ansässig gewesen ist. Von Braunschweig wandte er sich
zur Anlage einer Fabrik nach Zerbst,8) doch scheint
sein Aufenthalt daselbst nur von kurzer Dauer (etwa bis
1723) gewesen zu sein, da er sich auch hier, wie be-
reits anderweit, als unbrauchbar und wenig zuverlässig
Abb. 2. Braunschweiger Fayencevase
Berlin, „Altkunst“. 2,18 m hoch
erwiesen hatte. Später kehrte er wieder nach Frankfurt
zurück und ist hier 1726 gestorben.
Wie so viele seiner Genossen, so scheint also auch
Ripp nach allem, was wir über ihn hören, es wohl ver-
standen zu haben, die Konjunktur seiner Zeit auszu-
nutzen und auf Kosten der Leichtgläubigkeit seiner Mit-
menschen ein mehr oder minder behagliches Leben zu
führen. Daß er daneben aber nicht gänzlich unfähig in
seinem Berufe gewesen sein muß, daß er vielmehr als
Maler — und das, nicht die eigentliche Fayencefabrika-
tion scheint seine Haupttätigkeit gewesen zu sein —
7) Vergl. A. Stoehr a. a. 0. S. 91. 127ff. - 147 - 343. 401 f. —
W. Stieda, die keramische Industrie im Herzogtum Anhalt während
d. 18. Jahrhunderts in Mitteilungen des Vereins f. Anhalt. Geschichte
a. Altertumskunde X (1907) S. 184 ff.
8) Vergl. Stieda a. a. O.
407
Vase befand sich ursprünglich im Schlosse zu Hedwigs-
burg bei Börsum — hinweist, sondern auch ihre
Marke, die wir zunächst noch etwas näher betrachten
müssen.
Das Hannoversche Stück trägt nämlich unter dem
Boden der untersten Einzelvase eine Bezeichnung. (Siehe
Abb. 1). Nun hat man zwar das aus den Buch-
staben V und H zusammengesetzte Monogramm, soweit
es auf Fayencen von gesicherter Braunschweiger Her-
kunft begegnet, bisher mit gutem Recht fast allgemein
für die sog. von Hantelmannsche Periode, d. h. für die
Zeit von 1742—1749, in Anspruch genommen, während
für die vorhergehende von Hornsche Periode eine sichere
Marke überhaupt noch nicht nachgewiesen ist. Auf
Abb.l. Braunschweiger Fayencevase von 1718
Hannover, Kestnermuseum. 1,48 m hoch
Grund obiger Marke müssen wir aber nunmehr jene
bisherige Zuweisung insofern einschränken, als wenigstens
eine gewisse Anzahl so bezeichneter Fayencen bereits
der von Hornschen Periode, d. h. dem Zeitraum von
1710—1742, mit Sicherheit zuzuweisen sein wird. Dem
ersten Jahrzehnt dieses Zeitraums und damit der frühsten
Zeit der Braunschweigischen Fayencefabrik überhaupt
gehören also beide Vasen an.
Erhöht sich schon dadurch ihre Bedeutung, so noch
mehr durch einen weiteren Umstand, nämlich durch den
der Fabrikmarke beigefügten Buchstaben R, den wir nach
analogen Fällen nur als die Signatur des Malers beider
Vasen deuten dürfen. Nun gibt es in der Tat unter den
wenigen Künstlern, die uns aus der Frühzeit der Fabrik
durch die Akten bekannt geworden sind, einen, auf
dessen Namen dieses R passen würde, nämlich Johann
Caspar Ripp (Rib). Dieser, eine in der Geschichte der
deutschen Fayenceindustrie als typischer Vertreter des
unsteten Arkanistentums oft genannte Persönlichkeit,7)
war aus Hanau gebürtig, in Delft ausgebildet und dann
zunächst in Frankfurt, wo er sich verheiratete, bis etwa
1708 tätig. Von dort aus beteiligte er sich 1710 bei der
Gründung der Ansbacher Fabrik, 1712 bei der zu Nürnberg,
kehrte aber bald wieder zu vorübergehendem Aufenthalt
nach Frankfurt zurück, um, wie es scheint, schon kurz
darauf nach Braunschweig überzusiedeln, wo er bis 1720
ansässig gewesen ist. Von Braunschweig wandte er sich
zur Anlage einer Fabrik nach Zerbst,8) doch scheint
sein Aufenthalt daselbst nur von kurzer Dauer (etwa bis
1723) gewesen zu sein, da er sich auch hier, wie be-
reits anderweit, als unbrauchbar und wenig zuverlässig
Abb. 2. Braunschweiger Fayencevase
Berlin, „Altkunst“. 2,18 m hoch
erwiesen hatte. Später kehrte er wieder nach Frankfurt
zurück und ist hier 1726 gestorben.
Wie so viele seiner Genossen, so scheint also auch
Ripp nach allem, was wir über ihn hören, es wohl ver-
standen zu haben, die Konjunktur seiner Zeit auszu-
nutzen und auf Kosten der Leichtgläubigkeit seiner Mit-
menschen ein mehr oder minder behagliches Leben zu
führen. Daß er daneben aber nicht gänzlich unfähig in
seinem Berufe gewesen sein muß, daß er vielmehr als
Maler — und das, nicht die eigentliche Fayencefabrika-
tion scheint seine Haupttätigkeit gewesen zu sein —
7) Vergl. A. Stoehr a. a. 0. S. 91. 127ff. - 147 - 343. 401 f. —
W. Stieda, die keramische Industrie im Herzogtum Anhalt während
d. 18. Jahrhunderts in Mitteilungen des Vereins f. Anhalt. Geschichte
a. Altertumskunde X (1907) S. 184 ff.
8) Vergl. Stieda a. a. O.
407