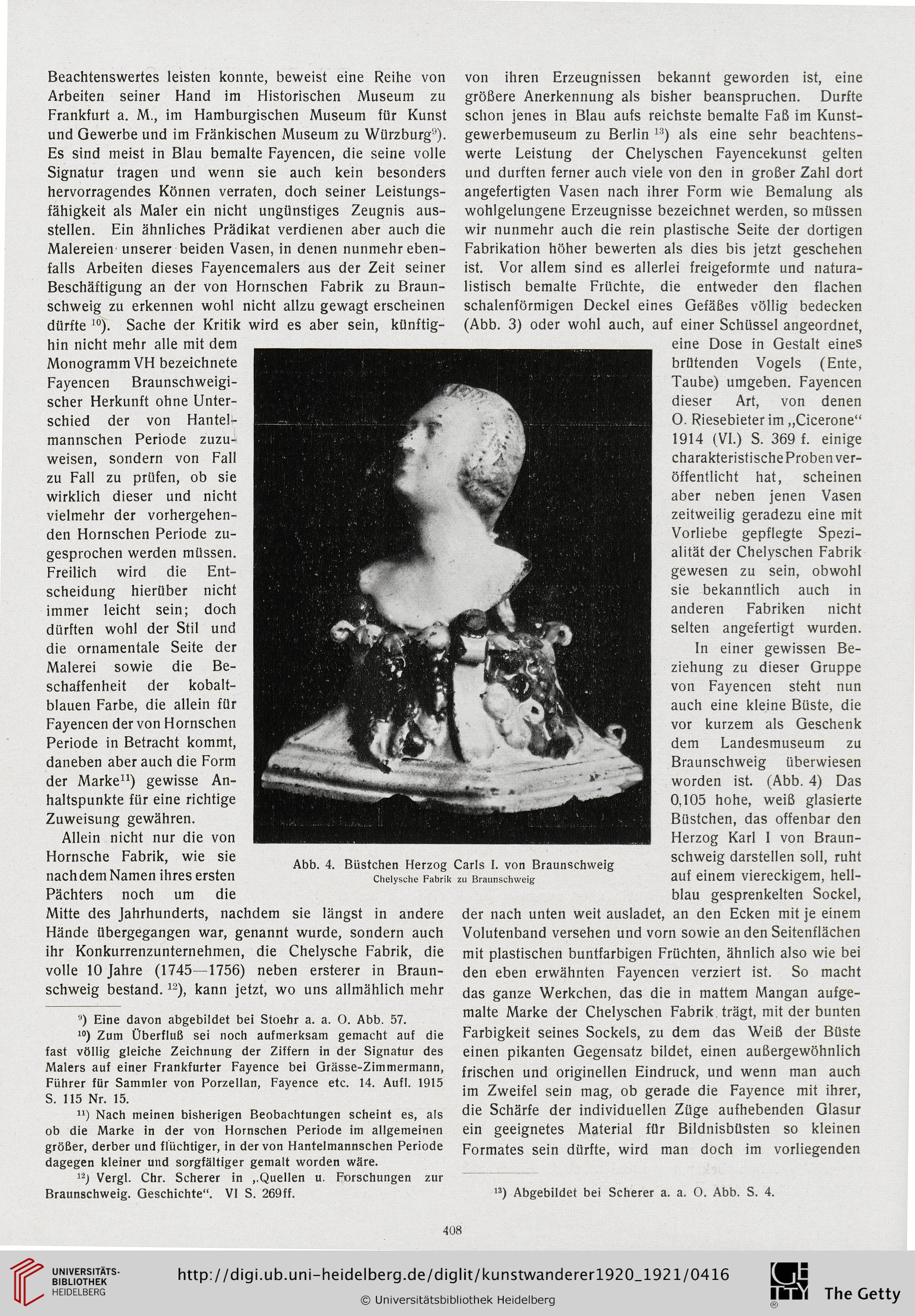Beachtenswertes leisten konnte, beweist eine Reihe von
Arbeiten seiner Hand im Historischen Museum zu
Frankfurt a. M., im Hamburgischen Museum für Kunst
und Gewerbe und im Fränkischen Museum zu Würzburg''').
Es sind meist in Blau bemalte Fayencen, die seine volle
Signatur tragen und wenn sie auch kein besonders
hervorragendes Können verraten, doch seiner Leistungs-
fähigkeit als Maler ein nicht ungünstiges Zeugnis aus-
stellen. Ein ähnliches Prädikat verdienen aber auch die
Malereien unserer beiden Vasen, in denen nunmehr eben-
falls Arbeiten dieses Fayencemalers aus der Zeit seiner
Beschäftigung an der von Hornschen Fabrik zu Braun-
schweig zu erkennen wohl nicht allzu gewagt erscheinen
dürfte 10). Sache der Kritik wird es aber sein, künftig-
hin nicht mehr alle mit dem
Monogramm VH bezeichnete
Fayencen Braunschweigi-
scher Herkunft ohne Unter-
schied der von Hantel-
mannschen Periode zuzu-
weisen, sondern von Fall
zu Fall zu prüfen, ob sie
wirklich dieser und nicht
vielmehr der vorhergehen-
den Hornschen Periode zu-
gesprochen werden müssen.
Freilich wird die Ent-
scheidung hierüber nicht
immer leicht sein; doch
dürften wohl der Stil und
die ornamentale Seite der
Malerei sowie die Be-
schaffenheit der kobalt-
blauen Farbe, die allein für
Fayencen der von Hornschen
Periode in Betracht kommt,
daneben aber auch die Form
der Marke11) gewisse An-
haltspunkte für eine richtige
Zuweisung gewähren.
Allein nicht nur die von
Hornsche Fabrik, wie sie
nachdem Namen ihres ersten
Pächters noch um die
Mitte des Jahrhunderts, nachdem sie längst in andere
Hände übergegangen war, genannt wurde, sondern auch
ihr Konkurrenzunternehmen, die Chelysche Fabrik, die
volle 10 Jahre (1745—1756) neben ersterer in Braun-
schweig bestand.12), kann jetzt, wo uns allmählich mehr
,J) Eine davon abgebildet bei Stoehr a. a. O. Abb. 57.
10) Zum Überfluß sei noch aufmerksam gemacht auf die
fast völlig gleiche Zeichnung der Ziffern in der Signatur des
Malers auf einer Frankfurter Fayence bei Grässe-Zimmermann,
Führer für Sammler von Porzellan, Fayence etc. 14. Aufl. 1915
S. 115 Nr. 15.
n) Nach meinen bisherigen Beobachtungen scheint es, als
ob die Marke in der von Hornschen Periode im allgemeinen
größer, derber und flüchtiger, in der von Hantelmannschen Periode
dagegen kleiner und sorgfältiger gemalt worden wäre.
12) Vergl. Chr. Scherer in ,.Quellen u. Forschungen zur
Braunschweig. Geschichte“. VI S. 269ff.
von ihren Erzeugnissen bekannt geworden ist, eine
größere Anerkennung als bisher beanspruchen. Durfte
schon jenes in Blau aufs reichste bemalte Faß im Kunst-
gewerbemuseum zu Berlin 13) als eine sehr beachtens-
werte Leistung der Chelyschen Fayencekunst gelten
und durften ferner auch viele von den in großer Zahl dort
angefertigten Vasen nach ihrer Form wie Bemalung als
wohlgelungene Erzeugnisse bezeichnet werden, so müssen
wir nunmehr auch die rein plastische Seite der dortigen
Fabrikation höher bewerten als dies bis jetzt geschehen
ist. Vor allem sind es allerlei freigeformte und natura-
listisch bemalte Früchte, die entweder den flachen
schalenförmigen Deckel eines Gefäßes völlig bedecken
(Abb. 3) oder wohl auch, auf einer Schüssel angeordnet,
eine Dose in Gestalt eines
brütenden Vogels (Ente,
Taube) umgeben. Fayencen
dieser Art, von denen
0. Riesebieter im „Cicerone“
1914 (VI.) S. 369 f. einige
charakteristische Proben ver-
öffentlicht hat, scheinen
aber neben jenen Vasen
zeitweilig geradezu eine mit
Vorliebe gepflegte Spezi-
alität der Chelyschen Fabrik
gewesen zu sein, obwohl
sie bekanntlich auch in
anderen Fabriken nicht
selten angefertigt wurden.
In einer gewissen Be-
ziehung zu dieser Gruppe
von Fayencen steht nun
auch eine kleine Büste, die
vor kurzem als Geschenk
dem Landesmuseum zu
Braunschweig überwiesen
worden ist. (Abb. 4) Das
0,105 hohe, weiß glasierte
Büstchen, das offenbar den
Herzog Karl I von Braun-
schweig darstellen soll, ruht
auf einem viereckigem, hell-
blau gesprenkelten Sockel,
der nach unten weit ausladet, an den Ecken mit je einem
Volutenband versehen und vorn sowie an den Seitenflächen
mit plastischen buntfarbigen Früchten, ähnlich also wie bei
den eben erwähnten Fayencen verziert ist. So macht
das ganze Werkchen, das die in mattem Mangan aufge-
malte Marke der Chelyschen Fabrik trägt, mit der bunten
Farbigkeit seines Sockels, zu dem das Weiß der Büste
einen pikanten Gegensatz bildet, einen außergewöhnlich
frischen und originellen Eindruck, und wenn man auch
im Zweifel sein mag, ob gerade die Fayence mit ihrer,
die Schärfe der individuellen Züge aufhebenden Glasur
ein geeignetes Material für Bildnisbüsten so kleinen
Formates sein dürfte, wird man doch im vorliegenden
13) Abgebildet bei Scherer a. a. O. Abb. S. 4.
408
Arbeiten seiner Hand im Historischen Museum zu
Frankfurt a. M., im Hamburgischen Museum für Kunst
und Gewerbe und im Fränkischen Museum zu Würzburg''').
Es sind meist in Blau bemalte Fayencen, die seine volle
Signatur tragen und wenn sie auch kein besonders
hervorragendes Können verraten, doch seiner Leistungs-
fähigkeit als Maler ein nicht ungünstiges Zeugnis aus-
stellen. Ein ähnliches Prädikat verdienen aber auch die
Malereien unserer beiden Vasen, in denen nunmehr eben-
falls Arbeiten dieses Fayencemalers aus der Zeit seiner
Beschäftigung an der von Hornschen Fabrik zu Braun-
schweig zu erkennen wohl nicht allzu gewagt erscheinen
dürfte 10). Sache der Kritik wird es aber sein, künftig-
hin nicht mehr alle mit dem
Monogramm VH bezeichnete
Fayencen Braunschweigi-
scher Herkunft ohne Unter-
schied der von Hantel-
mannschen Periode zuzu-
weisen, sondern von Fall
zu Fall zu prüfen, ob sie
wirklich dieser und nicht
vielmehr der vorhergehen-
den Hornschen Periode zu-
gesprochen werden müssen.
Freilich wird die Ent-
scheidung hierüber nicht
immer leicht sein; doch
dürften wohl der Stil und
die ornamentale Seite der
Malerei sowie die Be-
schaffenheit der kobalt-
blauen Farbe, die allein für
Fayencen der von Hornschen
Periode in Betracht kommt,
daneben aber auch die Form
der Marke11) gewisse An-
haltspunkte für eine richtige
Zuweisung gewähren.
Allein nicht nur die von
Hornsche Fabrik, wie sie
nachdem Namen ihres ersten
Pächters noch um die
Mitte des Jahrhunderts, nachdem sie längst in andere
Hände übergegangen war, genannt wurde, sondern auch
ihr Konkurrenzunternehmen, die Chelysche Fabrik, die
volle 10 Jahre (1745—1756) neben ersterer in Braun-
schweig bestand.12), kann jetzt, wo uns allmählich mehr
,J) Eine davon abgebildet bei Stoehr a. a. O. Abb. 57.
10) Zum Überfluß sei noch aufmerksam gemacht auf die
fast völlig gleiche Zeichnung der Ziffern in der Signatur des
Malers auf einer Frankfurter Fayence bei Grässe-Zimmermann,
Führer für Sammler von Porzellan, Fayence etc. 14. Aufl. 1915
S. 115 Nr. 15.
n) Nach meinen bisherigen Beobachtungen scheint es, als
ob die Marke in der von Hornschen Periode im allgemeinen
größer, derber und flüchtiger, in der von Hantelmannschen Periode
dagegen kleiner und sorgfältiger gemalt worden wäre.
12) Vergl. Chr. Scherer in ,.Quellen u. Forschungen zur
Braunschweig. Geschichte“. VI S. 269ff.
von ihren Erzeugnissen bekannt geworden ist, eine
größere Anerkennung als bisher beanspruchen. Durfte
schon jenes in Blau aufs reichste bemalte Faß im Kunst-
gewerbemuseum zu Berlin 13) als eine sehr beachtens-
werte Leistung der Chelyschen Fayencekunst gelten
und durften ferner auch viele von den in großer Zahl dort
angefertigten Vasen nach ihrer Form wie Bemalung als
wohlgelungene Erzeugnisse bezeichnet werden, so müssen
wir nunmehr auch die rein plastische Seite der dortigen
Fabrikation höher bewerten als dies bis jetzt geschehen
ist. Vor allem sind es allerlei freigeformte und natura-
listisch bemalte Früchte, die entweder den flachen
schalenförmigen Deckel eines Gefäßes völlig bedecken
(Abb. 3) oder wohl auch, auf einer Schüssel angeordnet,
eine Dose in Gestalt eines
brütenden Vogels (Ente,
Taube) umgeben. Fayencen
dieser Art, von denen
0. Riesebieter im „Cicerone“
1914 (VI.) S. 369 f. einige
charakteristische Proben ver-
öffentlicht hat, scheinen
aber neben jenen Vasen
zeitweilig geradezu eine mit
Vorliebe gepflegte Spezi-
alität der Chelyschen Fabrik
gewesen zu sein, obwohl
sie bekanntlich auch in
anderen Fabriken nicht
selten angefertigt wurden.
In einer gewissen Be-
ziehung zu dieser Gruppe
von Fayencen steht nun
auch eine kleine Büste, die
vor kurzem als Geschenk
dem Landesmuseum zu
Braunschweig überwiesen
worden ist. (Abb. 4) Das
0,105 hohe, weiß glasierte
Büstchen, das offenbar den
Herzog Karl I von Braun-
schweig darstellen soll, ruht
auf einem viereckigem, hell-
blau gesprenkelten Sockel,
der nach unten weit ausladet, an den Ecken mit je einem
Volutenband versehen und vorn sowie an den Seitenflächen
mit plastischen buntfarbigen Früchten, ähnlich also wie bei
den eben erwähnten Fayencen verziert ist. So macht
das ganze Werkchen, das die in mattem Mangan aufge-
malte Marke der Chelyschen Fabrik trägt, mit der bunten
Farbigkeit seines Sockels, zu dem das Weiß der Büste
einen pikanten Gegensatz bildet, einen außergewöhnlich
frischen und originellen Eindruck, und wenn man auch
im Zweifel sein mag, ob gerade die Fayence mit ihrer,
die Schärfe der individuellen Züge aufhebenden Glasur
ein geeignetes Material für Bildnisbüsten so kleinen
Formates sein dürfte, wird man doch im vorliegenden
13) Abgebildet bei Scherer a. a. O. Abb. S. 4.
408