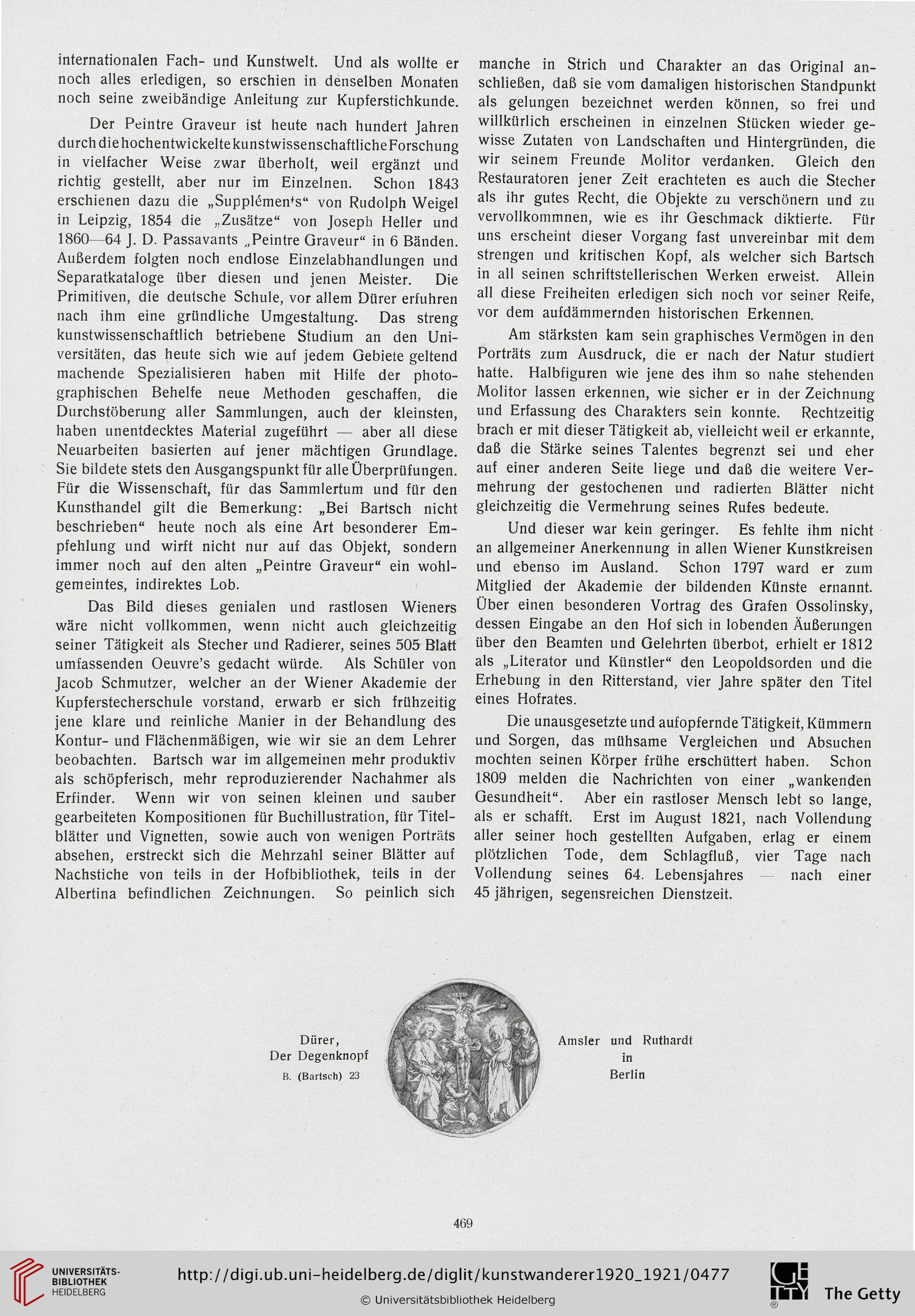internationalen Fach- und Kunstwelt. Und als wollte er
noch alles erledigen, so erschien in denselben Monaten
noch seine zweibändige Anleitung zur Kupferstichkunde.
Der Peintre Graveur ist heute nach hundert Jahren
durch die hochentwickelte kunstwissenschaftliche Forschung
in vielfacher Weise zwar überholt, weil ergänzt und
richtig gestellt, aber nur im Einzelnen. Schon 1843
erschienen dazu die „Supplements“ von Rudolph Weigel
in Leipzig, 1854 die „Zusätze“ von Joseph Heller und
1860—64 J. D. Passavants „Peintre Graveur“ in 6 Bänden.
Außerdem folgten noch endlose Einzelabhandlungen und
Separatkataloge über diesen und jenen Meister. Die
Primitiven, die deutsche Schule, vor allem Dürer erfuhren
nach ihm eine gründliche Umgestaltung. Das streng
kunstwissenschaftlich betriebene Studium an den Uni-
versitäten, das heute sich wie auf jedem Gebiete geltend
machende Spezialisieren haben mit Hilfe der photo-
graphischen Behelfe neue Methoden geschaffen, die
Durchstöberung aller Sammlungen, auch der kleinsten,
haben unentdecktes Material zugeführt — aber all diese
Neuarbeiten basierten auf jener mächtigen Grundlage.
Sie bildete stets den Ausgangspunkt für alle Überprüfungen.
Für die Wissenschaft, für das Sammlertum und für den
Kunsthandel gilt die Bemerkung: „Bei Bartsch nicht
beschrieben“ heute noch als eine Art besonderer Em-
pfehlung und wirft nicht nur auf das Objekt, sondern
immer noch auf den alten „Peintre Graveur“ ein wohl-
gemeintes, indirektes Lob.
Das Bild dieses genialen und rastlosen Wieners
wäre nicht vollkommen, wenn nicht auch gleichzeitig
seiner Tätigkeit als Stecher und Radierer, seines 505 Blatt
umfassenden Oeuvre’s gedacht würde. Als Schüler von
Jacob Schmutzer, welcher an der Wiener Akademie der
Kupferstecherschule Vorstand, erwarb er sich frühzeitig
jene klare und reinliche Manier in der Behandlung des
Kontur- und Flächenmäßigen, wie wir sie an dem Lehrer
beobachten. Bartsch war im allgemeinen mehr produktiv
als schöpferisch, mehr reproduzierender Nachahmer als
Erfinder. Wenn wir von seinen kleinen und sauber
gearbeiteten Kompositionen für Buchillustration, für Titel-
blätter und Vignetten, sowie auch von wenigen Porträts
absehen, erstreckt sich die Mehrzahl seiner Blätter auf
Nachstiche von teils in der Hofbibliothek, teils in der
Albertina befindlichen Zeichnungen. So peinlich sich
manche in Strich und Charakter an das Original an-
schließen, daß sie vom damaligen historischen Standpunkt
als gelungen bezeichnet werden können, so frei und
willkürlich erscheinen in einzelnen Stücken wieder ge-
wisse Zutaten von Landschaften und Hintergründen, die
wir seinem Freunde Molitor verdanken. Gleich den
Restauratoren jener Zeit erachteten es auch die Stecher
als ihr gutes Recht, die Objekte zu verschönern und zu
vervollkommnen, wie es ihr Geschmack diktierte. Für
uns erscheint dieser Vorgang fast unvereinbar mit dem
strengen und kritischen Kopf, als welcher sich Bartsch
in all seinen schriftstellerischen Werken erweist. Allein
all diese Freiheiten erledigen sich noch vor seiner Reife,
vor dem aufdämmernden historischen Erkennen.
Am stärksten kam sein graphisches Vermögen in den
Porträts zum Ausdruck, die er nach der Natur studiert
hatte. Halbfiguren wie jene des ihm so nahe stehenden
Molitor lassen erkennen, wie sicher er in der Zeichnung
und Erfassung des Charakters sein konnte. Rechtzeitig
brach er mit dieser Tätigkeit ab, vielleicht weil er erkannte,
daß die Stärke seines Talentes begrenzt sei und eher
auf einer anderen Seite liege und daß die weitere Ver-
mehrung der gestochenen und radierten Blätter nicht
gleichzeitig die Vermehrung seines Rufes bedeute.
Und dieser war kein geringer. Es fehlte ihm nicht
an allgemeiner Anerkennung in allen Wiener Kunstkreisen
und ebenso im Ausland. Schon 1797 ward er zum
Mitglied der Akademie der bildenden Künste ernannt.
Über einen besonderen Vortrag des Grafen Ossolinsky,
dessen Eingabe an den Hof sich in lobenden Äußerungen
über den Beamten und Gelehrten überbot, erhielt er 1812
als „Literator und Künstler“ den Leopoldsorden und die
Erhebung in den Ritterstand, vier Jahre später den Titel
eines Hofrates.
Die unausgesetzte und aufopfernde Tätigkeit, Kümmern
und Sorgen, das mühsame Vergleichen und Absuchen
mochten seinen Körper frühe erschüttert haben. Schon
1809 melden die Nachrichten von einer „wankenden
Gesundheit“. Aber ein rastloser Mensch lebt so lange,
als er schafft. Erst im August 1821, nach Vollendung
aller seiner hoch gestellten Aufgaben, erlag er einem
plötzlichen Tode, dem Schlagfluß, vier Tage nach
Vollendung seines 64. Lebensjahres nach einer
45 jährigen, segensreichen Dienstzeit.
Dürer,
Der Degenknopf
B. (Bartsch) 23
Amsler und Ruthardt
in
Berlin
469
noch alles erledigen, so erschien in denselben Monaten
noch seine zweibändige Anleitung zur Kupferstichkunde.
Der Peintre Graveur ist heute nach hundert Jahren
durch die hochentwickelte kunstwissenschaftliche Forschung
in vielfacher Weise zwar überholt, weil ergänzt und
richtig gestellt, aber nur im Einzelnen. Schon 1843
erschienen dazu die „Supplements“ von Rudolph Weigel
in Leipzig, 1854 die „Zusätze“ von Joseph Heller und
1860—64 J. D. Passavants „Peintre Graveur“ in 6 Bänden.
Außerdem folgten noch endlose Einzelabhandlungen und
Separatkataloge über diesen und jenen Meister. Die
Primitiven, die deutsche Schule, vor allem Dürer erfuhren
nach ihm eine gründliche Umgestaltung. Das streng
kunstwissenschaftlich betriebene Studium an den Uni-
versitäten, das heute sich wie auf jedem Gebiete geltend
machende Spezialisieren haben mit Hilfe der photo-
graphischen Behelfe neue Methoden geschaffen, die
Durchstöberung aller Sammlungen, auch der kleinsten,
haben unentdecktes Material zugeführt — aber all diese
Neuarbeiten basierten auf jener mächtigen Grundlage.
Sie bildete stets den Ausgangspunkt für alle Überprüfungen.
Für die Wissenschaft, für das Sammlertum und für den
Kunsthandel gilt die Bemerkung: „Bei Bartsch nicht
beschrieben“ heute noch als eine Art besonderer Em-
pfehlung und wirft nicht nur auf das Objekt, sondern
immer noch auf den alten „Peintre Graveur“ ein wohl-
gemeintes, indirektes Lob.
Das Bild dieses genialen und rastlosen Wieners
wäre nicht vollkommen, wenn nicht auch gleichzeitig
seiner Tätigkeit als Stecher und Radierer, seines 505 Blatt
umfassenden Oeuvre’s gedacht würde. Als Schüler von
Jacob Schmutzer, welcher an der Wiener Akademie der
Kupferstecherschule Vorstand, erwarb er sich frühzeitig
jene klare und reinliche Manier in der Behandlung des
Kontur- und Flächenmäßigen, wie wir sie an dem Lehrer
beobachten. Bartsch war im allgemeinen mehr produktiv
als schöpferisch, mehr reproduzierender Nachahmer als
Erfinder. Wenn wir von seinen kleinen und sauber
gearbeiteten Kompositionen für Buchillustration, für Titel-
blätter und Vignetten, sowie auch von wenigen Porträts
absehen, erstreckt sich die Mehrzahl seiner Blätter auf
Nachstiche von teils in der Hofbibliothek, teils in der
Albertina befindlichen Zeichnungen. So peinlich sich
manche in Strich und Charakter an das Original an-
schließen, daß sie vom damaligen historischen Standpunkt
als gelungen bezeichnet werden können, so frei und
willkürlich erscheinen in einzelnen Stücken wieder ge-
wisse Zutaten von Landschaften und Hintergründen, die
wir seinem Freunde Molitor verdanken. Gleich den
Restauratoren jener Zeit erachteten es auch die Stecher
als ihr gutes Recht, die Objekte zu verschönern und zu
vervollkommnen, wie es ihr Geschmack diktierte. Für
uns erscheint dieser Vorgang fast unvereinbar mit dem
strengen und kritischen Kopf, als welcher sich Bartsch
in all seinen schriftstellerischen Werken erweist. Allein
all diese Freiheiten erledigen sich noch vor seiner Reife,
vor dem aufdämmernden historischen Erkennen.
Am stärksten kam sein graphisches Vermögen in den
Porträts zum Ausdruck, die er nach der Natur studiert
hatte. Halbfiguren wie jene des ihm so nahe stehenden
Molitor lassen erkennen, wie sicher er in der Zeichnung
und Erfassung des Charakters sein konnte. Rechtzeitig
brach er mit dieser Tätigkeit ab, vielleicht weil er erkannte,
daß die Stärke seines Talentes begrenzt sei und eher
auf einer anderen Seite liege und daß die weitere Ver-
mehrung der gestochenen und radierten Blätter nicht
gleichzeitig die Vermehrung seines Rufes bedeute.
Und dieser war kein geringer. Es fehlte ihm nicht
an allgemeiner Anerkennung in allen Wiener Kunstkreisen
und ebenso im Ausland. Schon 1797 ward er zum
Mitglied der Akademie der bildenden Künste ernannt.
Über einen besonderen Vortrag des Grafen Ossolinsky,
dessen Eingabe an den Hof sich in lobenden Äußerungen
über den Beamten und Gelehrten überbot, erhielt er 1812
als „Literator und Künstler“ den Leopoldsorden und die
Erhebung in den Ritterstand, vier Jahre später den Titel
eines Hofrates.
Die unausgesetzte und aufopfernde Tätigkeit, Kümmern
und Sorgen, das mühsame Vergleichen und Absuchen
mochten seinen Körper frühe erschüttert haben. Schon
1809 melden die Nachrichten von einer „wankenden
Gesundheit“. Aber ein rastloser Mensch lebt so lange,
als er schafft. Erst im August 1821, nach Vollendung
aller seiner hoch gestellten Aufgaben, erlag er einem
plötzlichen Tode, dem Schlagfluß, vier Tage nach
Vollendung seines 64. Lebensjahres nach einer
45 jährigen, segensreichen Dienstzeit.
Dürer,
Der Degenknopf
B. (Bartsch) 23
Amsler und Ruthardt
in
Berlin
469