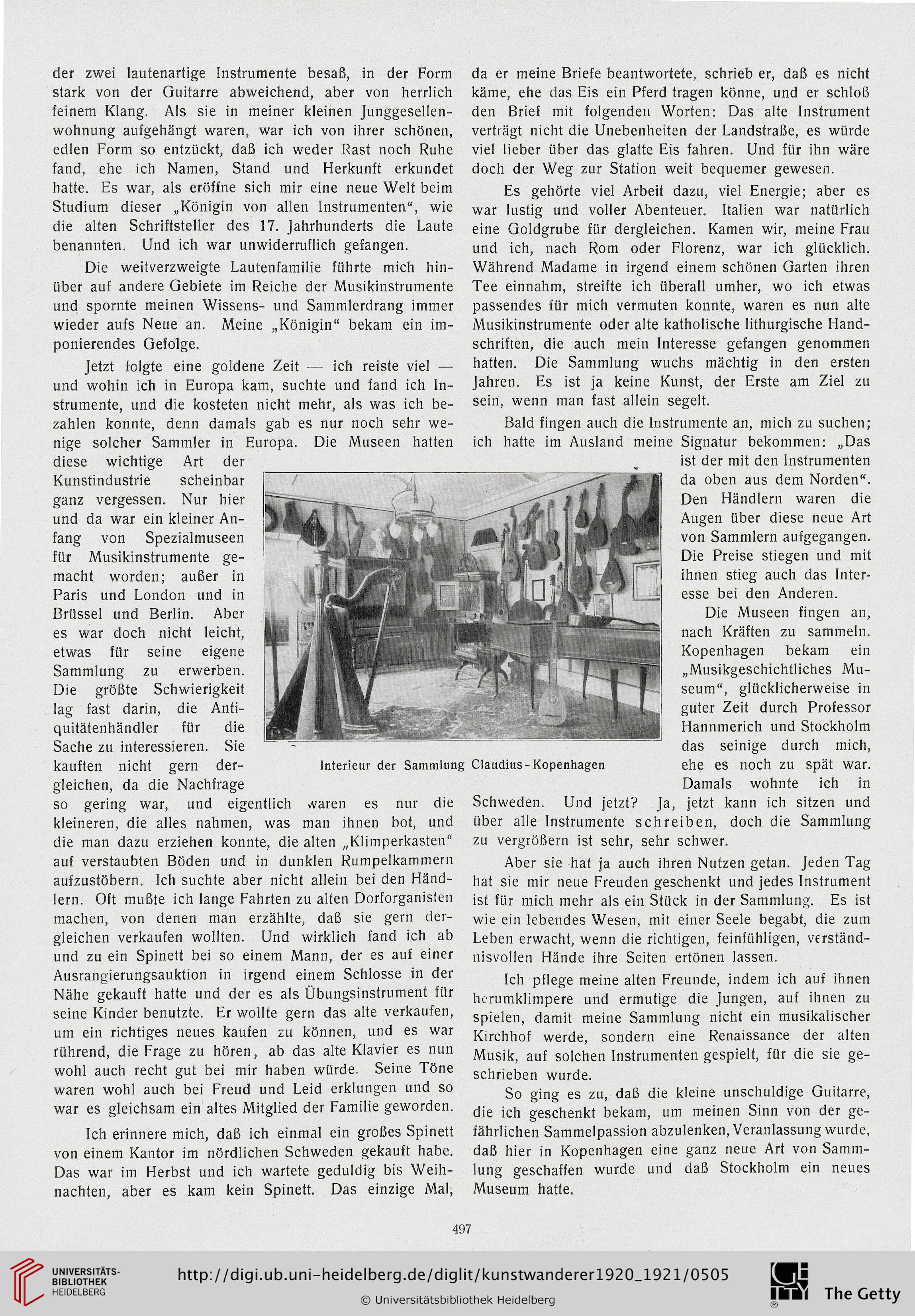der zwei lautenartige Instrumente besaß, in der Form
stark von der Guitarre abweichend, aber von herrlich
feinem Klang. Als sie in meiner kleinen Junggesellen-
wohnung aufgehängt waren, war ich von ihrer schönen,
edlen Form so entzückt, daß ich weder Rast noch Ruhe
fand, ehe ich Namen, Stand und Herkunft erkundet
hatte. Es war, als eröffne sich mir eine neue Welt beim
Studium dieser „Königin von allen Instrumenten“, wie
die alten Schriftsteller des 17. Jahrhunderts die Laute
benannten. Und ich war unwiderruflich gefangen.
Die weitverzweigte Lautenfamilie führte mich hin-
über auf andere Gebiete im Reiche der Musikinstrumente
und spornte meinen Wissens- und Sammlerdrang immer
wieder aufs Neue an. Meine „Königin“ bekam ein im-
ponierendes Gefolge.
Jetzt folgte eine goldene Zeit — ich reiste viel —
und wohin ich in Europa kam, suchte und fand ich In-
strumente, und die kosteten nicht mehr, als was ich be-
zahlen konnte, denn damals gab es nur noch sehr we-
nige solcher Sammler in Europa. Die Museen hatten
diese wichtige Art der
Kunstindustrie scheinbar
ganz vergessen. Nur hier
und da war ein kleiner An-
fang von Spezialmuseen
für Musikinstrumente ge-
macht worden; außer in
Paris und London und in
Brüssel und Berlin. Aber
es war doch nicht leicht,
etwas für seine eigene
Sammlung zu erwerben.
Die größte Schwierigkeit
lag fast darin, die Anti-
quitätenhändler für die
Sache zu interessieren. Sie
kauften nicht gern der-
gleichen, da die Nachfrage
so gering war, und eigentlich »varen es nur die
kleineren, die alles nahmen, was man ihnen bot, und
die man dazu erziehen konnte, die alten „Klimperkasten“
auf verstaubten Böden und in dunklen Rumpelkammern
aufzustöbern. Ich suchte aber nicht allein bei den Händ-
lern. Oft mußte ich lange Fahrten zu alten Dorforganisten
machen, von denen man erzählte, daß sie gern der-
gleichen verkaufen wollten. Und wirklich fand ich ab
und zu ein Spinett bei so einem Mann, der es auf einer
Ausrangierungsauktion in irgend einem Schlosse in der
Nähe gekauft hatte und der es als Übungsinstrument für
seine Kinder benutzte. Er wollte gern das alte verkaufen,
um ein richtiges neues kaufen zu können, und es war
rührend, die Frage zu hören, ab das alte Klavier es nun
wohl auch recht gut bei mir haben würde. Seine Töne
waren wohl auch bei Freud und Leid erklungen und so
war es gleichsam ein altes Mitglied der Familie geworden.
Ich erinnere mich, daß ich einmal ein großes Spinett
von einem Kantor im nördlichen Schweden gekauft habe.
Das war im Herbst und ich wartete geduldig bis Weih-
nachten, aber es kam kein Spinett. Das einzige Mal,
da er meine Briefe beantwortete, schrieb er, daß es nicht
käme, ehe das Eis ein Pferd tragen könne, und er schloß
den Brief mit folgenden Worten: Das alte Instrument
verträgt nicht die Unebenheiten der Landstraße, es würde
viel lieber über das glatte Eis fahren. Und für ihn wäre
doch der Weg zur Station weit bequemer gewesen.
Es gehörte viel Arbeit dazu, viel Energie; aber es
war lustig und voller Abenteuer. Italien war natürlich
eine Goldgrube für dergleichen. Kamen wir, meine Frau
und ich, nach Rom oder Florenz, war ich glücklich.
Während Madame in irgend einem schönen Garten ihren
Tee einnahm, streifte ich überall umher, wo ich etwas
passendes für mich vermuten konnte, waren es nun alte
Musikinstrumente oder alte katholische lithurgische Hand-
schriften, die auch mein Interesse gefangen genommen
hatten. Die Sammlung wuchs mächtig in den ersten
Jahren. Es ist ja keine Kunst, der Erste am Ziel zu
sein, wenn man fast allein segelt.
Bald fingen auch die Instrumente an, mich zu suchen;
ich hatte im Ausland meine Signatur bekommen: „Das
ist der mit den Instrumenten
da oben aus dem Norden“.
Den Händlern waren die
Augen über diese neue Art
von Sammlern aufgegangen.
Die Preise stiegen und mit
ihnen stieg auch das Inter-
esse bei den Anderen.
Die Museen fingen an,
nach Kräften zu sammeln.
Kopenhagen bekam ein
„Musikgeschichtliches Mu-
seum“, glücklicherweise in
guter Zeit durch Professor
Hannmerich und Stockholm
das seinige durch mich,
ehe es noch zu spät war.
Damals wohnte ich in
Schweden. Und jetzt? Ja, jetzt kann ich sitzen und
über alle Instrumente schreiben, doch die Sammlung
zu vergrößern ist sehr, sehr schwer.
Aber sie hat ja auch ihren Nutzen getan. Jeden Tag
hat sie mir neue Freuden geschenkt und jedes Instrument
ist für mich mehr als ein Stück in der Sammlung. Es ist
wie ein lebendes Wesen, mit einer Seele begabt, die zum
Leben erwacht, wenn die richtigen, feinfühligen, verständ-
nisvollen Hände ihre Seiten ertönen lassen.
Ich pflege meine alten Freunde, indem ich auf ihnen
herumklimpere und ermutige die Jungen, auf ihnen zu
spielen, damit meine Sammlung nicht ein musikalischer
Kirchhof werde, sondern eine Renaissance der alten
Musik, auf solchen Instrumenten gespielt, für die sie ge-
schrieben wurde.
So ging es zu, daß die kleine unschuldige Guitarre,
die ich geschenkt bekam, um meinen Sinn von der ge-
fährlichen Sammelpassion abzulenken, Veranlassung wurde,
daß hier in Kopenhagen eine ganz neue Art von Samm-
lung geschaffen wurde und daß Stockholm ein neues
Museum hatte.
Interieur der Sammlung Claudius - Kopenhagen
497
stark von der Guitarre abweichend, aber von herrlich
feinem Klang. Als sie in meiner kleinen Junggesellen-
wohnung aufgehängt waren, war ich von ihrer schönen,
edlen Form so entzückt, daß ich weder Rast noch Ruhe
fand, ehe ich Namen, Stand und Herkunft erkundet
hatte. Es war, als eröffne sich mir eine neue Welt beim
Studium dieser „Königin von allen Instrumenten“, wie
die alten Schriftsteller des 17. Jahrhunderts die Laute
benannten. Und ich war unwiderruflich gefangen.
Die weitverzweigte Lautenfamilie führte mich hin-
über auf andere Gebiete im Reiche der Musikinstrumente
und spornte meinen Wissens- und Sammlerdrang immer
wieder aufs Neue an. Meine „Königin“ bekam ein im-
ponierendes Gefolge.
Jetzt folgte eine goldene Zeit — ich reiste viel —
und wohin ich in Europa kam, suchte und fand ich In-
strumente, und die kosteten nicht mehr, als was ich be-
zahlen konnte, denn damals gab es nur noch sehr we-
nige solcher Sammler in Europa. Die Museen hatten
diese wichtige Art der
Kunstindustrie scheinbar
ganz vergessen. Nur hier
und da war ein kleiner An-
fang von Spezialmuseen
für Musikinstrumente ge-
macht worden; außer in
Paris und London und in
Brüssel und Berlin. Aber
es war doch nicht leicht,
etwas für seine eigene
Sammlung zu erwerben.
Die größte Schwierigkeit
lag fast darin, die Anti-
quitätenhändler für die
Sache zu interessieren. Sie
kauften nicht gern der-
gleichen, da die Nachfrage
so gering war, und eigentlich »varen es nur die
kleineren, die alles nahmen, was man ihnen bot, und
die man dazu erziehen konnte, die alten „Klimperkasten“
auf verstaubten Böden und in dunklen Rumpelkammern
aufzustöbern. Ich suchte aber nicht allein bei den Händ-
lern. Oft mußte ich lange Fahrten zu alten Dorforganisten
machen, von denen man erzählte, daß sie gern der-
gleichen verkaufen wollten. Und wirklich fand ich ab
und zu ein Spinett bei so einem Mann, der es auf einer
Ausrangierungsauktion in irgend einem Schlosse in der
Nähe gekauft hatte und der es als Übungsinstrument für
seine Kinder benutzte. Er wollte gern das alte verkaufen,
um ein richtiges neues kaufen zu können, und es war
rührend, die Frage zu hören, ab das alte Klavier es nun
wohl auch recht gut bei mir haben würde. Seine Töne
waren wohl auch bei Freud und Leid erklungen und so
war es gleichsam ein altes Mitglied der Familie geworden.
Ich erinnere mich, daß ich einmal ein großes Spinett
von einem Kantor im nördlichen Schweden gekauft habe.
Das war im Herbst und ich wartete geduldig bis Weih-
nachten, aber es kam kein Spinett. Das einzige Mal,
da er meine Briefe beantwortete, schrieb er, daß es nicht
käme, ehe das Eis ein Pferd tragen könne, und er schloß
den Brief mit folgenden Worten: Das alte Instrument
verträgt nicht die Unebenheiten der Landstraße, es würde
viel lieber über das glatte Eis fahren. Und für ihn wäre
doch der Weg zur Station weit bequemer gewesen.
Es gehörte viel Arbeit dazu, viel Energie; aber es
war lustig und voller Abenteuer. Italien war natürlich
eine Goldgrube für dergleichen. Kamen wir, meine Frau
und ich, nach Rom oder Florenz, war ich glücklich.
Während Madame in irgend einem schönen Garten ihren
Tee einnahm, streifte ich überall umher, wo ich etwas
passendes für mich vermuten konnte, waren es nun alte
Musikinstrumente oder alte katholische lithurgische Hand-
schriften, die auch mein Interesse gefangen genommen
hatten. Die Sammlung wuchs mächtig in den ersten
Jahren. Es ist ja keine Kunst, der Erste am Ziel zu
sein, wenn man fast allein segelt.
Bald fingen auch die Instrumente an, mich zu suchen;
ich hatte im Ausland meine Signatur bekommen: „Das
ist der mit den Instrumenten
da oben aus dem Norden“.
Den Händlern waren die
Augen über diese neue Art
von Sammlern aufgegangen.
Die Preise stiegen und mit
ihnen stieg auch das Inter-
esse bei den Anderen.
Die Museen fingen an,
nach Kräften zu sammeln.
Kopenhagen bekam ein
„Musikgeschichtliches Mu-
seum“, glücklicherweise in
guter Zeit durch Professor
Hannmerich und Stockholm
das seinige durch mich,
ehe es noch zu spät war.
Damals wohnte ich in
Schweden. Und jetzt? Ja, jetzt kann ich sitzen und
über alle Instrumente schreiben, doch die Sammlung
zu vergrößern ist sehr, sehr schwer.
Aber sie hat ja auch ihren Nutzen getan. Jeden Tag
hat sie mir neue Freuden geschenkt und jedes Instrument
ist für mich mehr als ein Stück in der Sammlung. Es ist
wie ein lebendes Wesen, mit einer Seele begabt, die zum
Leben erwacht, wenn die richtigen, feinfühligen, verständ-
nisvollen Hände ihre Seiten ertönen lassen.
Ich pflege meine alten Freunde, indem ich auf ihnen
herumklimpere und ermutige die Jungen, auf ihnen zu
spielen, damit meine Sammlung nicht ein musikalischer
Kirchhof werde, sondern eine Renaissance der alten
Musik, auf solchen Instrumenten gespielt, für die sie ge-
schrieben wurde.
So ging es zu, daß die kleine unschuldige Guitarre,
die ich geschenkt bekam, um meinen Sinn von der ge-
fährlichen Sammelpassion abzulenken, Veranlassung wurde,
daß hier in Kopenhagen eine ganz neue Art von Samm-
lung geschaffen wurde und daß Stockholm ein neues
Museum hatte.
Interieur der Sammlung Claudius - Kopenhagen
497