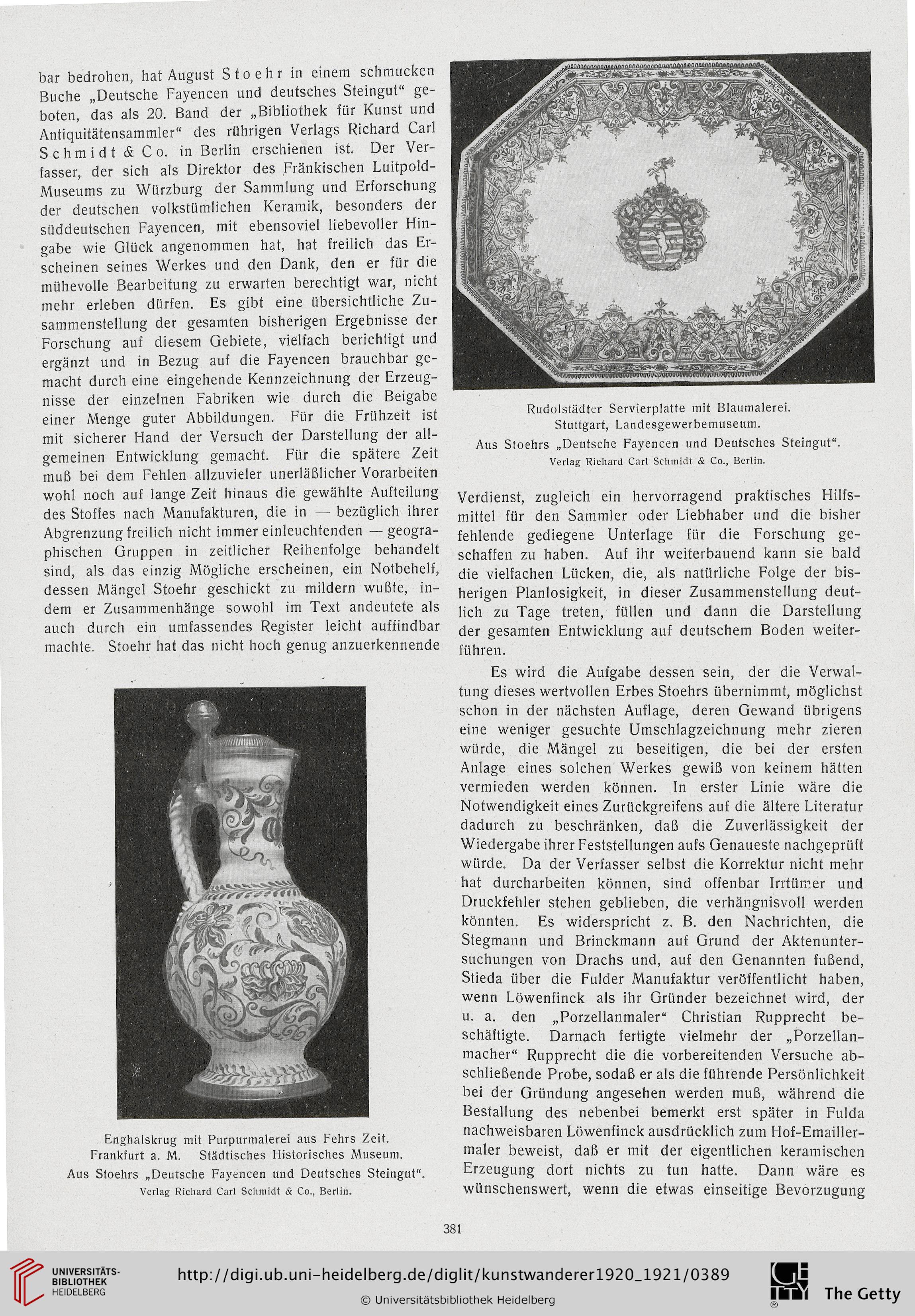Donath, Adolph [Hrsg.]
Der Kunstwanderer: Zeitschrift für alte und neue Kunst, für Kunstmarkt und Sammelwesen
— 2.1920/21
Zitieren dieser Seite
Bitte zitieren Sie diese Seite, indem Sie folgende Adresse (URL)/folgende DOI benutzen:
https://doi.org/10.11588/diglit.27814#0389
DOI Heft:
2. Maiheft
DOI Artikel:Josten, Hanns Heinz: Fayencen und Steingut
DOI Seite / Zitierlink:https://doi.org/10.11588/diglit.27814#0389
bar bedrohen, hat August Stoehr in einem schmucken
Buche „Deutsche Fayencen und deutsches Steingut“ ge-
boten, das als 20. Band der „Bibliothek für Kunst und
Antiquitätensammler“ des rührigen Verlags Richard Carl
Schmidt & Co. in Berlin erschienen ist. Der Ver-
fasser, der sich als Direktor des Fränkischen Luitpold-
Museums zu Würzburg der Sammlung und Erforschung
der deutschen volkstümlichen Keramik, besonders der
süddeutschen Fayencen, mit ebensoviel liebevoller Hin-
gabe wie Glück angenommen hat, hat freilich das Er-
scheinen seines Werkes und den Dank, den er für die
mühevolle Bearbeitung zu erwarten berechtigt war, nicht
mehr erleben dürfen. Es gibt eine übersichtliche Zu-
sammenstellung der gesamten bisherigen Ergebnisse der
Forschung auf diesem Gebiete, vielfach berichtigt und
ergänzt und in Bezug auf die Fayencen brauchbar ge-
macht durch eine eingehende Kennzeichnung der Erzeug-
nisse der einzelnen Fabriken wie durch die Beigabe
einer Menge guter Abbildungen. Für die Frühzeit ist
mit sicherer Hand der Versuch der Darstellung der all-
gemeinen Entwicklung gemacht. Für die spätere Zeit
muß bei dem Fehlen allzuvieler unerläßlicher Vorarbeiten
wohl noch auf lange Zeit hinaus die gewählte Aufteilung
des Stoffes nach Manufakturen, die in — bezüglich ihrer
Abgrenzung freilich nicht immer einleuchtenden — geogra-
phischen Gruppen in zeitlicher Reihenfolge behandelt
sind, als das einzig Mögliche erscheinen, ein Notbehelf,
dessen Mängel Stoehr geschickt zu mildern wußte, in-
dem er Zusammenhänge sowohl im Text andeutete als
auch durch ein umfassendes Register leicht auffindbar
machte. Stoehr hat das nicht hoch genug anzuerkennende
Enghalskrug mit Purpurmalerei aus Fehrs Zeit.
Frankfurt a. M. Städtisches Historisches Museum.
Aus Stoehrs „Deutsche Fayencen und Deutsches Steingut“.
Verlag Richard Carl Schmidt & Co., Berlin.
Rudolstädter Servierplatte mit Blaumalerei.
Stuttgart, Landesgewerbemuseum.
Aus Stoehrs „Deutsche Fayencen und Deutsches Steingut“.
Verlag Riehard Carl Schmidt & Co., Berlin.
Verdienst, zugleich ein hervorragend praktisches Hilfs-
mittel für den Sammler oder Liebhaber und die bisher
fehlende gediegene Unterlage für die Forschung ge-
schaffen zu haben. Auf ihr weiterbauend kann sie bald
die vielfachen Lücken, die, als natürliche Folge der bis-
herigen Planlosigkeit, in dieser Zusammenstellung deut-
lich zu Tage treten, füllen und dann die Darstellung
der gesamten Entwicklung auf deutschem Boden weiter-
führen.
Es wird die Aufgabe dessen sein, der die Verwal-
tung dieses wertvollen Erbes Stoehrs übernimmt, möglichst
schon in der nächsten Auflage, deren Gewand übrigens
eine weniger gesuchte Umschlagzeichnung mehr zieren
würde, die Mängel zu beseitigen, die bei der ersten
Anlage eines solchen Werkes gewiß von keinem hätten
vermieden werden können. In erster Linie wäre die
Notwendigkeit eines Zurückgreifens auf die ältere Literatur
dadurch zu beschränken, daß die Zuverlässigkeit der
Wiedergabe ihrer Feststellungen aufs Genaueste nachgeprüft
würde. Da der Verfasser selbst die Korrektur nicht mehr
hat durcharbeiten können, sind offenbar Irrtümer und
Druckfehler stehen geblieben, die verhängnisvoll werden
könnten. Es widerspricht z. B. den Nachrichten, die
Stegmann und Brinckmann auf Grund der Aktenunter-
suchungen von Drachs und, auf den Genannten fußend,
Stieda über die Fulder Manufaktur veröffentlicht haben,
wenn Löwenfinck als ihr Gründer bezeichnet wird, der
u. a. den „Porzellanmaler“ Christian Rupprecht be-
schäftigte. Darnach fertigte vielmehr der „Porzellan-
macher“ Rupprecht die die vorbereitenden Versuche ab-
schließende Probe, sodaß er als die führende Persönlichkeit
bei der Gründung angesehen werden muß, während die
Bestallung des nebenbei bemerkt erst später in Fulda
nachweisbaren Löwenfinck ausdrücklich zum Hof-Emailler-
maler beweist, daß er mit der eigentlichen keramischen
Erzeugung dort nichts zu tun hatte. Dann wäre es
wünschenswert, wenn die etwas einseitige Bevorzugung
381
Buche „Deutsche Fayencen und deutsches Steingut“ ge-
boten, das als 20. Band der „Bibliothek für Kunst und
Antiquitätensammler“ des rührigen Verlags Richard Carl
Schmidt & Co. in Berlin erschienen ist. Der Ver-
fasser, der sich als Direktor des Fränkischen Luitpold-
Museums zu Würzburg der Sammlung und Erforschung
der deutschen volkstümlichen Keramik, besonders der
süddeutschen Fayencen, mit ebensoviel liebevoller Hin-
gabe wie Glück angenommen hat, hat freilich das Er-
scheinen seines Werkes und den Dank, den er für die
mühevolle Bearbeitung zu erwarten berechtigt war, nicht
mehr erleben dürfen. Es gibt eine übersichtliche Zu-
sammenstellung der gesamten bisherigen Ergebnisse der
Forschung auf diesem Gebiete, vielfach berichtigt und
ergänzt und in Bezug auf die Fayencen brauchbar ge-
macht durch eine eingehende Kennzeichnung der Erzeug-
nisse der einzelnen Fabriken wie durch die Beigabe
einer Menge guter Abbildungen. Für die Frühzeit ist
mit sicherer Hand der Versuch der Darstellung der all-
gemeinen Entwicklung gemacht. Für die spätere Zeit
muß bei dem Fehlen allzuvieler unerläßlicher Vorarbeiten
wohl noch auf lange Zeit hinaus die gewählte Aufteilung
des Stoffes nach Manufakturen, die in — bezüglich ihrer
Abgrenzung freilich nicht immer einleuchtenden — geogra-
phischen Gruppen in zeitlicher Reihenfolge behandelt
sind, als das einzig Mögliche erscheinen, ein Notbehelf,
dessen Mängel Stoehr geschickt zu mildern wußte, in-
dem er Zusammenhänge sowohl im Text andeutete als
auch durch ein umfassendes Register leicht auffindbar
machte. Stoehr hat das nicht hoch genug anzuerkennende
Enghalskrug mit Purpurmalerei aus Fehrs Zeit.
Frankfurt a. M. Städtisches Historisches Museum.
Aus Stoehrs „Deutsche Fayencen und Deutsches Steingut“.
Verlag Richard Carl Schmidt & Co., Berlin.
Rudolstädter Servierplatte mit Blaumalerei.
Stuttgart, Landesgewerbemuseum.
Aus Stoehrs „Deutsche Fayencen und Deutsches Steingut“.
Verlag Riehard Carl Schmidt & Co., Berlin.
Verdienst, zugleich ein hervorragend praktisches Hilfs-
mittel für den Sammler oder Liebhaber und die bisher
fehlende gediegene Unterlage für die Forschung ge-
schaffen zu haben. Auf ihr weiterbauend kann sie bald
die vielfachen Lücken, die, als natürliche Folge der bis-
herigen Planlosigkeit, in dieser Zusammenstellung deut-
lich zu Tage treten, füllen und dann die Darstellung
der gesamten Entwicklung auf deutschem Boden weiter-
führen.
Es wird die Aufgabe dessen sein, der die Verwal-
tung dieses wertvollen Erbes Stoehrs übernimmt, möglichst
schon in der nächsten Auflage, deren Gewand übrigens
eine weniger gesuchte Umschlagzeichnung mehr zieren
würde, die Mängel zu beseitigen, die bei der ersten
Anlage eines solchen Werkes gewiß von keinem hätten
vermieden werden können. In erster Linie wäre die
Notwendigkeit eines Zurückgreifens auf die ältere Literatur
dadurch zu beschränken, daß die Zuverlässigkeit der
Wiedergabe ihrer Feststellungen aufs Genaueste nachgeprüft
würde. Da der Verfasser selbst die Korrektur nicht mehr
hat durcharbeiten können, sind offenbar Irrtümer und
Druckfehler stehen geblieben, die verhängnisvoll werden
könnten. Es widerspricht z. B. den Nachrichten, die
Stegmann und Brinckmann auf Grund der Aktenunter-
suchungen von Drachs und, auf den Genannten fußend,
Stieda über die Fulder Manufaktur veröffentlicht haben,
wenn Löwenfinck als ihr Gründer bezeichnet wird, der
u. a. den „Porzellanmaler“ Christian Rupprecht be-
schäftigte. Darnach fertigte vielmehr der „Porzellan-
macher“ Rupprecht die die vorbereitenden Versuche ab-
schließende Probe, sodaß er als die führende Persönlichkeit
bei der Gründung angesehen werden muß, während die
Bestallung des nebenbei bemerkt erst später in Fulda
nachweisbaren Löwenfinck ausdrücklich zum Hof-Emailler-
maler beweist, daß er mit der eigentlichen keramischen
Erzeugung dort nichts zu tun hatte. Dann wäre es
wünschenswert, wenn die etwas einseitige Bevorzugung
381