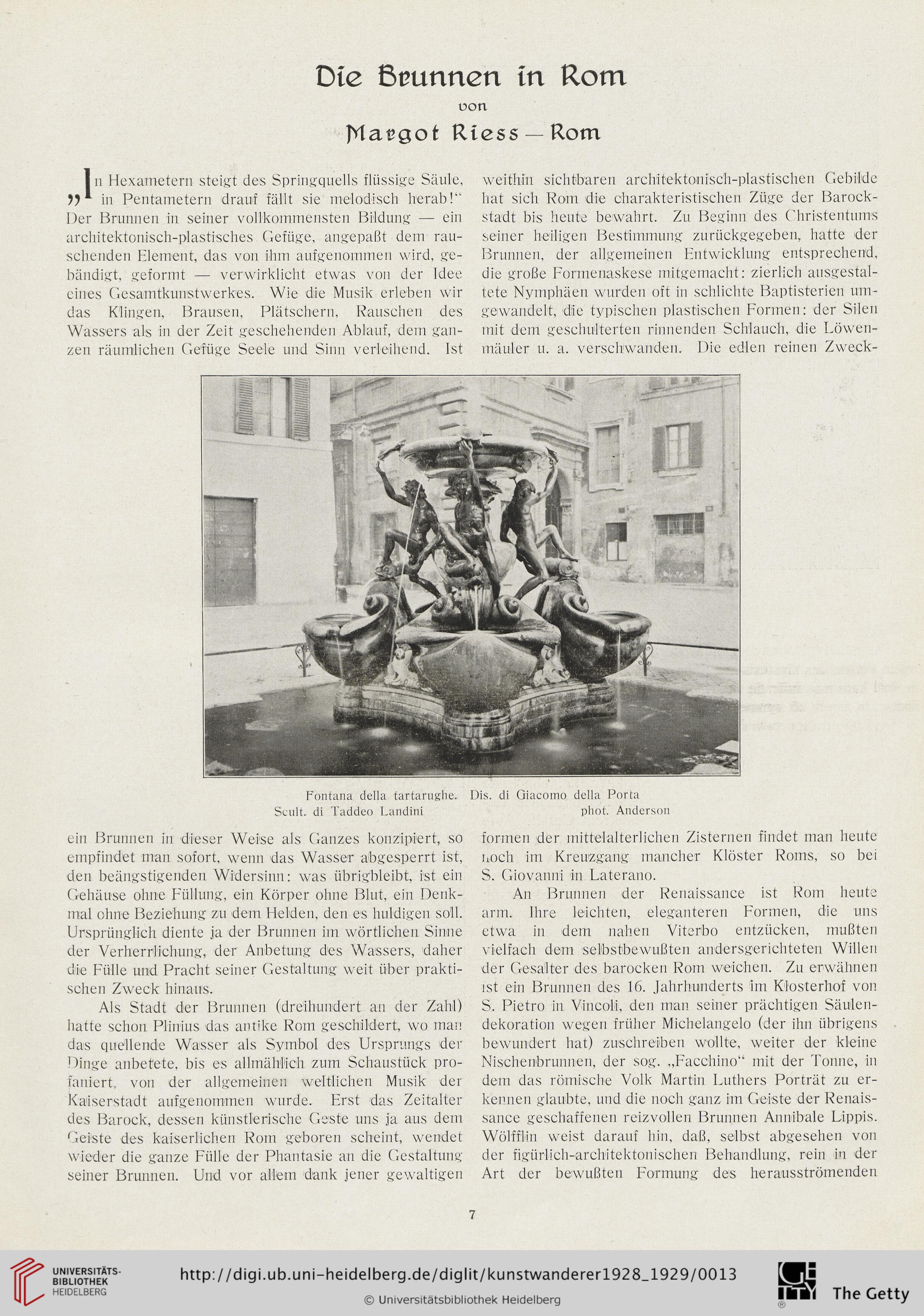Dte ßt’imnen in Rom
oon
MaVQot Riess —Rom
111 Hexametern steigt des Springquells flüssige Säule,
??1 in Pentametern drauf fällt sie melodlsch herab!“
Der Brunnen in seiner vollkommensten Bildung —- ein
architektonisch-plastisches Gefüge, angepaßt dem rau-
schenden Element, das von ihm aufgenommen wird, ge-
bändigt, geformt — verwirklicht etwas von der Idee
eines Gesamtkunstwerkes. Wie die Musik erleben wir
das Klingen, Brausen, Plätschern, Rauschen des
Wassers als in der Zeit geschehenden Abl'auf, dem gan-
zen räumlichen Gefüge Seele und Sinn verieihend. ist
weithin sichtbaren architektonisch-plastischen Gebiide
hat sich Rom die charakteristischen Züge der Barock-
stadt bis heute bewahrt. Zu Beginn des Christentums
seiner heitigen Bestimmung zurtickgegeben, hatte der
Brunnen, der allgemeinen Entwicklung entsprechend,
die große Formenaskese mitgemacht: zierlich ausgestal-
tete Nymphäen wurden oft in schlichte Baptisterien um-
geiwandelt, die typischen plastischen Formen: der Silen
mit dem geschuiterten rinnenden Schfauch, die Löwen-
mäuler u. a. verschwanden. I)ie edien reinen Zweck-
Fontana della tartarughe. Dis. di Giacomo della Porta
Scult. di Taddeo Landini
phot. Anderson
ein Brunnen in dieser Weise als Ganzes konzipiert, so
empfindet man sofort, wenn das Wasser abgesperrt ist,
den beängstigenden Widersinn: was übrigbleibt, ist ein
Gehäuse ohne Füllung, ein Körper ohne Blut, ein Denk-
mal ohne Beziehung zu dem Helden, den es huidigen soll.
Ursprünglich diente ja der Brunnen im wörtiichen Sinne
der Verherrlichung, der Anbetung des Wassers, daher
die Fülle und Pracht seiner Gestaltung weit übcr prakti-
schen Zweck hinaus.
Als Stadt der Brunnen (dreihundert an der Zahl)
hatte schon Piinius das antike Rom geschiidert, wo man
das quellende Wasser als Symbol des Ursprungs der
Dinge anbetete, bis es allmählich zum Schaustück pro-
faniert, von der allgemeinen weltlichen Musik der
kaiserstadt aufgenommen wurde. Erst das Zeitalter
des Barock, dessen künstlerische Geste uns ja aus dem
Geiste des kaiseriichen Rom geboren scheint, wendet
wieder die ganze Fülle der Phantasie an die Gestaltung
seiner Brunnen. Und vor attem dank jener gewaltigen
formen der mitteialterlichen Zisternen findet rnan heute
noch im Kreuzgang mancher Klöster Roms, so bei
S. Giovanni in Laterano.
An Brunnen der Renaissance ist Rom heute
arm. Ihre leichten, eleganteren Formeri, die uns
etwa in dem nahen Viterbo entzücken, mußten
vielfach dem selbstbewußten andersgerichteten Willen
der Gesälter des barocken Rom weichen. Zu erwähnen
lst ein Brunnen des 16. Jahrhunderts im Kiosterhof von
S. Pietro in Vincoli, den man seiner prächtigen Säulen-
dekoration wegen frülier Michelangelo (der ihn übrigens
bewundert hat) zuschreiben wollte, weiter der kleine
Nischenbrunnen, der sog. „Facchino“ mit der Tonne, in
dem das römische Volk Martin Luthers Porträt zu er-
kennen glaubte, uud die noch ganz im Geiste der Renais-
sance geschaffenen reizvollen Brunnen Anmibale Lippis.
Wölfflin weist darauf hin, daß, selbst abgesehen von
der figüriich-arcbitektonischen Behandlung, rein in der
Art der bewußten Formung des herausströmenden
7
oon
MaVQot Riess —Rom
111 Hexametern steigt des Springquells flüssige Säule,
??1 in Pentametern drauf fällt sie melodlsch herab!“
Der Brunnen in seiner vollkommensten Bildung —- ein
architektonisch-plastisches Gefüge, angepaßt dem rau-
schenden Element, das von ihm aufgenommen wird, ge-
bändigt, geformt — verwirklicht etwas von der Idee
eines Gesamtkunstwerkes. Wie die Musik erleben wir
das Klingen, Brausen, Plätschern, Rauschen des
Wassers als in der Zeit geschehenden Abl'auf, dem gan-
zen räumlichen Gefüge Seele und Sinn verieihend. ist
weithin sichtbaren architektonisch-plastischen Gebiide
hat sich Rom die charakteristischen Züge der Barock-
stadt bis heute bewahrt. Zu Beginn des Christentums
seiner heitigen Bestimmung zurtickgegeben, hatte der
Brunnen, der allgemeinen Entwicklung entsprechend,
die große Formenaskese mitgemacht: zierlich ausgestal-
tete Nymphäen wurden oft in schlichte Baptisterien um-
geiwandelt, die typischen plastischen Formen: der Silen
mit dem geschuiterten rinnenden Schfauch, die Löwen-
mäuler u. a. verschwanden. I)ie edien reinen Zweck-
Fontana della tartarughe. Dis. di Giacomo della Porta
Scult. di Taddeo Landini
phot. Anderson
ein Brunnen in dieser Weise als Ganzes konzipiert, so
empfindet man sofort, wenn das Wasser abgesperrt ist,
den beängstigenden Widersinn: was übrigbleibt, ist ein
Gehäuse ohne Füllung, ein Körper ohne Blut, ein Denk-
mal ohne Beziehung zu dem Helden, den es huidigen soll.
Ursprünglich diente ja der Brunnen im wörtiichen Sinne
der Verherrlichung, der Anbetung des Wassers, daher
die Fülle und Pracht seiner Gestaltung weit übcr prakti-
schen Zweck hinaus.
Als Stadt der Brunnen (dreihundert an der Zahl)
hatte schon Piinius das antike Rom geschiidert, wo man
das quellende Wasser als Symbol des Ursprungs der
Dinge anbetete, bis es allmählich zum Schaustück pro-
faniert, von der allgemeinen weltlichen Musik der
kaiserstadt aufgenommen wurde. Erst das Zeitalter
des Barock, dessen künstlerische Geste uns ja aus dem
Geiste des kaiseriichen Rom geboren scheint, wendet
wieder die ganze Fülle der Phantasie an die Gestaltung
seiner Brunnen. Und vor attem dank jener gewaltigen
formen der mitteialterlichen Zisternen findet rnan heute
noch im Kreuzgang mancher Klöster Roms, so bei
S. Giovanni in Laterano.
An Brunnen der Renaissance ist Rom heute
arm. Ihre leichten, eleganteren Formeri, die uns
etwa in dem nahen Viterbo entzücken, mußten
vielfach dem selbstbewußten andersgerichteten Willen
der Gesälter des barocken Rom weichen. Zu erwähnen
lst ein Brunnen des 16. Jahrhunderts im Kiosterhof von
S. Pietro in Vincoli, den man seiner prächtigen Säulen-
dekoration wegen frülier Michelangelo (der ihn übrigens
bewundert hat) zuschreiben wollte, weiter der kleine
Nischenbrunnen, der sog. „Facchino“ mit der Tonne, in
dem das römische Volk Martin Luthers Porträt zu er-
kennen glaubte, uud die noch ganz im Geiste der Renais-
sance geschaffenen reizvollen Brunnen Anmibale Lippis.
Wölfflin weist darauf hin, daß, selbst abgesehen von
der figüriich-arcbitektonischen Behandlung, rein in der
Art der bewußten Formung des herausströmenden
7