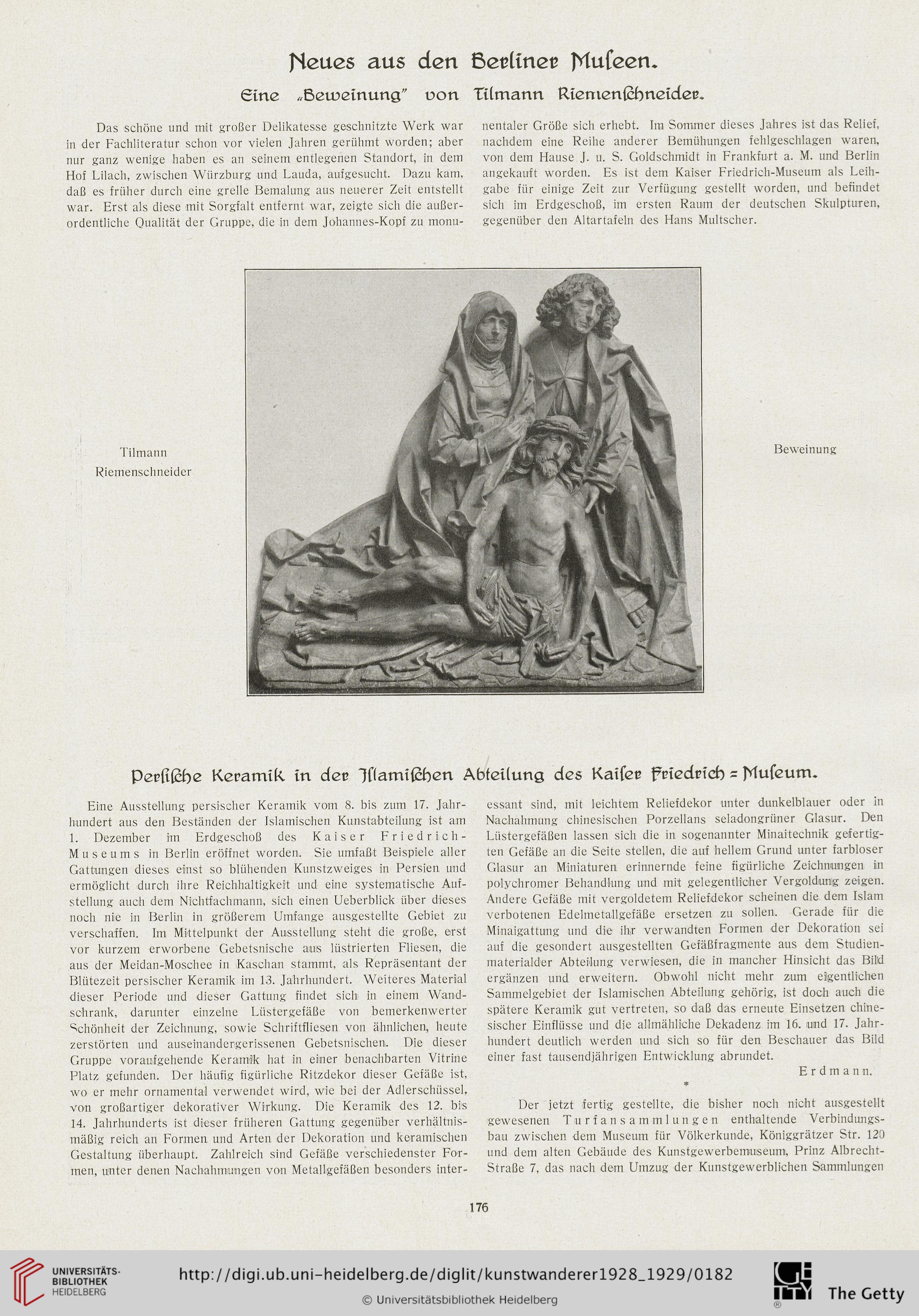JHeucs aus dcn jvtufccn.
Stne „BeiDeinurtg” oon Tilmann Rtemenlebnetdec.
Das 'schöne und mit großer Delikatesse geschnitzte Werk war
in der Fachliteratur schon vor viclen Jahren geriihmt worden; aber
nur ganz wenige haben es an seinem entlegenen Standort, in dem
Hof Lilach, zwischen Würzburg und Lauda, aufgesucht. Dazu kam,
daß es früher durch eine grelle Bemalung aus neuerer Zeit entstellt
war. Erst als diese mit Sorgfalt entfernt war, zeigte sich diie außer-
ordentliche Qualität der Gruppe, die in dem Johannes-Kopf zu monu-
nentaler Größe sich erhebt. im Sommer dieses Jahres ist das Relief,
nachdem eine Reihe anderer Bemiihungen fehlgeschlagen waren,
von dem Hause J. u. S. Goldschmidt in Frankfurt a. M. und Berlin
angekauft worden. Es ist dem Kaiser Friedrich-Museum als Leih-
gabe für einige Zeit zur Verfügung gestellt worden, und befindet
sich im Erdgeschoß, im ersten Raum der deutschen Skulpturen,
gegenüber den Altartafeln des Hans Multscher.
Pecdtcbe Keramik in det? Iflamifcben AbfeÜung des Kaifet? friedt’tcb = Mufeum.
Eine Ausstellung persischer Keramik vom 8. bis zum 17. Jahr-
hundert aus den Beständen der Islamischen Kunstabteilung ist am
1. Dezember im Erdgeschoß des Kaiser Friedrich-
Museums in Berlin eröffnet worden. Sie umfaßt Beispiele aller
Gattuingen dieses einst so bliihenden Kunstzweiges in Persien und
ermöglicht durch ihre Reichhaltigkeit und eine systematische Auf-
stellung auch dem Nichtfachmann, sich einen Ueberblick über dieses
noch nie in Berlin in größerem Umfange ausgestellte Gebiet zu
verschaffen. Im Mittelpunkt der Ausstellung steht die große, erst
vor kurzem erworbene Gebetsnische auis lüstrierten Fliesen, die
aus der Meidan-Moschee in Kaschan stammt, als Repräsentant der
Blütezeit persischer Keramik im 13. Jahrhundert. Weiteres Material
dieser Periode und dieser Gattung findet sich in einem Wand-
schrank, darunter einzelne Lüstergefäße von bemerkenwerter
Schönheit der Zeichnung, sowie Schriftfliesen von ähnlichen, heute
zerstörten und auseinanderigerissenen Gebetsnischen,. Die dieser
Gruppe vorauifgehende Keramik hat in eiiner benachbarten Vitrine
Platz gefunden. Der häufig figürliche Ritzdekor dieser Gefäße ist,
wo er mehr ornamental verwendet wird, wie bei der Adlerschüssel,
von großartiger dekorativer Wirkung. Die Keramik des 12. bis
14. Jahrhunderts ist dieser früheren Gattung gegeniiber verhältnis-
mäßig reich an Forrnen und Arten der Dekoration und keramischen
Gestaltung überhaupt. Zahlreich sind Gefäße verschiedenster For-
rnen, unter denen Nachahmungen von Metallgefäßen besonders inter-
essant sind, mit leichtem Reliefdekor unter dunkelblauer oder in
Nachahmung chinesischen Porzellans seladongrüner Glasur. Den
Lüstergefäßen lassen sich die in sogenannter Minaitechnik gefertig-
ten Gefäße an die Seite stellen, die auf hellem Grund unter farbloser
Glasur an Miniaturen erinnernde feine figürliche Zeichnungen in
polychromer Behandlung und mit gelegentlioher Vergoldunig zeigen.
Andere Gefäße mit vergoldetcm Reliefdekor scheinen die dem Islam
verbotenen Edelmetallgefäße ersetzen zu sollen. Gerade für die
Minaigattung und die ih,r verwandten Formen der Dekoration sei
auf die gesondert ausgestellten Gefäßfragmente aus dem Studien-
materialder Abteilung verwiesen, die in mancher Hinsicht das Bilid
ergänzen und erweitern. Obwohl nicht mehr zum eilgentlichen
Sammelgebiet der Islamischen Abteilung gehörig, ist doch auch die
spätere Keramik gut vertreten, so daß das erneute Einsetzen chine-
sischer Einflüsse und die allmähliche Dekadenz im 16. und 17. Jahr-
hundert deutlich werden und sich so für den Beschauer das Bild
einer fast tausendjährigen Entwicklung abrundet.
Erdmann.
*
Der jetzt fertiig gestellte, die bisher noch nioht ausgestellt
gewesenen Turfansammlungen enthaltende Verbindungs-
bau zwischen dem Museum für Völkerkunde, Königgrätzer Str. 120
und dem alten Gebäude des Kunstgewerbemuiseum, Prinz Albrecht-
Straße 7, das nach dem Umzug der Kunstgewerblichen Sammlungen
176
Stne „BeiDeinurtg” oon Tilmann Rtemenlebnetdec.
Das 'schöne und mit großer Delikatesse geschnitzte Werk war
in der Fachliteratur schon vor viclen Jahren geriihmt worden; aber
nur ganz wenige haben es an seinem entlegenen Standort, in dem
Hof Lilach, zwischen Würzburg und Lauda, aufgesucht. Dazu kam,
daß es früher durch eine grelle Bemalung aus neuerer Zeit entstellt
war. Erst als diese mit Sorgfalt entfernt war, zeigte sich diie außer-
ordentliche Qualität der Gruppe, die in dem Johannes-Kopf zu monu-
nentaler Größe sich erhebt. im Sommer dieses Jahres ist das Relief,
nachdem eine Reihe anderer Bemiihungen fehlgeschlagen waren,
von dem Hause J. u. S. Goldschmidt in Frankfurt a. M. und Berlin
angekauft worden. Es ist dem Kaiser Friedrich-Museum als Leih-
gabe für einige Zeit zur Verfügung gestellt worden, und befindet
sich im Erdgeschoß, im ersten Raum der deutschen Skulpturen,
gegenüber den Altartafeln des Hans Multscher.
Pecdtcbe Keramik in det? Iflamifcben AbfeÜung des Kaifet? friedt’tcb = Mufeum.
Eine Ausstellung persischer Keramik vom 8. bis zum 17. Jahr-
hundert aus den Beständen der Islamischen Kunstabteilung ist am
1. Dezember im Erdgeschoß des Kaiser Friedrich-
Museums in Berlin eröffnet worden. Sie umfaßt Beispiele aller
Gattuingen dieses einst so bliihenden Kunstzweiges in Persien und
ermöglicht durch ihre Reichhaltigkeit und eine systematische Auf-
stellung auch dem Nichtfachmann, sich einen Ueberblick über dieses
noch nie in Berlin in größerem Umfange ausgestellte Gebiet zu
verschaffen. Im Mittelpunkt der Ausstellung steht die große, erst
vor kurzem erworbene Gebetsnische auis lüstrierten Fliesen, die
aus der Meidan-Moschee in Kaschan stammt, als Repräsentant der
Blütezeit persischer Keramik im 13. Jahrhundert. Weiteres Material
dieser Periode und dieser Gattung findet sich in einem Wand-
schrank, darunter einzelne Lüstergefäße von bemerkenwerter
Schönheit der Zeichnung, sowie Schriftfliesen von ähnlichen, heute
zerstörten und auseinanderigerissenen Gebetsnischen,. Die dieser
Gruppe vorauifgehende Keramik hat in eiiner benachbarten Vitrine
Platz gefunden. Der häufig figürliche Ritzdekor dieser Gefäße ist,
wo er mehr ornamental verwendet wird, wie bei der Adlerschüssel,
von großartiger dekorativer Wirkung. Die Keramik des 12. bis
14. Jahrhunderts ist dieser früheren Gattung gegeniiber verhältnis-
mäßig reich an Forrnen und Arten der Dekoration und keramischen
Gestaltung überhaupt. Zahlreich sind Gefäße verschiedenster For-
rnen, unter denen Nachahmungen von Metallgefäßen besonders inter-
essant sind, mit leichtem Reliefdekor unter dunkelblauer oder in
Nachahmung chinesischen Porzellans seladongrüner Glasur. Den
Lüstergefäßen lassen sich die in sogenannter Minaitechnik gefertig-
ten Gefäße an die Seite stellen, die auf hellem Grund unter farbloser
Glasur an Miniaturen erinnernde feine figürliche Zeichnungen in
polychromer Behandlung und mit gelegentlioher Vergoldunig zeigen.
Andere Gefäße mit vergoldetcm Reliefdekor scheinen die dem Islam
verbotenen Edelmetallgefäße ersetzen zu sollen. Gerade für die
Minaigattung und die ih,r verwandten Formen der Dekoration sei
auf die gesondert ausgestellten Gefäßfragmente aus dem Studien-
materialder Abteilung verwiesen, die in mancher Hinsicht das Bilid
ergänzen und erweitern. Obwohl nicht mehr zum eilgentlichen
Sammelgebiet der Islamischen Abteilung gehörig, ist doch auch die
spätere Keramik gut vertreten, so daß das erneute Einsetzen chine-
sischer Einflüsse und die allmähliche Dekadenz im 16. und 17. Jahr-
hundert deutlich werden und sich so für den Beschauer das Bild
einer fast tausendjährigen Entwicklung abrundet.
Erdmann.
*
Der jetzt fertiig gestellte, die bisher noch nioht ausgestellt
gewesenen Turfansammlungen enthaltende Verbindungs-
bau zwischen dem Museum für Völkerkunde, Königgrätzer Str. 120
und dem alten Gebäude des Kunstgewerbemuiseum, Prinz Albrecht-
Straße 7, das nach dem Umzug der Kunstgewerblichen Sammlungen
176