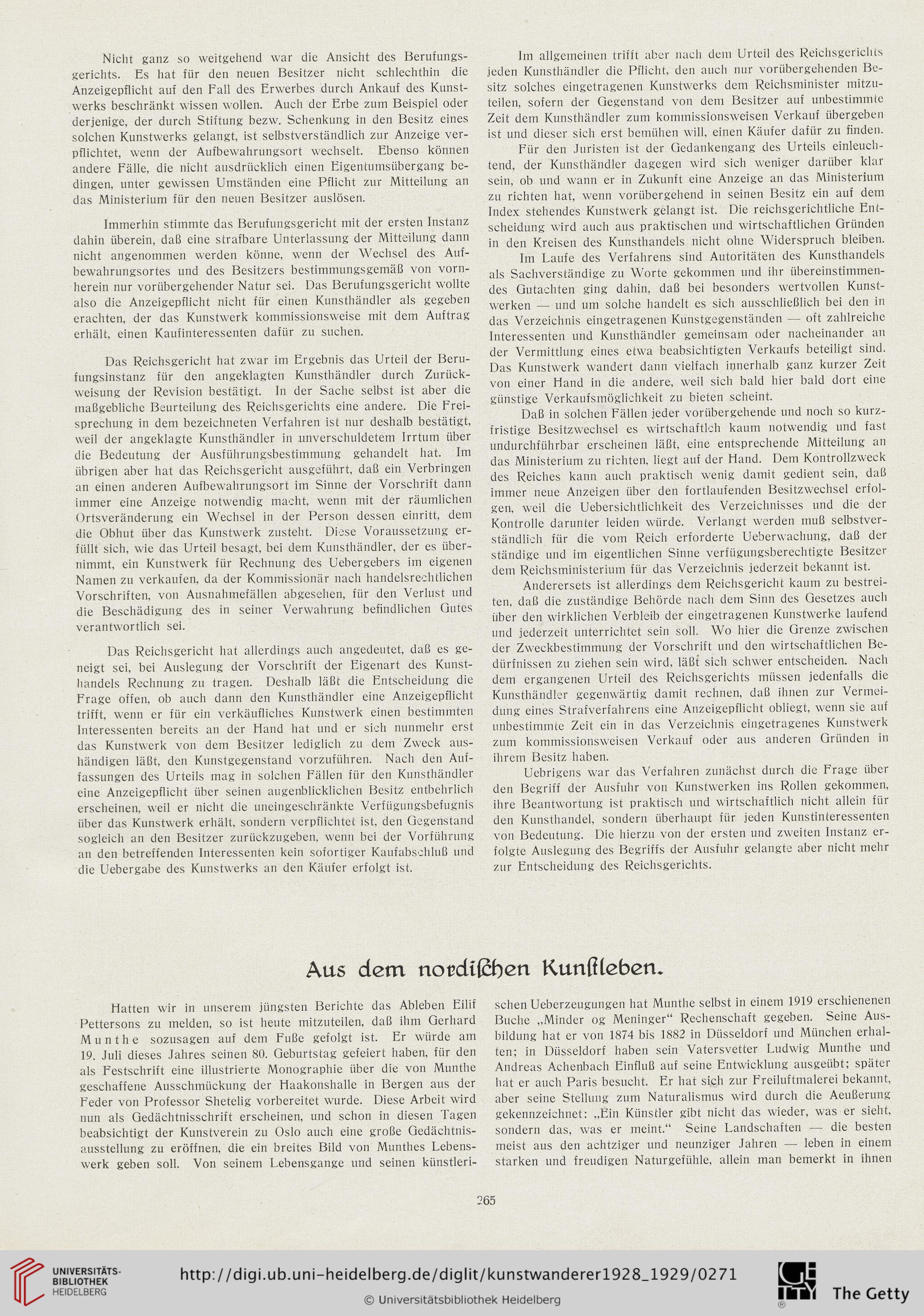Niclit ganz so weitgehend war die Ansicht des Berufungs-
gerichts. Es hat für den neuen Besitzer nicht schlechthin die
Anzeigepflicht auf den Fall des Erwerbes durch Ankauf des Kunst-
werks beschränkt wissen wollen. Auch der Erbe zum Beispiel oder
derjenige, der durch Stiftung bezw. Schenkung in den Besitz eines
solchen Kunstwerks gelangt, ist selbstverständlich zur Anzeige ver-
pflichtet, wenn der Aufbewahrungsort wechselt. Ebenso können
andere Fälle, die nicht ausdrücklich einen Eigentumsübergang be-
dingen, unter gewissen Umständen eine Pflicht zur Mitteilung an
das Ministerium fiir den neuen Besitzer auslösen.
Immerhin stimmte das Berufungsgericht mit der ersten Instanz
dahin iiberein, daß eine strafbare Unterlassung der Mitteilung dann
nicht angenommen werden könne, wenn der Wechsel des Auf-
bewalirungsortes und des Besitzers bestimmungsgemäß von vorn-
herein nur vorübcrgehender Natur sei. Das Berufungsgericht wollte
also die Anzeigepflicht nicht fiir einen Kunsthändler als gegeben
erachten, der das Kunstwerk kommissionsweise mit dem Auftrag
erhält, einen Kaufinteressenten dafiir zu suchen.
Das Reichsgericlit hat zwar im Ergebnis das Urteil der Beru-
fungsinstanz für den angeklagten Kunsthändler durch Zuriick-
weisung der Revision bestätigt. In der Sache selbst ist aber die
maßgebliche Beurteilung des Reichsgerichts eine andere. Die Frei-
sprechung in dem bezeichneten Verfahren ist nur deshalb bestätigt,
weil der angeklagte Kunsthändler in unverschuldetem Irrtum über
die Bedeutung der Ausfiihrungsbestimmung gehandelt hat. Im
iibrigen aber hat das Reichsgericht ausgeführt, daß ein Verbringen
an einen anderen Aufbewahrungsort im Sinne der Vorschrift dann
immer eine Anzeige notwendig macht, wenn mit der räumlichen
(Jrtsveränderung ein Wechsel in der Pcrson dessen einritt, dem
die Obhut übcr das Kunstwcrk zusteht. Dicse Voraussetzung er-
fiillt sich, wie das Urteil besagt, bei dem Kunsthändler, der es über-
nimmt, ein Kunstwerk für Rechnung des Uebergcbers im eigenen
Namen zu verkaufen, da der Kommissionär nacli handelsreehtlichen
Vorschriften, von Ausnahmefällen abgesehen, für den Verlust und
die Beschädigung des in seiner Verwahrung befindlichen Qutes
verantwortlich sei.
Das Reiclisgericht hat allerdings auch angedeutct, daß es ge-
neigt sei, bei Auslegung der Vorschrift der Eigenart des Kunst-
handels Rechnung zu tragen. Dcshalb läßt die Entscheidung die
Frage offen, ob auch dann den Kunsthändler eine Anzeigepflicht
trifft, wenn er für ein verkäufliches Kunstwerk einen bestimmten
Interessenten bereits an der Hand hat und er sich nunmehr crst
das Kunstwerk von dem Besitzer lediglich zu dem Zweck aus-
händigen läßt, den Kunstgegenstand vorzufiihren. Nacli den Auf-
fassungen des Urteils mag in soichen Fällen fiir den Kunsthändler
eine Anzeigepflicht über seinen augenblicklichen Besitz entbehrlich
erscheinen, weil er nicht die uneingeschränkte Verfügungsbefugnis
iiber das Kunstwerk erliält, sondern verpfliehtet ist, den Qegenstand
sogleich an den Besitzer zurückzugeben, wenn bei der Vorführung
an den betreffenden Interessenten kein sofortiger Kaufabschluß und
die Uebcrgabe des Kunstwerks an den Käufer erfolgt ist.
Im allgemeinen trifft aber nacli dem Urteil des Reichsgerichls
jeden Kunsthändler die Pflicht, dcn auch nur voriibergelienden Be-
sitz solches eingetragenen Kunstwerks dem Reichsminister mitzu-
teilen, sofern der Qegenstand von dcm Bcsitzer auf unbestimmte
Zeit dem Kunsthändler zum kommissionsweisen Verkauf übergeben
ist und dieser sich erst bemühen will, einen Käufer dafür zu finden.
Für den Juristen ist der Gedankengang des Urteils einleuch-
tend, der Kunsthändler dagegen wird sich weniger darüber klar
sein, ob und wann er in Zukunft eine Anzeige an das Ministerium
zu richten hat, wenn vorübergehend in seinen Besitz ein auf dem
Index stehendes Kunstwerk gelangt ist. Die reichsgerichtliche Ent-
scheidung wird auch aus praktischen und wirtschaftlichen Griinden
in den Kreisen des Kunsthandels nicht ohne Widerspruch bleiben.
Im Laufe des Verfahrens sind Autoritäten des Kunsthandels
als Sachverständige zu Worte gekommen und ihr iibereinstimmen-
des Qutachten ging dahin, daß bei besonders wertvollen Kunst-
werken — und um solche handclt es sich ausschlicßlich bei den in
das Verzeichnis eingetragenen Kunstgegenständen — oft zahlreiche
Interessenten und Kunsthändler gemeinsam oder nacheinander an
der Vermittlung cines etwa beabsichtigten Verkaufs beteiligt sind.
Das Kunstwerk wandert dann vielfach innerhalb ganz kurzer Zeit
von einer Hand in die andere, weil sich bald liier bald dort eine
günstige Verkaufsmögliehkeit zu bieten scheint.
Daß in solchen Fällen jeder vorübergehende und noch so kurz-
fristige Besitzwechsel es wirtschaftleh kaum notwendig und fast
undurchführbar erscheinen läßt, eine entsprechende Mitteilung an
das Ministerium zu richten, liegt auf der Hand. Dem Kontrollzweck
des Reiches kann auch praktisch wenig damit gedient sein, daß
immer neue Anzeigen über den fortlaufenden Besitzwechsel erfol-
gen, weil die Uebersichtlichkeit des Verzeichnisses und die der
Kontrolle darunter leiden würde. Verlangt werden muß selbstver-
ständlieh für die vom Reich erforderte Ueberwachung, daß der
ständige und im eigentlichen Sinne verfügungsberechtigte Besitzer
dem Reichsministerium für das Verzeichnis jederzeit bekannt ist.
Anderersets ist allerdings dem Reichsgericht kaum zu bestrei-
ten, daß die zuständige Behördc nacli dem Sinn des Qesetzes aucli
über den wirklichen Vcrbleib der eingetragenen Kunstwcrke laufend
und jederzeit unterrichtet sein soll. Wo hier die Qrenze zwischen
der Zweckbestimmung der Vorschrift und den wirtschaftlichen Be-
dürfnissen zu ziehen sein wird, läßt sich schwer entscheiden. Nach
dem ergangenen Urteil des Reichsgerichts müssen jedenfalls die
Kunsthändler gegenwärtig damit rechnen, daß ihnen zur Vermei-
dung eines Strafverfahrens eine Anzeigepflicht obliegt, wenn sie auf
unbestimmte Zeit ein in das Verzeichnis eingetragenes Kunstwerk
zum kommissionsweisen Verkauf oder aus anderen Qründen in
ihrcm Besitz haben.
Uebrigens war das Verfahren zunächst durch die Frage über
den Begriff der Ausfuhr von Kunstwerken ins Rollen gekommen,
ihre Beantwortung ist praktiseh und wirtschaftlich nicht allein ftir
den Kunsthandel, sondern überhaupt für jeden Kunstinteressenten
von Bedeutung. Die hierzu von der ersten und zweiten Instanz er-
folgte Auslegung des Begriffs der Ausfuhr gelangte aber nicht mehr
zur Entscheidung des Reichsgerichts.
Aus dem not?di(ct)cn Kunßleben.
Hatten wir in unserem jüngsten Berichte das Ableben Eilif
Pettersons zu melden, so ist heute mitzuteilen, daß ihm Qerhard
M u n t h e sozusagen auf dem Fuße gefolgt ist. Er würde am
19. Juli dieses Jahres seinen 80. Qeburtstag gefeiert haben, für den
als Festschrift eine illustrierte Monographie iiber die von Munthe
geschaffene Ausschmückung der Haakonshalle in Bergen aus der
Feder von Professor Shetelig vorbereitet wurde. Diese Arbeit wird
nun als Gedächtnisschrift erscheinen, und schon in diesen Tagen
beabsichtigt der Kunstverein zu Oslo auch eine große Qedächtnis-
ausstellung zu eröffnen, die ein breites Bild von Munthes Lebens-
werk geben soll. Von seinem Lebensgange und seinen künstleri-
schen Ueberzeugungen hat Munthe selbst in einem 1919 erschienenen
Buche „Minder og Meninger“ Reehenschaft gegeben. Seine Aus-
bildung hat er von 1874 bis 1882 in Düsseldorf und München erhal-
ten; in Düsseldorf haben sein Vatersvetter Ludwig Munthe und
Andreas Achenbach Einfluß auf seine Entwicklung ausgeübt; später
hat er auch Paris besucht. Er hat sich zur Freiluftmalerei bekannt,
aber seine Stellung zum Naturalismus wird durch die Aeußerung
gekennzeichnet: „Ein Künstler gibt nicht das wieder, was er sieht,
sondern das, was er meint.“ Seine Landschaften — die besten
meist aus den achtziger und neunziger Jahren — leben in einem
starken und freudigen Naturgefühle, ailein man bemerkt in ihnen
265
gerichts. Es hat für den neuen Besitzer nicht schlechthin die
Anzeigepflicht auf den Fall des Erwerbes durch Ankauf des Kunst-
werks beschränkt wissen wollen. Auch der Erbe zum Beispiel oder
derjenige, der durch Stiftung bezw. Schenkung in den Besitz eines
solchen Kunstwerks gelangt, ist selbstverständlich zur Anzeige ver-
pflichtet, wenn der Aufbewahrungsort wechselt. Ebenso können
andere Fälle, die nicht ausdrücklich einen Eigentumsübergang be-
dingen, unter gewissen Umständen eine Pflicht zur Mitteilung an
das Ministerium fiir den neuen Besitzer auslösen.
Immerhin stimmte das Berufungsgericht mit der ersten Instanz
dahin iiberein, daß eine strafbare Unterlassung der Mitteilung dann
nicht angenommen werden könne, wenn der Wechsel des Auf-
bewalirungsortes und des Besitzers bestimmungsgemäß von vorn-
herein nur vorübcrgehender Natur sei. Das Berufungsgericht wollte
also die Anzeigepflicht nicht fiir einen Kunsthändler als gegeben
erachten, der das Kunstwerk kommissionsweise mit dem Auftrag
erhält, einen Kaufinteressenten dafiir zu suchen.
Das Reichsgericlit hat zwar im Ergebnis das Urteil der Beru-
fungsinstanz für den angeklagten Kunsthändler durch Zuriick-
weisung der Revision bestätigt. In der Sache selbst ist aber die
maßgebliche Beurteilung des Reichsgerichts eine andere. Die Frei-
sprechung in dem bezeichneten Verfahren ist nur deshalb bestätigt,
weil der angeklagte Kunsthändler in unverschuldetem Irrtum über
die Bedeutung der Ausfiihrungsbestimmung gehandelt hat. Im
iibrigen aber hat das Reichsgericht ausgeführt, daß ein Verbringen
an einen anderen Aufbewahrungsort im Sinne der Vorschrift dann
immer eine Anzeige notwendig macht, wenn mit der räumlichen
(Jrtsveränderung ein Wechsel in der Pcrson dessen einritt, dem
die Obhut übcr das Kunstwcrk zusteht. Dicse Voraussetzung er-
fiillt sich, wie das Urteil besagt, bei dem Kunsthändler, der es über-
nimmt, ein Kunstwerk für Rechnung des Uebergcbers im eigenen
Namen zu verkaufen, da der Kommissionär nacli handelsreehtlichen
Vorschriften, von Ausnahmefällen abgesehen, für den Verlust und
die Beschädigung des in seiner Verwahrung befindlichen Qutes
verantwortlich sei.
Das Reiclisgericht hat allerdings auch angedeutct, daß es ge-
neigt sei, bei Auslegung der Vorschrift der Eigenart des Kunst-
handels Rechnung zu tragen. Dcshalb läßt die Entscheidung die
Frage offen, ob auch dann den Kunsthändler eine Anzeigepflicht
trifft, wenn er für ein verkäufliches Kunstwerk einen bestimmten
Interessenten bereits an der Hand hat und er sich nunmehr crst
das Kunstwerk von dem Besitzer lediglich zu dem Zweck aus-
händigen läßt, den Kunstgegenstand vorzufiihren. Nacli den Auf-
fassungen des Urteils mag in soichen Fällen fiir den Kunsthändler
eine Anzeigepflicht über seinen augenblicklichen Besitz entbehrlich
erscheinen, weil er nicht die uneingeschränkte Verfügungsbefugnis
iiber das Kunstwerk erliält, sondern verpfliehtet ist, den Qegenstand
sogleich an den Besitzer zurückzugeben, wenn bei der Vorführung
an den betreffenden Interessenten kein sofortiger Kaufabschluß und
die Uebcrgabe des Kunstwerks an den Käufer erfolgt ist.
Im allgemeinen trifft aber nacli dem Urteil des Reichsgerichls
jeden Kunsthändler die Pflicht, dcn auch nur voriibergelienden Be-
sitz solches eingetragenen Kunstwerks dem Reichsminister mitzu-
teilen, sofern der Qegenstand von dcm Bcsitzer auf unbestimmte
Zeit dem Kunsthändler zum kommissionsweisen Verkauf übergeben
ist und dieser sich erst bemühen will, einen Käufer dafür zu finden.
Für den Juristen ist der Gedankengang des Urteils einleuch-
tend, der Kunsthändler dagegen wird sich weniger darüber klar
sein, ob und wann er in Zukunft eine Anzeige an das Ministerium
zu richten hat, wenn vorübergehend in seinen Besitz ein auf dem
Index stehendes Kunstwerk gelangt ist. Die reichsgerichtliche Ent-
scheidung wird auch aus praktischen und wirtschaftlichen Griinden
in den Kreisen des Kunsthandels nicht ohne Widerspruch bleiben.
Im Laufe des Verfahrens sind Autoritäten des Kunsthandels
als Sachverständige zu Worte gekommen und ihr iibereinstimmen-
des Qutachten ging dahin, daß bei besonders wertvollen Kunst-
werken — und um solche handclt es sich ausschlicßlich bei den in
das Verzeichnis eingetragenen Kunstgegenständen — oft zahlreiche
Interessenten und Kunsthändler gemeinsam oder nacheinander an
der Vermittlung cines etwa beabsichtigten Verkaufs beteiligt sind.
Das Kunstwerk wandert dann vielfach innerhalb ganz kurzer Zeit
von einer Hand in die andere, weil sich bald liier bald dort eine
günstige Verkaufsmögliehkeit zu bieten scheint.
Daß in solchen Fällen jeder vorübergehende und noch so kurz-
fristige Besitzwechsel es wirtschaftleh kaum notwendig und fast
undurchführbar erscheinen läßt, eine entsprechende Mitteilung an
das Ministerium zu richten, liegt auf der Hand. Dem Kontrollzweck
des Reiches kann auch praktisch wenig damit gedient sein, daß
immer neue Anzeigen über den fortlaufenden Besitzwechsel erfol-
gen, weil die Uebersichtlichkeit des Verzeichnisses und die der
Kontrolle darunter leiden würde. Verlangt werden muß selbstver-
ständlieh für die vom Reich erforderte Ueberwachung, daß der
ständige und im eigentlichen Sinne verfügungsberechtigte Besitzer
dem Reichsministerium für das Verzeichnis jederzeit bekannt ist.
Anderersets ist allerdings dem Reichsgericht kaum zu bestrei-
ten, daß die zuständige Behördc nacli dem Sinn des Qesetzes aucli
über den wirklichen Vcrbleib der eingetragenen Kunstwcrke laufend
und jederzeit unterrichtet sein soll. Wo hier die Qrenze zwischen
der Zweckbestimmung der Vorschrift und den wirtschaftlichen Be-
dürfnissen zu ziehen sein wird, läßt sich schwer entscheiden. Nach
dem ergangenen Urteil des Reichsgerichts müssen jedenfalls die
Kunsthändler gegenwärtig damit rechnen, daß ihnen zur Vermei-
dung eines Strafverfahrens eine Anzeigepflicht obliegt, wenn sie auf
unbestimmte Zeit ein in das Verzeichnis eingetragenes Kunstwerk
zum kommissionsweisen Verkauf oder aus anderen Qründen in
ihrcm Besitz haben.
Uebrigens war das Verfahren zunächst durch die Frage über
den Begriff der Ausfuhr von Kunstwerken ins Rollen gekommen,
ihre Beantwortung ist praktiseh und wirtschaftlich nicht allein ftir
den Kunsthandel, sondern überhaupt für jeden Kunstinteressenten
von Bedeutung. Die hierzu von der ersten und zweiten Instanz er-
folgte Auslegung des Begriffs der Ausfuhr gelangte aber nicht mehr
zur Entscheidung des Reichsgerichts.
Aus dem not?di(ct)cn Kunßleben.
Hatten wir in unserem jüngsten Berichte das Ableben Eilif
Pettersons zu melden, so ist heute mitzuteilen, daß ihm Qerhard
M u n t h e sozusagen auf dem Fuße gefolgt ist. Er würde am
19. Juli dieses Jahres seinen 80. Qeburtstag gefeiert haben, für den
als Festschrift eine illustrierte Monographie iiber die von Munthe
geschaffene Ausschmückung der Haakonshalle in Bergen aus der
Feder von Professor Shetelig vorbereitet wurde. Diese Arbeit wird
nun als Gedächtnisschrift erscheinen, und schon in diesen Tagen
beabsichtigt der Kunstverein zu Oslo auch eine große Qedächtnis-
ausstellung zu eröffnen, die ein breites Bild von Munthes Lebens-
werk geben soll. Von seinem Lebensgange und seinen künstleri-
schen Ueberzeugungen hat Munthe selbst in einem 1919 erschienenen
Buche „Minder og Meninger“ Reehenschaft gegeben. Seine Aus-
bildung hat er von 1874 bis 1882 in Düsseldorf und München erhal-
ten; in Düsseldorf haben sein Vatersvetter Ludwig Munthe und
Andreas Achenbach Einfluß auf seine Entwicklung ausgeübt; später
hat er auch Paris besucht. Er hat sich zur Freiluftmalerei bekannt,
aber seine Stellung zum Naturalismus wird durch die Aeußerung
gekennzeichnet: „Ein Künstler gibt nicht das wieder, was er sieht,
sondern das, was er meint.“ Seine Landschaften — die besten
meist aus den achtziger und neunziger Jahren — leben in einem
starken und freudigen Naturgefühle, ailein man bemerkt in ihnen
265