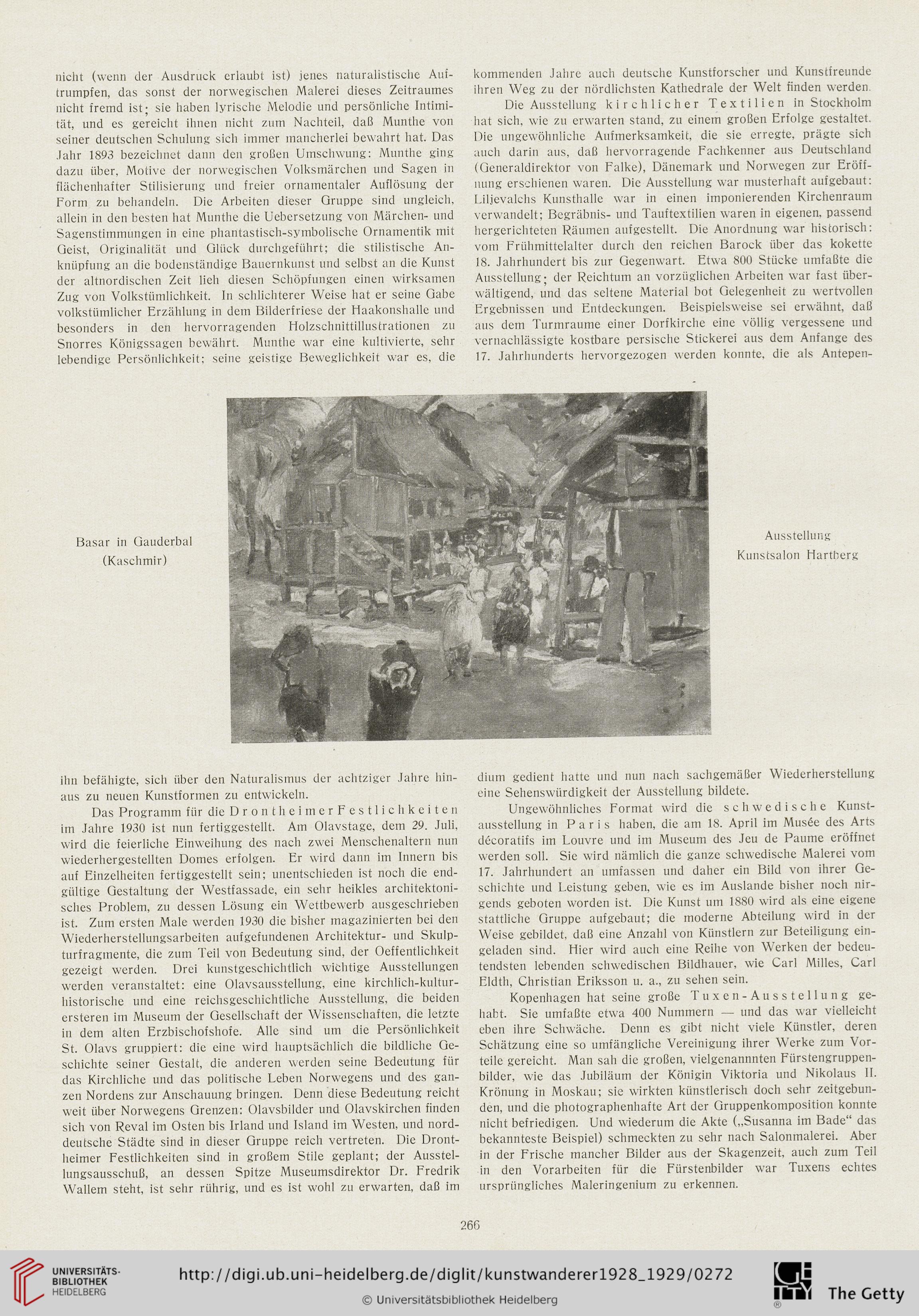nicht (wenn der Ausdruck erlaubt ist) jenes naturalistische Auf-
trumpfen, das sonst der norwegischen Malerei dieses Zeitraumes
nicht fremd ist; sie haben lyrische Melodie und persönliche Intimi-
tät, und es gercicht ihnen nicht zum Nachteil, daß Munthe von
seiner deutschen Schulung sich immer mancherlei bewahrt hat. Das
Jahr 1893 bezeiclmet dann den großen Umschwung: Munthe ging
dazu iiber, Motive der norwegischen Volksmärchen und Sagen in
flächenhafter Stilisierung und freier ornamentaler Auflösung der
Form zu behandeln. Die Arbeiten dieser Qruppe sind ungleich,
allein in den besten liat Munthe die Uebcrsetzung von Märchen- und
Sagenstimmungen in eine phantastisch-symbolische Ornamentik mit
Qeist, Originalität und üliick durcligeführt; die stilistische An-
kniipfung an dic bodenständige Bauernkunst und selbst an die Kunst
der altnordischen Zeit lieh diesen Schöpfungen einen wirksamen
Zug von Volkstiimlichkeit. In schlichterer Weise hat cr seine Qabe
volkstümlicher Erzählung in dem Bilderfriese der Haakonshalle und
besonders in den hervorragenden Holzschnittillustrationen zu
Snorres Königssagen bewährt. Munthe war eine kultivierte, sehr
lebendige Persönlichkeit; seine geistige Beweglichkeit war es, die
kommenden Jahre auch deutsche Kunstforscher und Kunstfreunde
ihren Weg zu der nördlichsten Kathedrale der Welt finden werden.
Die Ausstellung kirchlicher Textilien in Stockholm
hat sich, wie zu erwarten stand, zu einein großen Erfolge gestaltet.
Die ungewöhnliche Aufmerksamkeit, die sie erregte, prägte sich
auch darin aus, daß hervorragende Fachkenner aus Deutschland
(Qeneraldirektor von Falkc), Dänemark und Norwegen zur Eröff-
nung ersehicnen waren. Die Ausstellung war musterhaft aufgebaut:
Liljevalchs Kunsthalle war in einen imponierenden Kirchenraum
verwandelt; Begräbnis- und Tauftextilien waren in eigenen, passend
hcrgerichteten Räumen aufgestellt. Die Anordnung war historisch:
vom Frühmittelalter durch den reichen Barock über das kokette
18. Jahrhundert bis zur Gegenwart. Etwa 800 Stücke umfaßte die
Ausstellung; der Reichtum an vorzüglichen Arbeiten war fast über-
wältigend, und das seltene Material bot Qelegenheit zu wertvollen
Ergebnissen und Entdeckungen. Beispielsweise sei erwähnt, daß
aus dem 'I'urmraume einer Dorfkirche eine völlig vergessene und
vernachlässigte kostbare persische Stickerei aus dem Anfange des
17. Jahrhunderts hervorgezogen werden konnte, die als Antepen-
Basar in Gauderbal
(Kaschmir)
Ausstellung
Kunstsalon Hartberg
ihn befähigtc, sich liber den Naturalismus der achtziger Jahre hin-
aus zu neuen Kunstformen zu entwickeln.
Das Programm fürdieDrontheimerFestlichkeiten
im Jahre 1930 ist nun fertiggestellt. Am Olavstage, dem 29. Juli,
wird die feierliche Einweihung des nach zwei Menschenaltern nun
wiederhergestellten Domes erfolgen. Er wird dann im Innern bis
auf Einzelheiten fertiggestellt sein; unentschieden ist noch die end-
gtiltige Gestaltung der Westfassade, ein sehr heikles architektoni-
sclies Problem, zu dessen Lösung ein Wettbewerb ausgeschrieben
ist. Zum ersten Male werden 1930 die bisher magazinierten bei den
Wiederherstellungsarbeiten aufgefundenen Architektur- und Skulp-
turfragmente, die zum Teil von Bedeutung sind, der Oeffentlichkeit
gezeigt werden. Drei kunstgeschichtlich wichtige Ausstellungen
werden veranstaltet: eine Olavsausstellung, eine kirchlich-kultur-
liistorische und eine reichsgeschichtliche Ausstellung, die beiden
ersteren im Museum der Qesellschaft der Wissenschaften, die letzte
in dem alten Erzbischofshofe. Alle sind um die Persönlichkeit
St. Olavs gruppiert: die eine wird hauptsächlich die bildliche Qe-
schichte seiner Gestalt, die anderen werden seine Bedeutung für
das Kirchliche und das politische Leben Norwegens und des gan-
zen Nordens zur Anschauung bringen. Denn diese Bedeutung reicht
weit über Norwegens Qrenzen: Olavsbilder und Olavskirchen finden
sich von Reval im Osten bis Irland und Island im Westen, und nord-
deutsche Städte sind in dieser Qruppe reich vertreten. Die Dront-
heimer Festlichkeiten sind in großem Stile geplant; der Ausstel-
lungsausschuß, an dessen Spitze Museumsdirektor Dr. Fredrik
Wallem steht, ist sehr rührig, und es ist wohl zu erwarten, daß im
diurn gedient liatte und nun nach sachgemäßer Wiederherstellung
eine Sehenswürdigkeit der Ausstellung bildete.
Ungewöhnliches Format wird die schwedische Kunst-
ausstellung in P a r i s haben, die am 18. April im Mus6e des Arts
decoratifs im Louvre und im Museum des Jeu de Paume eröffnet
werden soll. Sie wird nämlich die ganze schwedische Malerei vom
17. Jahrhundert an umfassen und daher ein Bild von ihrer Qe-
schichte und Leistung geben, wie es im Auslande bisher noch nir-
gends geboten worden ist. Die Kunst um 1880 wird als eine eigene
stattliche Qruppe aufgebaut; die moderne Abteilung wird in der
Weise gebildet, daß eine Anzahl von Kiinstlern zur Beteiligung ein-
geladen sind. Hier wird auch eine Reihe von Werken der bedeu-
tendsten lebenden schwedischen Bildhauer, wie Carl Milles, Carl
Eldth, Christian Eriksson u. a., zu sehen sein.
Kopenhagen hat seine große Tuxen-Ausstellung ge-
habt. Sie umfaßtc etwa 400 Nummern — und das war vielleicht
eben ihre Schwäche. Denn es gibt nicht viele Künstler, deren
Schätzung eine so umfängliche Vereinigung ihrer Werke zum Vor-
teile gereicht. Man sah dic großen, vielgenannnten Fürstengruppen-
bilder, wie das Jubiläum der Königin Viktoria und Nikolaus II.
Krönung in Moskau; sie wirkten künstlerisch doch sehr zeitgebun-
den, und die photographenhafte Art der Gruppenkomposition konnte
nicht befriedigen. Und wiederum die Akte („Susanna im Bade“ das
bekannteste Beispiel) schmeckten zu sehr nach Salonmalerei. Aber
in der Frische mancher Bilder aus der Skagenzeit, auch zum Teil
in den Vorarbeiten für die Fürstenbilder war Tuxens echtes
urspriingliches Maleringenium zu erkennen.
266
trumpfen, das sonst der norwegischen Malerei dieses Zeitraumes
nicht fremd ist; sie haben lyrische Melodie und persönliche Intimi-
tät, und es gercicht ihnen nicht zum Nachteil, daß Munthe von
seiner deutschen Schulung sich immer mancherlei bewahrt hat. Das
Jahr 1893 bezeiclmet dann den großen Umschwung: Munthe ging
dazu iiber, Motive der norwegischen Volksmärchen und Sagen in
flächenhafter Stilisierung und freier ornamentaler Auflösung der
Form zu behandeln. Die Arbeiten dieser Qruppe sind ungleich,
allein in den besten liat Munthe die Uebcrsetzung von Märchen- und
Sagenstimmungen in eine phantastisch-symbolische Ornamentik mit
Qeist, Originalität und üliick durcligeführt; die stilistische An-
kniipfung an dic bodenständige Bauernkunst und selbst an die Kunst
der altnordischen Zeit lieh diesen Schöpfungen einen wirksamen
Zug von Volkstiimlichkeit. In schlichterer Weise hat cr seine Qabe
volkstümlicher Erzählung in dem Bilderfriese der Haakonshalle und
besonders in den hervorragenden Holzschnittillustrationen zu
Snorres Königssagen bewährt. Munthe war eine kultivierte, sehr
lebendige Persönlichkeit; seine geistige Beweglichkeit war es, die
kommenden Jahre auch deutsche Kunstforscher und Kunstfreunde
ihren Weg zu der nördlichsten Kathedrale der Welt finden werden.
Die Ausstellung kirchlicher Textilien in Stockholm
hat sich, wie zu erwarten stand, zu einein großen Erfolge gestaltet.
Die ungewöhnliche Aufmerksamkeit, die sie erregte, prägte sich
auch darin aus, daß hervorragende Fachkenner aus Deutschland
(Qeneraldirektor von Falkc), Dänemark und Norwegen zur Eröff-
nung ersehicnen waren. Die Ausstellung war musterhaft aufgebaut:
Liljevalchs Kunsthalle war in einen imponierenden Kirchenraum
verwandelt; Begräbnis- und Tauftextilien waren in eigenen, passend
hcrgerichteten Räumen aufgestellt. Die Anordnung war historisch:
vom Frühmittelalter durch den reichen Barock über das kokette
18. Jahrhundert bis zur Gegenwart. Etwa 800 Stücke umfaßte die
Ausstellung; der Reichtum an vorzüglichen Arbeiten war fast über-
wältigend, und das seltene Material bot Qelegenheit zu wertvollen
Ergebnissen und Entdeckungen. Beispielsweise sei erwähnt, daß
aus dem 'I'urmraume einer Dorfkirche eine völlig vergessene und
vernachlässigte kostbare persische Stickerei aus dem Anfange des
17. Jahrhunderts hervorgezogen werden konnte, die als Antepen-
Basar in Gauderbal
(Kaschmir)
Ausstellung
Kunstsalon Hartberg
ihn befähigtc, sich liber den Naturalismus der achtziger Jahre hin-
aus zu neuen Kunstformen zu entwickeln.
Das Programm fürdieDrontheimerFestlichkeiten
im Jahre 1930 ist nun fertiggestellt. Am Olavstage, dem 29. Juli,
wird die feierliche Einweihung des nach zwei Menschenaltern nun
wiederhergestellten Domes erfolgen. Er wird dann im Innern bis
auf Einzelheiten fertiggestellt sein; unentschieden ist noch die end-
gtiltige Gestaltung der Westfassade, ein sehr heikles architektoni-
sclies Problem, zu dessen Lösung ein Wettbewerb ausgeschrieben
ist. Zum ersten Male werden 1930 die bisher magazinierten bei den
Wiederherstellungsarbeiten aufgefundenen Architektur- und Skulp-
turfragmente, die zum Teil von Bedeutung sind, der Oeffentlichkeit
gezeigt werden. Drei kunstgeschichtlich wichtige Ausstellungen
werden veranstaltet: eine Olavsausstellung, eine kirchlich-kultur-
liistorische und eine reichsgeschichtliche Ausstellung, die beiden
ersteren im Museum der Qesellschaft der Wissenschaften, die letzte
in dem alten Erzbischofshofe. Alle sind um die Persönlichkeit
St. Olavs gruppiert: die eine wird hauptsächlich die bildliche Qe-
schichte seiner Gestalt, die anderen werden seine Bedeutung für
das Kirchliche und das politische Leben Norwegens und des gan-
zen Nordens zur Anschauung bringen. Denn diese Bedeutung reicht
weit über Norwegens Qrenzen: Olavsbilder und Olavskirchen finden
sich von Reval im Osten bis Irland und Island im Westen, und nord-
deutsche Städte sind in dieser Qruppe reich vertreten. Die Dront-
heimer Festlichkeiten sind in großem Stile geplant; der Ausstel-
lungsausschuß, an dessen Spitze Museumsdirektor Dr. Fredrik
Wallem steht, ist sehr rührig, und es ist wohl zu erwarten, daß im
diurn gedient liatte und nun nach sachgemäßer Wiederherstellung
eine Sehenswürdigkeit der Ausstellung bildete.
Ungewöhnliches Format wird die schwedische Kunst-
ausstellung in P a r i s haben, die am 18. April im Mus6e des Arts
decoratifs im Louvre und im Museum des Jeu de Paume eröffnet
werden soll. Sie wird nämlich die ganze schwedische Malerei vom
17. Jahrhundert an umfassen und daher ein Bild von ihrer Qe-
schichte und Leistung geben, wie es im Auslande bisher noch nir-
gends geboten worden ist. Die Kunst um 1880 wird als eine eigene
stattliche Qruppe aufgebaut; die moderne Abteilung wird in der
Weise gebildet, daß eine Anzahl von Kiinstlern zur Beteiligung ein-
geladen sind. Hier wird auch eine Reihe von Werken der bedeu-
tendsten lebenden schwedischen Bildhauer, wie Carl Milles, Carl
Eldth, Christian Eriksson u. a., zu sehen sein.
Kopenhagen hat seine große Tuxen-Ausstellung ge-
habt. Sie umfaßtc etwa 400 Nummern — und das war vielleicht
eben ihre Schwäche. Denn es gibt nicht viele Künstler, deren
Schätzung eine so umfängliche Vereinigung ihrer Werke zum Vor-
teile gereicht. Man sah dic großen, vielgenannnten Fürstengruppen-
bilder, wie das Jubiläum der Königin Viktoria und Nikolaus II.
Krönung in Moskau; sie wirkten künstlerisch doch sehr zeitgebun-
den, und die photographenhafte Art der Gruppenkomposition konnte
nicht befriedigen. Und wiederum die Akte („Susanna im Bade“ das
bekannteste Beispiel) schmeckten zu sehr nach Salonmalerei. Aber
in der Frische mancher Bilder aus der Skagenzeit, auch zum Teil
in den Vorarbeiten für die Fürstenbilder war Tuxens echtes
urspriingliches Maleringenium zu erkennen.
266