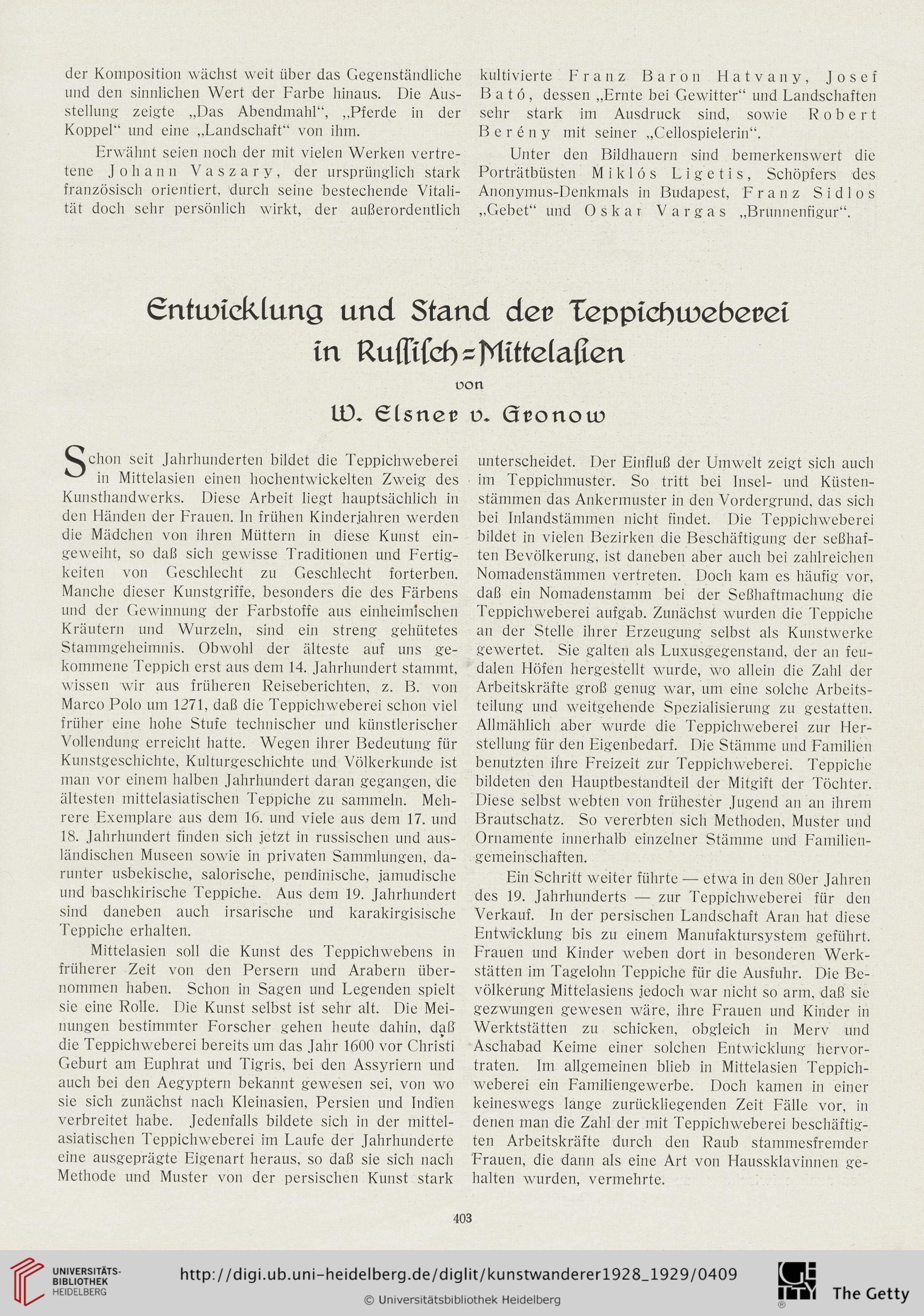der Komposition wächst weit über das Gegenständliche
und den sinnlichen Wert der Farbe liinaus. Die Aus-
stellung zeigte ,,Das Abendmahl“, „Plerde in der
Koppel“ und eine „Landschaft“ von ihm.
Erwähnt seien noch der mit vielen Werken vertre-
tene Johann Vaszary, der urspriinglich stark
französisch orientiert, durch seine bestechende Vitali-
tät doch sehr persönlich wirkt, der außerordentlich
kultivierte Franz Baron Hatvany, Josef
B a t ö , dessen „Ernte bei Gewitter“ und Landschaften
sehr stark im Ausdruck sind, sowie Robert
Bereny mit seincr „Cellospielerin“.
Unter den Bildhauern sind bemerkenswert die
Porträtbiisten M i k 1 ö s L i g e t i s , Schöpfers des
Anonymus-Denkmals in Budapest, Franz Sidios
„Gebet“ und 0 s k a r Vargas „Brunnenfigur“.
6ntu?tcklung und Stand dee Tcppicbtücbcrci
tn RufTifcb=Mittc(a(Icn
oon
UX 6lsnet? v. QtJonotü
Wchon seit Jahrhunderten bildet die Teppichweberei
^ in Mittelasien einen hochentwickelten Zweig des
Kunsthandwerks. Diese Arbeit liegt hauptsächlich in
den Händen der Frauen. In friihen Kinderjahren werden
die Mädchen von ihren Müttern in diese Kunst ein-
geweiht, so daß sich gewisse Traditionen und Fertig-
keiten von Geschlecht zu Geschlecht forterben.
Manche dieser Kunstgriffe, besonders die des Färbens
und der Gewinnung der Farbstoffe aus einheimlschen
Kräutern und Wurzeln, sind ein streng gehütetes
Stammgeheimnis. Obwohl der älteste auf uns ge-
kommene Teppich erst aus dem 14. Jahrhundert stammt,
wissen wir aus früheren Reiseberichten, z. B. von
Marco Polo um 1271, daß die Tcppichweberei schon viel
früher eine hohe Stufe technischer und kiinstlerischer
Vollendung erreicht hatte. Wegen ihrer Bedeutung fiir
Kunstgeschichte, Kulturgeschichtc und Völkerkunde ist
man vor einem halben Jahrhundert daran gegangen, die
ältesten mittelasiatischen Teppiche zu sammeln. Mch-
rere Exemplare aus dcm 16. und viele aus dem 17. und
18. Jahrhundert finden sich jetzt in russischen und aus-
ländischen Museen sowie in privaten Sammlungen, da-
runter usbekische, salorische, pendinische, jamudische
und baschkirische Teppiche. Aus dem 19. Jahrhundert
sind daneben auch irsarische und karakirgisische
Teppiche erhalten.
Mittelasien soll die Kunst des Teppichwebens in
früherer Zeit von den Persern und Arabern über-
nommen haben. Schon in Sagen und Legenden spielt
sie eine Rolle. Die Kunst selbst ist sehr alt. Die Mei-
nungen bestimmter Forscher gehen heute dahin, daß
die Teppichweberei bereits um das Jahr 1600 vor Christi
Geburt am Euphrat und Tigris, bei den Assyriern und
auch bei den Aegyptern bekannt gewesen sei, von wo
sie sich zunächst nach Kleinasien, Persien und Indien
verbreitet habe. Jedenfalls bildete sicli in der mittel-
asiatischen Teppichweberei im Laufe der Jahrhunderte
eine ausgeprägte Eigenart heraus, so daß sie sich nach
Methode und Muster von der persischen Kunst stark
unterscheidet. Der Einfluß der Umwelt zeigt sich auch
im Teppichmuster. So tritt bei Insel- und Küsten-
stämmen das Ankermuster in den Vordergrund, das sich
bei Inlandstämmen nicht findet. Die Teppichweberei
bildet in vielen Bezirken die Beschäftigung der seßhaf-
ten Bevölkcrung, ist daneben aber aucli bei zahlreichen
Nomadenstämmen vertreten. Doch kam es häufig vor,
daß ein Nomadenstamm bei der Seßhaftmachung die
Teppichweberei aufgab. Zunächst wurden die Teppiche
an der Stelle ihrer Erzeugung selbst als Kunstwerke
gewertet. Sie galten als Luxusgegenstand, der an feu-
dalen Höfen hergestcllt wurde, wo allcin die Zahl der
Ar'beitskräfte groß genug war, um eine solclie Arbeits-
teilung und weitgehende Spezialisierung zu gestatten.
Allmählich aber wurde die Teppichweberei zur Her-
stcllung für den Eigenbedarf. Die Stämme und Familien
benutzten ihre Freizeit zur Teppichwcbcrei. Teppiche
bildeten den Hauptbcstandteil der Mitgift der Töchter.
Diese selbst webten von frühester Jugend an an ihrem
Brautschatz. So vererbten sich Methoden, Muster und
Ornamente innerhalb einzelner Stämme und Familien-
gemeinschaften.
Ein Schritt weiter fiihrte — etwa in den 80er Jahren
des 19. Jahrhunderts — zur Teppichweberei fiir den
Verkauf. In der persischen Landschaft Aran hat diese
Entwfcklung bis zu einem Manufaktursystem geführt.
Frauen und Kinder weben dort in besonderen Werk-
stätten im Tagelohn Teppiche fiir die Ausfuhr. Die Be-
völkerung Mittelasiens jedoch war nicht so arm, daß sie
gezwungen gewesen wäre, ihre Frauen und Kinder in
Werktstätten zu schicken, obgleich in Merv und
Aschabad Keime einer solchen Entwickiung hervor-
traten. Im allgemeinen blieb in Mittelasien Teppich-
weberei ein Familiengewerbe. Doch kamen in einer
keineswegs lange zurückliegenden Zeit Fälle vor, in
denen man die Zahl der mit Teppichweberei beschäftig-
ten Arbeitskräfte durch den Raub stammesfremder
Frauen, die dann als eine Art von Haussklavinnen ge-
halten wurden, vermehrte.
403
und den sinnlichen Wert der Farbe liinaus. Die Aus-
stellung zeigte ,,Das Abendmahl“, „Plerde in der
Koppel“ und eine „Landschaft“ von ihm.
Erwähnt seien noch der mit vielen Werken vertre-
tene Johann Vaszary, der urspriinglich stark
französisch orientiert, durch seine bestechende Vitali-
tät doch sehr persönlich wirkt, der außerordentlich
kultivierte Franz Baron Hatvany, Josef
B a t ö , dessen „Ernte bei Gewitter“ und Landschaften
sehr stark im Ausdruck sind, sowie Robert
Bereny mit seincr „Cellospielerin“.
Unter den Bildhauern sind bemerkenswert die
Porträtbiisten M i k 1 ö s L i g e t i s , Schöpfers des
Anonymus-Denkmals in Budapest, Franz Sidios
„Gebet“ und 0 s k a r Vargas „Brunnenfigur“.
6ntu?tcklung und Stand dee Tcppicbtücbcrci
tn RufTifcb=Mittc(a(Icn
oon
UX 6lsnet? v. QtJonotü
Wchon seit Jahrhunderten bildet die Teppichweberei
^ in Mittelasien einen hochentwickelten Zweig des
Kunsthandwerks. Diese Arbeit liegt hauptsächlich in
den Händen der Frauen. In friihen Kinderjahren werden
die Mädchen von ihren Müttern in diese Kunst ein-
geweiht, so daß sich gewisse Traditionen und Fertig-
keiten von Geschlecht zu Geschlecht forterben.
Manche dieser Kunstgriffe, besonders die des Färbens
und der Gewinnung der Farbstoffe aus einheimlschen
Kräutern und Wurzeln, sind ein streng gehütetes
Stammgeheimnis. Obwohl der älteste auf uns ge-
kommene Teppich erst aus dem 14. Jahrhundert stammt,
wissen wir aus früheren Reiseberichten, z. B. von
Marco Polo um 1271, daß die Tcppichweberei schon viel
früher eine hohe Stufe technischer und kiinstlerischer
Vollendung erreicht hatte. Wegen ihrer Bedeutung fiir
Kunstgeschichte, Kulturgeschichtc und Völkerkunde ist
man vor einem halben Jahrhundert daran gegangen, die
ältesten mittelasiatischen Teppiche zu sammeln. Mch-
rere Exemplare aus dcm 16. und viele aus dem 17. und
18. Jahrhundert finden sich jetzt in russischen und aus-
ländischen Museen sowie in privaten Sammlungen, da-
runter usbekische, salorische, pendinische, jamudische
und baschkirische Teppiche. Aus dem 19. Jahrhundert
sind daneben auch irsarische und karakirgisische
Teppiche erhalten.
Mittelasien soll die Kunst des Teppichwebens in
früherer Zeit von den Persern und Arabern über-
nommen haben. Schon in Sagen und Legenden spielt
sie eine Rolle. Die Kunst selbst ist sehr alt. Die Mei-
nungen bestimmter Forscher gehen heute dahin, daß
die Teppichweberei bereits um das Jahr 1600 vor Christi
Geburt am Euphrat und Tigris, bei den Assyriern und
auch bei den Aegyptern bekannt gewesen sei, von wo
sie sich zunächst nach Kleinasien, Persien und Indien
verbreitet habe. Jedenfalls bildete sicli in der mittel-
asiatischen Teppichweberei im Laufe der Jahrhunderte
eine ausgeprägte Eigenart heraus, so daß sie sich nach
Methode und Muster von der persischen Kunst stark
unterscheidet. Der Einfluß der Umwelt zeigt sich auch
im Teppichmuster. So tritt bei Insel- und Küsten-
stämmen das Ankermuster in den Vordergrund, das sich
bei Inlandstämmen nicht findet. Die Teppichweberei
bildet in vielen Bezirken die Beschäftigung der seßhaf-
ten Bevölkcrung, ist daneben aber aucli bei zahlreichen
Nomadenstämmen vertreten. Doch kam es häufig vor,
daß ein Nomadenstamm bei der Seßhaftmachung die
Teppichweberei aufgab. Zunächst wurden die Teppiche
an der Stelle ihrer Erzeugung selbst als Kunstwerke
gewertet. Sie galten als Luxusgegenstand, der an feu-
dalen Höfen hergestcllt wurde, wo allcin die Zahl der
Ar'beitskräfte groß genug war, um eine solclie Arbeits-
teilung und weitgehende Spezialisierung zu gestatten.
Allmählich aber wurde die Teppichweberei zur Her-
stcllung für den Eigenbedarf. Die Stämme und Familien
benutzten ihre Freizeit zur Teppichwcbcrei. Teppiche
bildeten den Hauptbcstandteil der Mitgift der Töchter.
Diese selbst webten von frühester Jugend an an ihrem
Brautschatz. So vererbten sich Methoden, Muster und
Ornamente innerhalb einzelner Stämme und Familien-
gemeinschaften.
Ein Schritt weiter fiihrte — etwa in den 80er Jahren
des 19. Jahrhunderts — zur Teppichweberei fiir den
Verkauf. In der persischen Landschaft Aran hat diese
Entwfcklung bis zu einem Manufaktursystem geführt.
Frauen und Kinder weben dort in besonderen Werk-
stätten im Tagelohn Teppiche fiir die Ausfuhr. Die Be-
völkerung Mittelasiens jedoch war nicht so arm, daß sie
gezwungen gewesen wäre, ihre Frauen und Kinder in
Werktstätten zu schicken, obgleich in Merv und
Aschabad Keime einer solchen Entwickiung hervor-
traten. Im allgemeinen blieb in Mittelasien Teppich-
weberei ein Familiengewerbe. Doch kamen in einer
keineswegs lange zurückliegenden Zeit Fälle vor, in
denen man die Zahl der mit Teppichweberei beschäftig-
ten Arbeitskräfte durch den Raub stammesfremder
Frauen, die dann als eine Art von Haussklavinnen ge-
halten wurden, vermehrte.
403