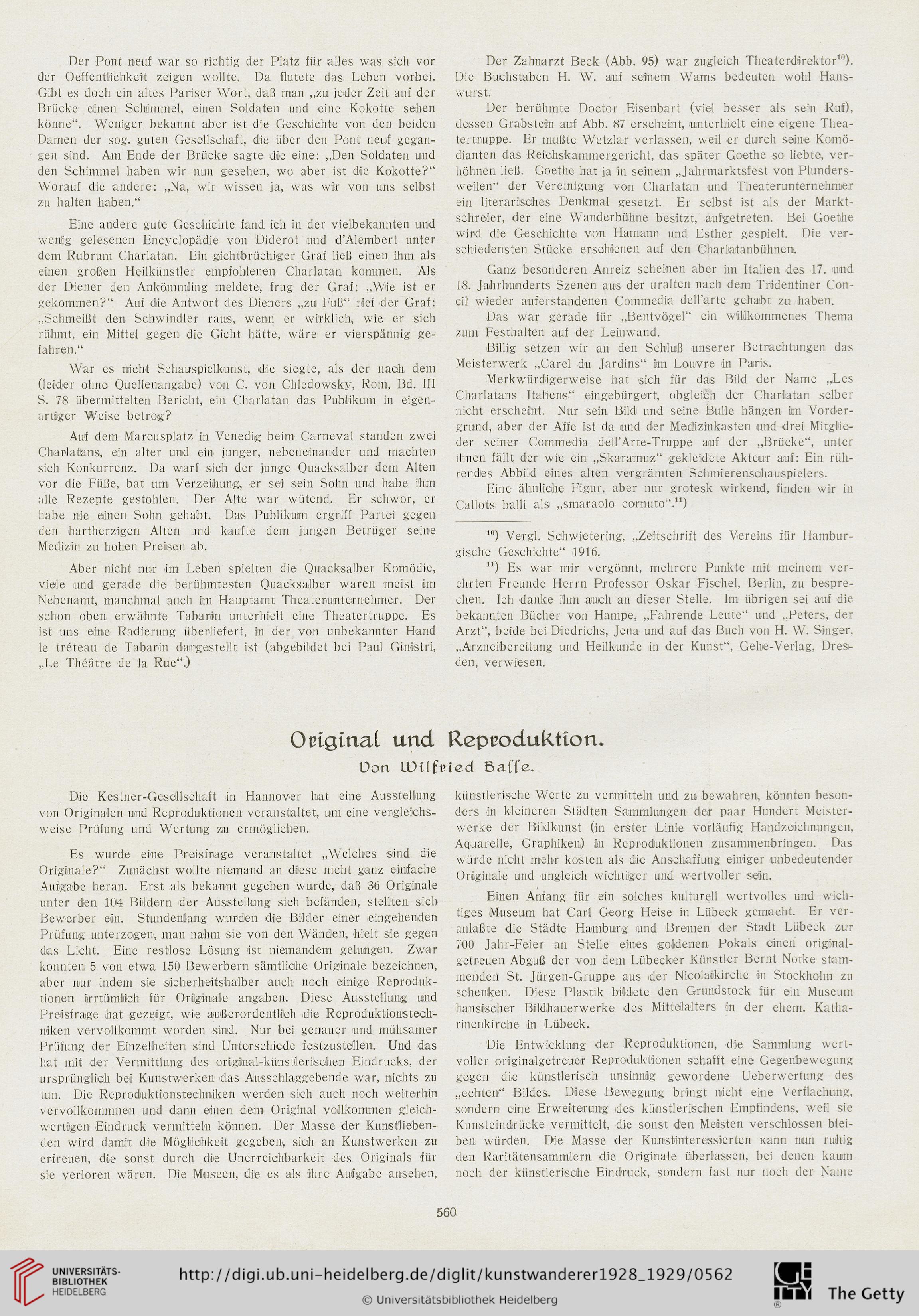Der Pont neuf war so richtig der Platz für alles was sich vor
der Oeffentlichkeiit zeigen wollte. Da flutete das Leben vorbei.
Gibt es doch ein altes Pariser Wort, daß man „zu jeder Zeit auf der
Brücke einen Schdmmel, einen Soldaten und eine Kokotte sehen
könne“. Weniger bekannt aber ist die Geschichte von den beiden
Damen der sog. guten Gesellschaft, die über den Pont neuif gegan-
gen sind. Am Ende der Brücke sagte die eine: „Den Soldaten und
den Schimmel haben wir mun gesehen, wo aber ist die Kokotte?“
Worauf die andere: „Na, wir wissen ja, was wir von uns selbst
zu halten haben.“
Eine andiere gute Geschichte fand ich in der vielbekannten und
weniig gelesenen Encyclopädie von Diderot und d’Alembert unter
dem Rubrum Charlatan. Ein gichtbrüchiger Graf ließ einen ihm als
einen großen Heilkünstler empfohlenen Charlatan kommen. Als
der Diener den AnkömmJing meldete, frug der Graf: „Wie ist er
gekommen?“ Auf diie Antwort des Dieners „zu Fuß“ rief der Graf:
„Schmeißt den Schwindler raus, wenn er wirklich, wie er sicli
rühmt, ein Mittei gegen die Gicht hätte, wäre er vierspännig ge-
fahren.“
War es nicht Schaiuspielkunst, die siegte, als der naeh dem
(leider ohne Quelilenangabe) von C. von Chledowsky, Roin, Bd. III
S. 78 übermittelten Bericht, ein Charlatan das Publikum in eigen-
artii'ger Weise betrog?
Auf dem Marouisplatz in Vened'ig beim Carneval standen zwei
Charlat'anis, ein alter und ein junger, nebeneinander und machten
sich Konkurrenz. Da warf sich der junge Quacksalber dem Alten
vor die Füße, bat um Verzeihung, er sei sein Sohn und habe ihm
alle Rezepte gestohlen. Der Alte war wütend. Er schwor, er
liabe nie einen Sohn gehabt. Das Publikum ergriff Partei gegen
den hartherziigen Alten und kaufte dem jungen Betrüger seine
Medizin zu hohen Preisen ab.
Aber nicht nur im Leben spielten die Quacksalber Komödie,
vieie und gerade die berühmtesten Quacksalber waren meist im
Nebenamt, manchmal auch im Hauptamt Theateruinternehmier. Der
schon oben erwähnte Tabariin unterhielt eine Theatertruppe. Es
ist uns eine Radierung überliefert, in der von unbekannter Hand
le treteau de Tabarin dar'gestellt ist (abgebildet bei Paul Ginistri,
„Le Theätre de :1a Rue“.)
Der Zahnarzt Beck (Abb. 95) war zugleich Theaterdirektor10).
Die Buehstaben H. W. aiuf seinem Wams bedeuten wohi Hans-
wurst.
Der berühmte Doctor Eisenbart (viel besser als sein Ruf),
deissen Grabstein auf Abb. 87 erscheint, unterhielt eine eigene Thea-
tertruppe. Er mußte Wetzlar verlassen, weil er durch seine Komö-
dianten das Reichskammergericht, das später Goethe so liebte, ver-
liöhnen ließ. Goethe hat ja in seinem „Jahrmiarktsfest von Plunders-
weilen“ der Vere'inigung von Charlatan und Theaterunternehmer
ein literarischeis Denkmal gesetzt. Er selbst ist als der Markt-
schrei'er, der eine Wanderbühne besitzt, aufgetreten. Bei Goethe
wi:rd die Ge'Sch'ichtei von Hamann und Esther gespielt. Die ver-
schiedensten Stücke ersohienen auf den Charl'atanbühnen.
Ganz besonderen Anreiz scheinen aber im Italien des 17. und
18. Jahrhunderts Szenen aus der uralten nach dem Tridentiner Con-
cii wiedeir auferstandenen Commedia dell’arte gehabt zu haben.
Das war gerade für „Bentvögel“ ein wülkommenes Thema
zum Festhalten auf der Leinwand.
Billig setzen wir an den Schluß unserer Betrachtungen das
Meiisterwerk „Carel du Jardins“ im Louvre in Paris.
Merkwürdigerweis'e hat sich für dais Bild der Name „Les
Charlatans Ital'iens“ eingebürgert, obgleich der Charlatan selber
nicht erscheint. Nur sein Bild und seine Bulle hängen im Vorder-
grund, abeir der Affe ist da und der Medlizinkasten und drei Mitglie-
der se.iner Commedia dell’Arte-Truppe auf der „Brücke“, unter
ilmen fällt der wite ein „Skaramuz“ gekleidete Akteur auf: Ein rüh-
rendies Abbild eines alten vergrämten Schm'iereniscihauspielers.
Eine ähnliohe Figur, aber nur grotesk wirkend, finden wir in
Callots balli als „smaraolo cornuto“.11)
10) Vergl. Schwiietering, „Zeitschrift des Verein'S für Hambur-
gische Geschichte“ 1916.
“) Es war mir vergöntit, mehrere Punkte mit meinem ver-
ehrten Freunde Herrn Professor Oskar Fischel, Berlin, zu bespre-
chen. Ich danke i'hm auich an dieser Stelle. Im übrigen sei auf die
bekann,ten Bücher von Hampe, „Fahrende Leute“ und „Peters, der
Arzt“, beide bei Dicdriclis, Jeria und auf das Buch von H. W. Singer,
„Arzneibereitung und Heilkunde in der Kunst“, Gehie-Verlag, Dresc
den, verwiesen.
Ocigtnat und Reproduktton.
üon LÜitfEicd Baffe.
Die Keistnier-'Gesöllschaift in Hannover hat eine Ausstell.ung
von Oriiginalen und Rcproduktionen veranstialtet, um eine vergleichs-
weise Prüfung und Wertung ziu ermöglichen.
Es wurdie eiine Preiisfriage veranistaltet „Weilches sind dfe
Originale?“ Zunächst wollte niemand an diiese nicht ganz einfache
Aufgabe heran. Erst als bekannt gegeben wurde, daß 36 Originale
unter den 104 Bildern der Ausstellung sich befänden, stcllten sich
Bewerber ein. Stundenlang wiuirden die Bilder einer ieiogehenden
Prüfung unterzogen, .man nahm sie von den Wänden, hielt sie gegen
das Licht. Eine restlose Lösung ist niemandem gel.ungen. Zwar
konnten 5 von etwa 150 Bewerbern sämtliohe Originale bezeichnen,
aber nur indem sie sächerheitshalber auch noch einige Reproduk-
tionen iirrtüimltoh für Orilginiale angaben. Diese Auisstellung und
Preisfrage hat gezeigt, wie aiußerordentli'ch die Reprodiuktionstech-
niken vervollkommt worden sind. Nur bei genauer und mühsamer
Prüfung der Einzeliheiten sind Untersch'iede festzustellen. Und das
hat mit der Vermittlung des oriigiinal-künstilerischen Eindrucbs, der
ursprüngli'ch bei Kunstwerken das Ausschlaggebende war, nichts zu
tun. Die Reproduktion'Stechniken we.rden sich auch noch weiterhin
vervollkommnen und dann einen de,m Original vo'llkommen gleich-
werti/gen Eindruck vermitteln können. Der Masse der Kunstlieben-
den wird damit die Mögliicbkeit gegeben, sich an Kunstwerken zu
erfreuen, dte sonst durch die Unerreichbarkeit des Originals für
sie verloren wären. Die Museen, die es als ihre Aufgabe ansehen,
künstlerische Werte zu vermiitteln und zu bewahren, könnten beson-
ders in kleineren Städten Sammlungen der paar Hundert Meister-
werke der Bildkunst (in erster Linie vorläufig Handzefehnungeii,
Aquarellle, Graphiken) in Reproduktionen zusammenbringen. Das
würde nicht metor kosten als dfe Anschaffung einiger luinbedeutender
Oniginale und unglefeh wichtilger und wertvoller seiin.
Einen Anfang für ein solches kulturell wertvoltes und wicli-
tiges Museum hat Caril Georg Heise in Lübeck gemacht. Er ver-
anlaßte die Städte Hamburg und Bremen der Stadt Lübeck zur
700 Jahr-Feier an Stelle eines goldenen Pokals einen original-
getreuen Abguß der von dem Lübecber Künstler Bernt Notke stam-
menden St. Jürgen-Gruppe aus der Nicolaiikirche in Stockholm zu
schenken. Diese Plastik bildete den Grundstock für ein Museutn
hansisoher Bildhauerwerke des Mittelalters in der ehem. Katha-
rinenkirche in Liibeck.
Die Entwickluinlg der Reproduktlionen, die Sammlung wert-
voller origiinalgetreuier Reproduktionen schafft eine Ge'genbewegung
gegen die künstleriisch unsinniig gewordene Ueberwertung des
„ecihten“ Bildes. D'iese Bewegung bringt nicht eiine Verflachuing,
sondern eine Erweiterung des künstlerischen Empfindens, weil sie
Kunsteindrücke vermittelt, die sonst den Meisten verschlossen blei-
ben wiirden. Die Masse der Kunstinteressi'erten Kann nun ruihig
den Raritätensammlern die Originale überlassen, bei denen kauni
nocli der künstlerische Eindruck, sondern fast nu.r noch der Name
560
der Oeffentlichkeiit zeigen wollte. Da flutete das Leben vorbei.
Gibt es doch ein altes Pariser Wort, daß man „zu jeder Zeit auf der
Brücke einen Schdmmel, einen Soldaten und eine Kokotte sehen
könne“. Weniger bekannt aber ist die Geschichte von den beiden
Damen der sog. guten Gesellschaft, die über den Pont neuif gegan-
gen sind. Am Ende der Brücke sagte die eine: „Den Soldaten und
den Schimmel haben wir mun gesehen, wo aber ist die Kokotte?“
Worauf die andere: „Na, wir wissen ja, was wir von uns selbst
zu halten haben.“
Eine andiere gute Geschichte fand ich in der vielbekannten und
weniig gelesenen Encyclopädie von Diderot und d’Alembert unter
dem Rubrum Charlatan. Ein gichtbrüchiger Graf ließ einen ihm als
einen großen Heilkünstler empfohlenen Charlatan kommen. Als
der Diener den AnkömmJing meldete, frug der Graf: „Wie ist er
gekommen?“ Auf diie Antwort des Dieners „zu Fuß“ rief der Graf:
„Schmeißt den Schwindler raus, wenn er wirklich, wie er sicli
rühmt, ein Mittei gegen die Gicht hätte, wäre er vierspännig ge-
fahren.“
War es nicht Schaiuspielkunst, die siegte, als der naeh dem
(leider ohne Quelilenangabe) von C. von Chledowsky, Roin, Bd. III
S. 78 übermittelten Bericht, ein Charlatan das Publikum in eigen-
artii'ger Weise betrog?
Auf dem Marouisplatz in Vened'ig beim Carneval standen zwei
Charlat'anis, ein alter und ein junger, nebeneinander und machten
sich Konkurrenz. Da warf sich der junge Quacksalber dem Alten
vor die Füße, bat um Verzeihung, er sei sein Sohn und habe ihm
alle Rezepte gestohlen. Der Alte war wütend. Er schwor, er
liabe nie einen Sohn gehabt. Das Publikum ergriff Partei gegen
den hartherziigen Alten und kaufte dem jungen Betrüger seine
Medizin zu hohen Preisen ab.
Aber nicht nur im Leben spielten die Quacksalber Komödie,
vieie und gerade die berühmtesten Quacksalber waren meist im
Nebenamt, manchmal auch im Hauptamt Theateruinternehmier. Der
schon oben erwähnte Tabariin unterhielt eine Theatertruppe. Es
ist uns eine Radierung überliefert, in der von unbekannter Hand
le treteau de Tabarin dar'gestellt ist (abgebildet bei Paul Ginistri,
„Le Theätre de :1a Rue“.)
Der Zahnarzt Beck (Abb. 95) war zugleich Theaterdirektor10).
Die Buehstaben H. W. aiuf seinem Wams bedeuten wohi Hans-
wurst.
Der berühmte Doctor Eisenbart (viel besser als sein Ruf),
deissen Grabstein auf Abb. 87 erscheint, unterhielt eine eigene Thea-
tertruppe. Er mußte Wetzlar verlassen, weil er durch seine Komö-
dianten das Reichskammergericht, das später Goethe so liebte, ver-
liöhnen ließ. Goethe hat ja in seinem „Jahrmiarktsfest von Plunders-
weilen“ der Vere'inigung von Charlatan und Theaterunternehmer
ein literarischeis Denkmal gesetzt. Er selbst ist als der Markt-
schrei'er, der eine Wanderbühne besitzt, aufgetreten. Bei Goethe
wi:rd die Ge'Sch'ichtei von Hamann und Esther gespielt. Die ver-
schiedensten Stücke ersohienen auf den Charl'atanbühnen.
Ganz besonderen Anreiz scheinen aber im Italien des 17. und
18. Jahrhunderts Szenen aus der uralten nach dem Tridentiner Con-
cii wiedeir auferstandenen Commedia dell’arte gehabt zu haben.
Das war gerade für „Bentvögel“ ein wülkommenes Thema
zum Festhalten auf der Leinwand.
Billig setzen wir an den Schluß unserer Betrachtungen das
Meiisterwerk „Carel du Jardins“ im Louvre in Paris.
Merkwürdigerweis'e hat sich für dais Bild der Name „Les
Charlatans Ital'iens“ eingebürgert, obgleich der Charlatan selber
nicht erscheint. Nur sein Bild und seine Bulle hängen im Vorder-
grund, abeir der Affe ist da und der Medlizinkasten und drei Mitglie-
der se.iner Commedia dell’Arte-Truppe auf der „Brücke“, unter
ilmen fällt der wite ein „Skaramuz“ gekleidete Akteur auf: Ein rüh-
rendies Abbild eines alten vergrämten Schm'iereniscihauspielers.
Eine ähnliohe Figur, aber nur grotesk wirkend, finden wir in
Callots balli als „smaraolo cornuto“.11)
10) Vergl. Schwiietering, „Zeitschrift des Verein'S für Hambur-
gische Geschichte“ 1916.
“) Es war mir vergöntit, mehrere Punkte mit meinem ver-
ehrten Freunde Herrn Professor Oskar Fischel, Berlin, zu bespre-
chen. Ich danke i'hm auich an dieser Stelle. Im übrigen sei auf die
bekann,ten Bücher von Hampe, „Fahrende Leute“ und „Peters, der
Arzt“, beide bei Dicdriclis, Jeria und auf das Buch von H. W. Singer,
„Arzneibereitung und Heilkunde in der Kunst“, Gehie-Verlag, Dresc
den, verwiesen.
Ocigtnat und Reproduktton.
üon LÜitfEicd Baffe.
Die Keistnier-'Gesöllschaift in Hannover hat eine Ausstell.ung
von Oriiginalen und Rcproduktionen veranstialtet, um eine vergleichs-
weise Prüfung und Wertung ziu ermöglichen.
Es wurdie eiine Preiisfriage veranistaltet „Weilches sind dfe
Originale?“ Zunächst wollte niemand an diiese nicht ganz einfache
Aufgabe heran. Erst als bekannt gegeben wurde, daß 36 Originale
unter den 104 Bildern der Ausstellung sich befänden, stcllten sich
Bewerber ein. Stundenlang wiuirden die Bilder einer ieiogehenden
Prüfung unterzogen, .man nahm sie von den Wänden, hielt sie gegen
das Licht. Eine restlose Lösung ist niemandem gel.ungen. Zwar
konnten 5 von etwa 150 Bewerbern sämtliohe Originale bezeichnen,
aber nur indem sie sächerheitshalber auch noch einige Reproduk-
tionen iirrtüimltoh für Orilginiale angaben. Diese Auisstellung und
Preisfrage hat gezeigt, wie aiußerordentli'ch die Reprodiuktionstech-
niken vervollkommt worden sind. Nur bei genauer und mühsamer
Prüfung der Einzeliheiten sind Untersch'iede festzustellen. Und das
hat mit der Vermittlung des oriigiinal-künstilerischen Eindrucbs, der
ursprüngli'ch bei Kunstwerken das Ausschlaggebende war, nichts zu
tun. Die Reproduktion'Stechniken we.rden sich auch noch weiterhin
vervollkommnen und dann einen de,m Original vo'llkommen gleich-
werti/gen Eindruck vermitteln können. Der Masse der Kunstlieben-
den wird damit die Mögliicbkeit gegeben, sich an Kunstwerken zu
erfreuen, dte sonst durch die Unerreichbarkeit des Originals für
sie verloren wären. Die Museen, die es als ihre Aufgabe ansehen,
künstlerische Werte zu vermiitteln und zu bewahren, könnten beson-
ders in kleineren Städten Sammlungen der paar Hundert Meister-
werke der Bildkunst (in erster Linie vorläufig Handzefehnungeii,
Aquarellle, Graphiken) in Reproduktionen zusammenbringen. Das
würde nicht metor kosten als dfe Anschaffung einiger luinbedeutender
Oniginale und unglefeh wichtilger und wertvoller seiin.
Einen Anfang für ein solches kulturell wertvoltes und wicli-
tiges Museum hat Caril Georg Heise in Lübeck gemacht. Er ver-
anlaßte die Städte Hamburg und Bremen der Stadt Lübeck zur
700 Jahr-Feier an Stelle eines goldenen Pokals einen original-
getreuen Abguß der von dem Lübecber Künstler Bernt Notke stam-
menden St. Jürgen-Gruppe aus der Nicolaiikirche in Stockholm zu
schenken. Diese Plastik bildete den Grundstock für ein Museutn
hansisoher Bildhauerwerke des Mittelalters in der ehem. Katha-
rinenkirche in Liibeck.
Die Entwickluinlg der Reproduktlionen, die Sammlung wert-
voller origiinalgetreuier Reproduktionen schafft eine Ge'genbewegung
gegen die künstleriisch unsinniig gewordene Ueberwertung des
„ecihten“ Bildes. D'iese Bewegung bringt nicht eiine Verflachuing,
sondern eine Erweiterung des künstlerischen Empfindens, weil sie
Kunsteindrücke vermittelt, die sonst den Meisten verschlossen blei-
ben wiirden. Die Masse der Kunstinteressi'erten Kann nun ruihig
den Raritätensammlern die Originale überlassen, bei denen kauni
nocli der künstlerische Eindruck, sondern fast nu.r noch der Name
560