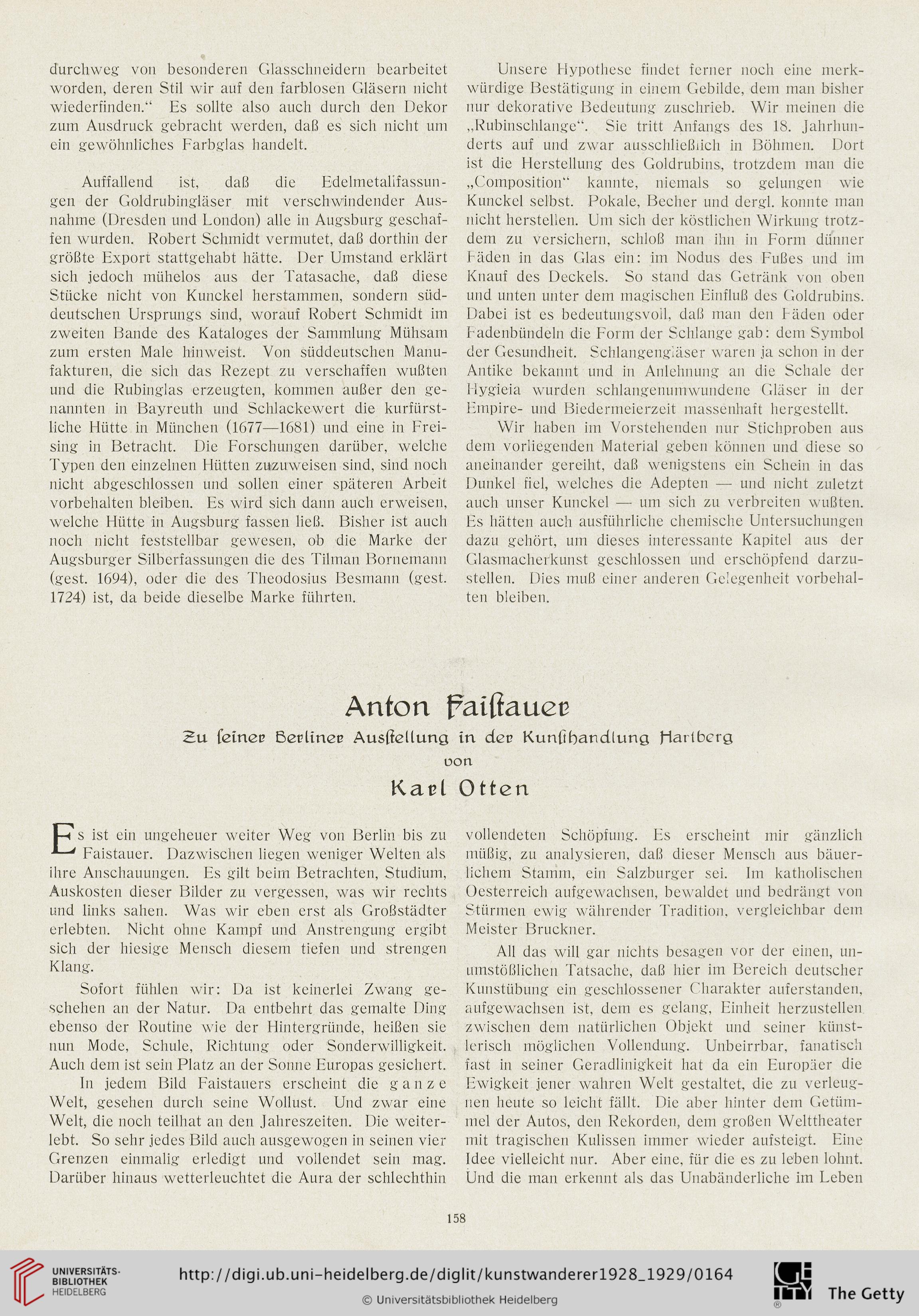durchweg von besonderen Glasschneidern bearbeitet
worden, deren Stil wir auf den farblosen Gläsern nicht
wiederfinden.'1 Es sollte also auch durcli den Dekor
zum Ausdruck gebracht werden, daß es sich nicht um
ein gewöhnliches Farbglas handelt.
Auffallend ist, daß die Edelmetalifassun-
gen der Goldrubingläser mit verschwindender Aus-
nahme (Dresden und London) alle in Augsburg geschaf-
fen wurden. Robert Schmidt vermutet, daß dorthin der
größte Export stattgehabt hätte. Der Umstand erklärt
sich jedoch müiielos aus der Tatasache, daß diese
Stucke nicht von Kunckel herstammen, sondern süd-
dcutschen Ursprungs sind, worauf Robert Schmidt im
zweiten Bande des Kataloges der Sammlung Mühsam
zum ersten Male hinweist. Von süddeutschen Manu-
fakturen, die sich das Rezept zu verschaffen wußten
und die Rubinglas erzeugten, kommen außer den ge-
nannten in Bayreuth und Schlackewert die kurfürst-
liche Hütte in München (1677—1681) und eine in Frei-
sing in Betracht. Die Forscbungen darüber, welche
Typen den einzelnen Hütten zuzuweisen sind, sind noch
nicht abgeschlossen und sollen einer späteren Arbeit
vorbehalten bleiben. Es wird sicli dann auch erweisen,
welche Hiitte in Augsburg fassen ließ. Bisher ist auch
noch nicht feststellbar gewesen, ob die Marke der
Augsburger Silberfassungen dic des Tilman Bornemann
(gest. 1694), oder die des Theodosius Besmann (gest.
1724) ist, da beide dieselbe Marke führten.
Unsere Hypothese findet ferner noch eine merk-
würdige Bestätigung in einem Gebilde, dem man bisher
nur dekorative Bedeutung zuschrieb. Wir meinen die
„Rubinschlange“. Sie tritt Anfangs des 18. Jahrhun-
derts auf und zwar ausschließiich in Böhmen. Dort
ist die Herstellung des Goldrubins, trotzdem man die
„Composition“ kannte, niemals so gelungen wie
Kunckel selbst. Pokale, Becher und dergl. konnte man
nicht herstellen. Urn sich der köstlichen Wirkung trotz-
dem zu versichern, schloß man ihn in Form dünner
Fäden in das Glas ein: im Nodus des Fußes und im
Knauf des Deckels. So stand das Getränk von oben
und unten unter dem magischen Finfluß des Goldrubins.
Dabei ist es bedeutungsvoll, daß man den Fäden oder
Fadenbündeln die Form der Schlange gab: dem Symbol
der Gesundheit. Schlangengiäser waren ja schon in der
Antike bekannt und in Anlehnung an die Schale der
Hygieia wurden schlangenumwundene Gläser in der
Empire- und Biedermeierzeit mässenhaft hergestellt.
Wir haben im Vorstehenden nur Stichproben aus
dem voriiegenden Material geben können und diese so
aneinander gereiht, daß wenigstens ein Schein in das
IJunkel fiel, welches die Adepten — und nicht zuletzt
auch unser Kunckel — um sich zu verbreiten wußten.
Es hätten auch ausführliche chemische Untersuchungen
dazu gehört, um dieses interessante Kapitel aus der
Glasmacherkunst geschlossen und erschöpfend darzu-
stellen. Dies muß eiuer anderen Gelegenheit vorbehal-
ten bleiben.
Anton fa.iQa.net
2u fetncp Bet?Unen Ausfieltung in det? Kuntlbamdiung Jiartbcrg
oon
Kavt Otten
p s ist ein ungeheuer weiter Weg von Berlin bis zu
‘1 Faistauer. Dazwischen liegen weniger Welten als
ihre Anschauungen. Fs gilt beim Betrachten, Studium,
Auskosten dieser Bilder zu vergessen, was wir rechts
utid links saheri. Was wir eben erst als Großstädter
erlebten. Nicht ohne Kampf und Anstrengung ergibt
sich der hiesige Mensch diesem tiefen und strengen
Klang.
Sofort fühlen wir: Da ist keinerlei Zwang ge-
schehen an der Natur. Da entbchrt das gemalte Ding
ebenso der Routine wie der Hintergründe, heißen sie
nun Mode, Schule, Richtung oder Sonderwilligkeit.
Auch dem ist sein Platz an der Sonne Europas gesichert.
In jedem Bild Faistauers erscheint die g a n z e
Welt, gesehen durch seine Wollust. Und zwar eine
Welt, die noch teilhat an den Jahreszeiten. Die weiter-
lebt. So sehr jedes Bild auch ausgewogen in scinen vier
Grenzen einmalig erledigt und vollendct sein mag.
Darüber hinaus wetterleuchtet die Aura der schlechthin
vollendeten Schöpfung. Fs erscheint mir gänzlich
müßig, zu analysieren, daß dieser Mensch aus bäuer-
lichem Starnrn, ein Salzburger sei. Im katholischen
Oesterreich aufgewachsen, bewaldet und bedrängt von
Stürmen ewig währender Tradition, vergleichbar dem
Meister Bruckner.
All das will gar nichts besagen vor der einen, un-
umstößlichen Tatsache, daß hier itn Bereich deutscher
Kunstübung ein geschlossener Charakter auferstanden,
aufgewachsen ist, dem es gelang, Einheit herzustellen
zwischen dem natürlichen Objekt und seiner künst-
lerisch möglichen Vollendung. Unbeirrbar, fanatisch
fast in seiner Geradlinigkeit hat da ein Europäer die
Ewigkeit jener wahren Welt gestaltet, die zu verleug-
uen heute so leicht fällt. Die aber hinter dem Getüm-
mel der Autos, den Rekorden, dem großen Welttheater
mit tragischen Kulissen immer wieder aufsteigt. Eine
Idee vielleicht nur. Aber eine, für die es zu leben lohnt.
Und die man erkennt als das Unabänderliche im Leben
158
worden, deren Stil wir auf den farblosen Gläsern nicht
wiederfinden.'1 Es sollte also auch durcli den Dekor
zum Ausdruck gebracht werden, daß es sich nicht um
ein gewöhnliches Farbglas handelt.
Auffallend ist, daß die Edelmetalifassun-
gen der Goldrubingläser mit verschwindender Aus-
nahme (Dresden und London) alle in Augsburg geschaf-
fen wurden. Robert Schmidt vermutet, daß dorthin der
größte Export stattgehabt hätte. Der Umstand erklärt
sich jedoch müiielos aus der Tatasache, daß diese
Stucke nicht von Kunckel herstammen, sondern süd-
dcutschen Ursprungs sind, worauf Robert Schmidt im
zweiten Bande des Kataloges der Sammlung Mühsam
zum ersten Male hinweist. Von süddeutschen Manu-
fakturen, die sich das Rezept zu verschaffen wußten
und die Rubinglas erzeugten, kommen außer den ge-
nannten in Bayreuth und Schlackewert die kurfürst-
liche Hütte in München (1677—1681) und eine in Frei-
sing in Betracht. Die Forscbungen darüber, welche
Typen den einzelnen Hütten zuzuweisen sind, sind noch
nicht abgeschlossen und sollen einer späteren Arbeit
vorbehalten bleiben. Es wird sicli dann auch erweisen,
welche Hiitte in Augsburg fassen ließ. Bisher ist auch
noch nicht feststellbar gewesen, ob die Marke der
Augsburger Silberfassungen dic des Tilman Bornemann
(gest. 1694), oder die des Theodosius Besmann (gest.
1724) ist, da beide dieselbe Marke führten.
Unsere Hypothese findet ferner noch eine merk-
würdige Bestätigung in einem Gebilde, dem man bisher
nur dekorative Bedeutung zuschrieb. Wir meinen die
„Rubinschlange“. Sie tritt Anfangs des 18. Jahrhun-
derts auf und zwar ausschließiich in Böhmen. Dort
ist die Herstellung des Goldrubins, trotzdem man die
„Composition“ kannte, niemals so gelungen wie
Kunckel selbst. Pokale, Becher und dergl. konnte man
nicht herstellen. Urn sich der köstlichen Wirkung trotz-
dem zu versichern, schloß man ihn in Form dünner
Fäden in das Glas ein: im Nodus des Fußes und im
Knauf des Deckels. So stand das Getränk von oben
und unten unter dem magischen Finfluß des Goldrubins.
Dabei ist es bedeutungsvoll, daß man den Fäden oder
Fadenbündeln die Form der Schlange gab: dem Symbol
der Gesundheit. Schlangengiäser waren ja schon in der
Antike bekannt und in Anlehnung an die Schale der
Hygieia wurden schlangenumwundene Gläser in der
Empire- und Biedermeierzeit mässenhaft hergestellt.
Wir haben im Vorstehenden nur Stichproben aus
dem voriiegenden Material geben können und diese so
aneinander gereiht, daß wenigstens ein Schein in das
IJunkel fiel, welches die Adepten — und nicht zuletzt
auch unser Kunckel — um sich zu verbreiten wußten.
Es hätten auch ausführliche chemische Untersuchungen
dazu gehört, um dieses interessante Kapitel aus der
Glasmacherkunst geschlossen und erschöpfend darzu-
stellen. Dies muß eiuer anderen Gelegenheit vorbehal-
ten bleiben.
Anton fa.iQa.net
2u fetncp Bet?Unen Ausfieltung in det? Kuntlbamdiung Jiartbcrg
oon
Kavt Otten
p s ist ein ungeheuer weiter Weg von Berlin bis zu
‘1 Faistauer. Dazwischen liegen weniger Welten als
ihre Anschauungen. Fs gilt beim Betrachten, Studium,
Auskosten dieser Bilder zu vergessen, was wir rechts
utid links saheri. Was wir eben erst als Großstädter
erlebten. Nicht ohne Kampf und Anstrengung ergibt
sich der hiesige Mensch diesem tiefen und strengen
Klang.
Sofort fühlen wir: Da ist keinerlei Zwang ge-
schehen an der Natur. Da entbchrt das gemalte Ding
ebenso der Routine wie der Hintergründe, heißen sie
nun Mode, Schule, Richtung oder Sonderwilligkeit.
Auch dem ist sein Platz an der Sonne Europas gesichert.
In jedem Bild Faistauers erscheint die g a n z e
Welt, gesehen durch seine Wollust. Und zwar eine
Welt, die noch teilhat an den Jahreszeiten. Die weiter-
lebt. So sehr jedes Bild auch ausgewogen in scinen vier
Grenzen einmalig erledigt und vollendct sein mag.
Darüber hinaus wetterleuchtet die Aura der schlechthin
vollendeten Schöpfung. Fs erscheint mir gänzlich
müßig, zu analysieren, daß dieser Mensch aus bäuer-
lichem Starnrn, ein Salzburger sei. Im katholischen
Oesterreich aufgewachsen, bewaldet und bedrängt von
Stürmen ewig währender Tradition, vergleichbar dem
Meister Bruckner.
All das will gar nichts besagen vor der einen, un-
umstößlichen Tatsache, daß hier itn Bereich deutscher
Kunstübung ein geschlossener Charakter auferstanden,
aufgewachsen ist, dem es gelang, Einheit herzustellen
zwischen dem natürlichen Objekt und seiner künst-
lerisch möglichen Vollendung. Unbeirrbar, fanatisch
fast in seiner Geradlinigkeit hat da ein Europäer die
Ewigkeit jener wahren Welt gestaltet, die zu verleug-
uen heute so leicht fällt. Die aber hinter dem Getüm-
mel der Autos, den Rekorden, dem großen Welttheater
mit tragischen Kulissen immer wieder aufsteigt. Eine
Idee vielleicht nur. Aber eine, für die es zu leben lohnt.
Und die man erkennt als das Unabänderliche im Leben
158