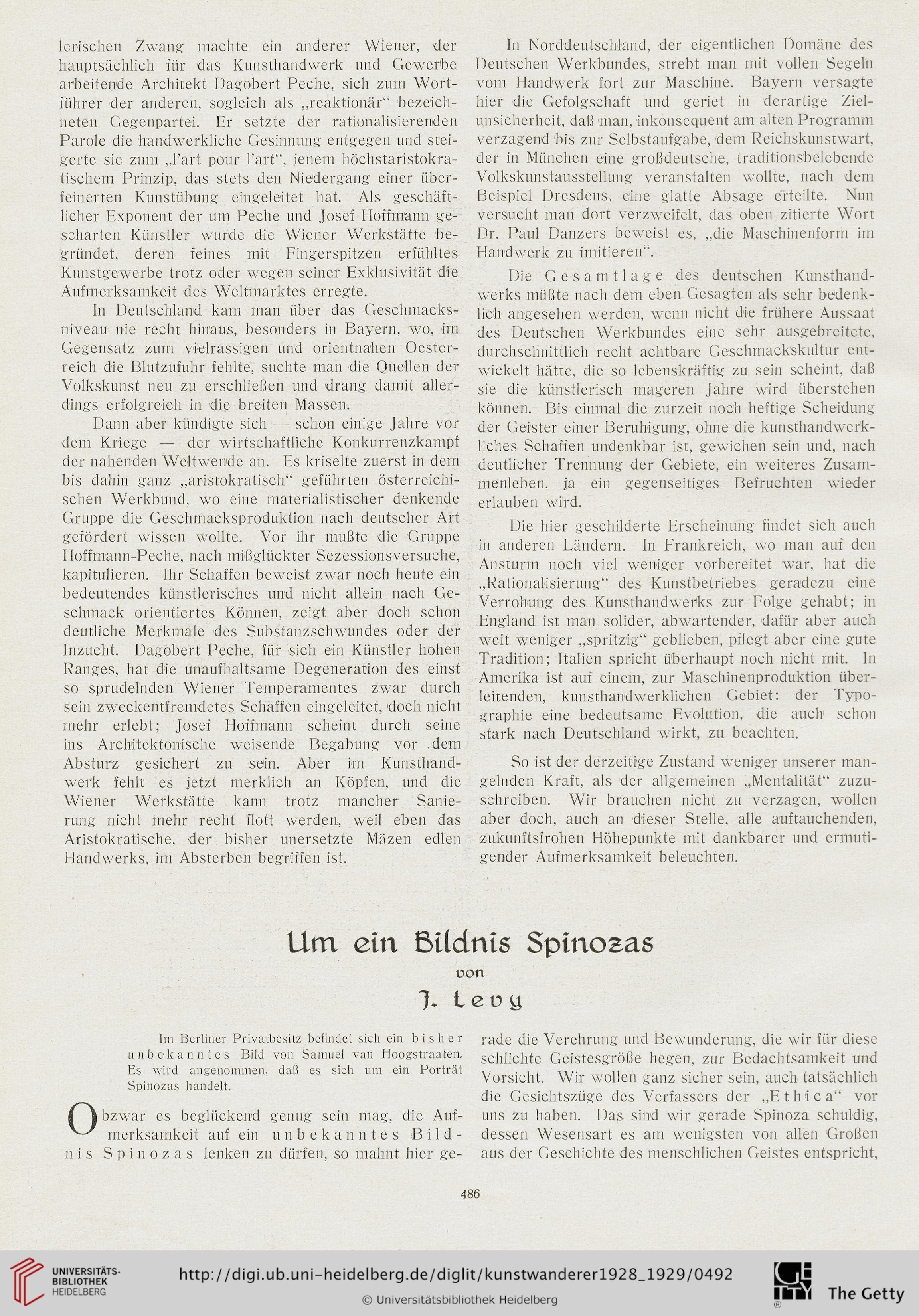ierischen Zwang machte ciu anderer Wiener, der
hauptsächlich für das Kunsthandwerk und Gewer'be
arbeitende Architekt Dagobert Peche, sich zum Wort-
ftihrer der anderen, sogleich als „reaktionär“ bezeich-
neten Gegenpartei. Er setzte der rationalisierenden
Parole die handwerkliche Gesinnung entgegen und stei-
gerte sie zum „l’art pour l’art“, jenem höchstaristokra-
tischem Prinzip, das stets den Niedergang einer über-
feinerten Kunstübung eingeleitet hat. Als geschäft-
iicher Exponent der um Peche und Josef Hoffmann ge-
scharten Künstler wurde die Wiener Werkstätte be-
griindet, deren feines mit Fingerspitzen erfiihltes
Kunstgewerbe trotz oder wegen seiner Exklusivität die
Aufmerksamkeit des Weltmarktes erregte.
In Dcutschland kam man tiber das Geschmacks-
niveau nie recht hinaus, besonders in Bayern, wo, im
Gegensatz zum vielrassigen und orientnahen Oester-
reich die Blutzufuhr fehlte, suchte man die Quellen der
Volkskunst neu zu erschließen und drang damit aller-
dings erfolgreich in die breiten Massen.
Dann aber ktindigte sich — schon einige Jahre vor
dem Kriege — der wirtschaftliche Konkurrenzkampf
der nahenden Weltwende an. Es kriselte zuerst in dem
bis dahin ganz „aristokratisch“ geführten österreichi-
schen Werkbund, wo eine materialistischer denkende
Gruppe die Geschmacksproduktion nach deutscher Art
gefördert wissen wolite. Vor ihr mußte die Gruppe
Hoffmann-Peche, nach mißglückter Sezessionsversuche,
kapitulieren. Ihr Schaffen beweist zwar noch heute ein
bedeutendes künstlerisches und nicht allein nach Ge-
schmack orientiertes Können, zeigt aber doch schon
deutliche Merkmale des Substanzschvvundes oder dcr
Inzucht. Dagobert Peche, ftir sich ein Künstler hohen
Ranges, hat die unaufhaltsame Degeneration des einst
so sprudelnden Wiener Temperamentes zwar durch
sein zweckentfremdetes Schaffen eingeleitet, doch nicht
mehr erlebt; Josef Hoffmann scheint durch seine
ins Architektonische weisende Begabung vor .dem
Absturz gesichert zu sein. Aber im Kunsthand-
werk fehlt es jetzt merklich an Köpfen, und die
Wiener Werkstätte kann trotz mancher Sanie-
rung nicht mehr recht flott werden, weil eben das
Aristokratische, der bisher unersetzte Mäzen edlen
Handwerks, im Absterben begriffen ist.
In Norddeutschland, der eigentlichen Domäne des
Deutschen Werkbundes, strebt mati mit vollen Segeln
vom Handwerk fort zur Maschine. Bayern versagte
hier die Gcfoigschaft und geriet in derartige Ziel-
unsicherheit, daß man, inkonsequent am alten Programm
verzagend bis zur Selbstaufgabe, dem Reichskunstwart,
der in München eine großdeutsche, traditionsbelebende
Volkskunstausstellung veranstalten wollte, nach dem
P3eispicl Dresdens, eine glatte Absage erteilte. Nun
versucht man dort verzweifelt, das oben zitierte Wort
Dr. Paul Danzers beweist es, „die Maschinenform im
Handwerk zu imitieren“.
Die G e s a m 11 a g e des deutschen Kunsthand-
werks miißte nach dem eben Gesagten als sehr bedenk-
lich angesehen werden, wenn nicht die frühere Aussaat
des Deutschen Werkbundes eine sehr ausgebreitete,
durchschnittlich recht achtbare Geschmackskultur ent-
wickelt hätte, die so lebenskräftig zu sein scheint, daß
sie die künstlerisch mageren Jahre wird überstehen
können. Bis einmal die zurzeit noch heftige Scheidung
der Geister einer Beruhigung, ohne die kunsthandwerk-
liches Schaffen undenkbar ist, gewlchen sein und, nach
deutiicher Trennung der Gebiete, ein weiteres Zusam-
menleben, ja ein gegenseitiges Befruchten wieder
erlauben wird.
Die liier geschilderte Erscheinung findet sich auch
in anderen Ländern. In Frankreich, wo man auf den
Ansturm noch viel weniger vorbereitet war, hat die
„Rationalisierung“ des Kunstbetriebes geradezu eine
Verrohung des Kunsthandwerks zur Folge gehabt; in
England ist man solider, abwartender, dafür aber auch
weit weniger „spritzig“ geblieben, pflegt aber eine gute
Tradition; Italien spricht überhaupt noch nicht mit. In
Amerika ist auf einem, zur Maschinenproduktion über-
leitenden, kunsthandwerklichen Gebiet: der Typo-
graphie eine bedeutsame Evolution, die aucli schon
stark nach Deutschland wirkt, zu beachten.
So ist der derzeitige Zustand weniger unserer man-
gelnden Kraft, als der allgemeinen „Mentalität“ zuzu-
schreiben. Wir brauchen nicht zu verzagen, wollen
aber doch, auch an dieser Stelle, alle auftauchenden,
zukunftsfrohen Höhepunkte mit dankbarer und ermuti-
gender Aufmerksamkeit beleuchten.
Um etta Btldnts SptnoEas
üon
Im Berliner Privatbesitz befindet sich ein b i s h e r
unbekanntes Bild von Samuel van Hoogstraaten.
Es wird angenommen, daß cs sich um ein Porträt
Spinozas handelt.
| | bzwar es beglückend gcnug sein mag, die Auf-
merksamkeit auf ein unbekänntes B i 1 d -
n i s S p i n o z a s lenken zu dürfen, so mahnt hier ge-
ßöy
rade die Verehrung und Bewunderung, die wir für diese
schlichte Geistesgröße hegen, zur Bedachtsamkeit und
Vorsicht. Wir wollen ganz sicher sein, auch tatsächlich
die Gesichtszüge des Verfassers der „Ethica“ vor
uns zu haberi. Das sind wir gerade Spinoza schuldig,
dessen Wesensart es am wenigsten von allen Großen
aus der Geschichte des menschlichen Geistes entspricht,
486
hauptsächlich für das Kunsthandwerk und Gewer'be
arbeitende Architekt Dagobert Peche, sich zum Wort-
ftihrer der anderen, sogleich als „reaktionär“ bezeich-
neten Gegenpartei. Er setzte der rationalisierenden
Parole die handwerkliche Gesinnung entgegen und stei-
gerte sie zum „l’art pour l’art“, jenem höchstaristokra-
tischem Prinzip, das stets den Niedergang einer über-
feinerten Kunstübung eingeleitet hat. Als geschäft-
iicher Exponent der um Peche und Josef Hoffmann ge-
scharten Künstler wurde die Wiener Werkstätte be-
griindet, deren feines mit Fingerspitzen erfiihltes
Kunstgewerbe trotz oder wegen seiner Exklusivität die
Aufmerksamkeit des Weltmarktes erregte.
In Dcutschland kam man tiber das Geschmacks-
niveau nie recht hinaus, besonders in Bayern, wo, im
Gegensatz zum vielrassigen und orientnahen Oester-
reich die Blutzufuhr fehlte, suchte man die Quellen der
Volkskunst neu zu erschließen und drang damit aller-
dings erfolgreich in die breiten Massen.
Dann aber ktindigte sich — schon einige Jahre vor
dem Kriege — der wirtschaftliche Konkurrenzkampf
der nahenden Weltwende an. Es kriselte zuerst in dem
bis dahin ganz „aristokratisch“ geführten österreichi-
schen Werkbund, wo eine materialistischer denkende
Gruppe die Geschmacksproduktion nach deutscher Art
gefördert wissen wolite. Vor ihr mußte die Gruppe
Hoffmann-Peche, nach mißglückter Sezessionsversuche,
kapitulieren. Ihr Schaffen beweist zwar noch heute ein
bedeutendes künstlerisches und nicht allein nach Ge-
schmack orientiertes Können, zeigt aber doch schon
deutliche Merkmale des Substanzschvvundes oder dcr
Inzucht. Dagobert Peche, ftir sich ein Künstler hohen
Ranges, hat die unaufhaltsame Degeneration des einst
so sprudelnden Wiener Temperamentes zwar durch
sein zweckentfremdetes Schaffen eingeleitet, doch nicht
mehr erlebt; Josef Hoffmann scheint durch seine
ins Architektonische weisende Begabung vor .dem
Absturz gesichert zu sein. Aber im Kunsthand-
werk fehlt es jetzt merklich an Köpfen, und die
Wiener Werkstätte kann trotz mancher Sanie-
rung nicht mehr recht flott werden, weil eben das
Aristokratische, der bisher unersetzte Mäzen edlen
Handwerks, im Absterben begriffen ist.
In Norddeutschland, der eigentlichen Domäne des
Deutschen Werkbundes, strebt mati mit vollen Segeln
vom Handwerk fort zur Maschine. Bayern versagte
hier die Gcfoigschaft und geriet in derartige Ziel-
unsicherheit, daß man, inkonsequent am alten Programm
verzagend bis zur Selbstaufgabe, dem Reichskunstwart,
der in München eine großdeutsche, traditionsbelebende
Volkskunstausstellung veranstalten wollte, nach dem
P3eispicl Dresdens, eine glatte Absage erteilte. Nun
versucht man dort verzweifelt, das oben zitierte Wort
Dr. Paul Danzers beweist es, „die Maschinenform im
Handwerk zu imitieren“.
Die G e s a m 11 a g e des deutschen Kunsthand-
werks miißte nach dem eben Gesagten als sehr bedenk-
lich angesehen werden, wenn nicht die frühere Aussaat
des Deutschen Werkbundes eine sehr ausgebreitete,
durchschnittlich recht achtbare Geschmackskultur ent-
wickelt hätte, die so lebenskräftig zu sein scheint, daß
sie die künstlerisch mageren Jahre wird überstehen
können. Bis einmal die zurzeit noch heftige Scheidung
der Geister einer Beruhigung, ohne die kunsthandwerk-
liches Schaffen undenkbar ist, gewlchen sein und, nach
deutiicher Trennung der Gebiete, ein weiteres Zusam-
menleben, ja ein gegenseitiges Befruchten wieder
erlauben wird.
Die liier geschilderte Erscheinung findet sich auch
in anderen Ländern. In Frankreich, wo man auf den
Ansturm noch viel weniger vorbereitet war, hat die
„Rationalisierung“ des Kunstbetriebes geradezu eine
Verrohung des Kunsthandwerks zur Folge gehabt; in
England ist man solider, abwartender, dafür aber auch
weit weniger „spritzig“ geblieben, pflegt aber eine gute
Tradition; Italien spricht überhaupt noch nicht mit. In
Amerika ist auf einem, zur Maschinenproduktion über-
leitenden, kunsthandwerklichen Gebiet: der Typo-
graphie eine bedeutsame Evolution, die aucli schon
stark nach Deutschland wirkt, zu beachten.
So ist der derzeitige Zustand weniger unserer man-
gelnden Kraft, als der allgemeinen „Mentalität“ zuzu-
schreiben. Wir brauchen nicht zu verzagen, wollen
aber doch, auch an dieser Stelle, alle auftauchenden,
zukunftsfrohen Höhepunkte mit dankbarer und ermuti-
gender Aufmerksamkeit beleuchten.
Um etta Btldnts SptnoEas
üon
Im Berliner Privatbesitz befindet sich ein b i s h e r
unbekanntes Bild von Samuel van Hoogstraaten.
Es wird angenommen, daß cs sich um ein Porträt
Spinozas handelt.
| | bzwar es beglückend gcnug sein mag, die Auf-
merksamkeit auf ein unbekänntes B i 1 d -
n i s S p i n o z a s lenken zu dürfen, so mahnt hier ge-
ßöy
rade die Verehrung und Bewunderung, die wir für diese
schlichte Geistesgröße hegen, zur Bedachtsamkeit und
Vorsicht. Wir wollen ganz sicher sein, auch tatsächlich
die Gesichtszüge des Verfassers der „Ethica“ vor
uns zu haberi. Das sind wir gerade Spinoza schuldig,
dessen Wesensart es am wenigsten von allen Großen
aus der Geschichte des menschlichen Geistes entspricht,
486