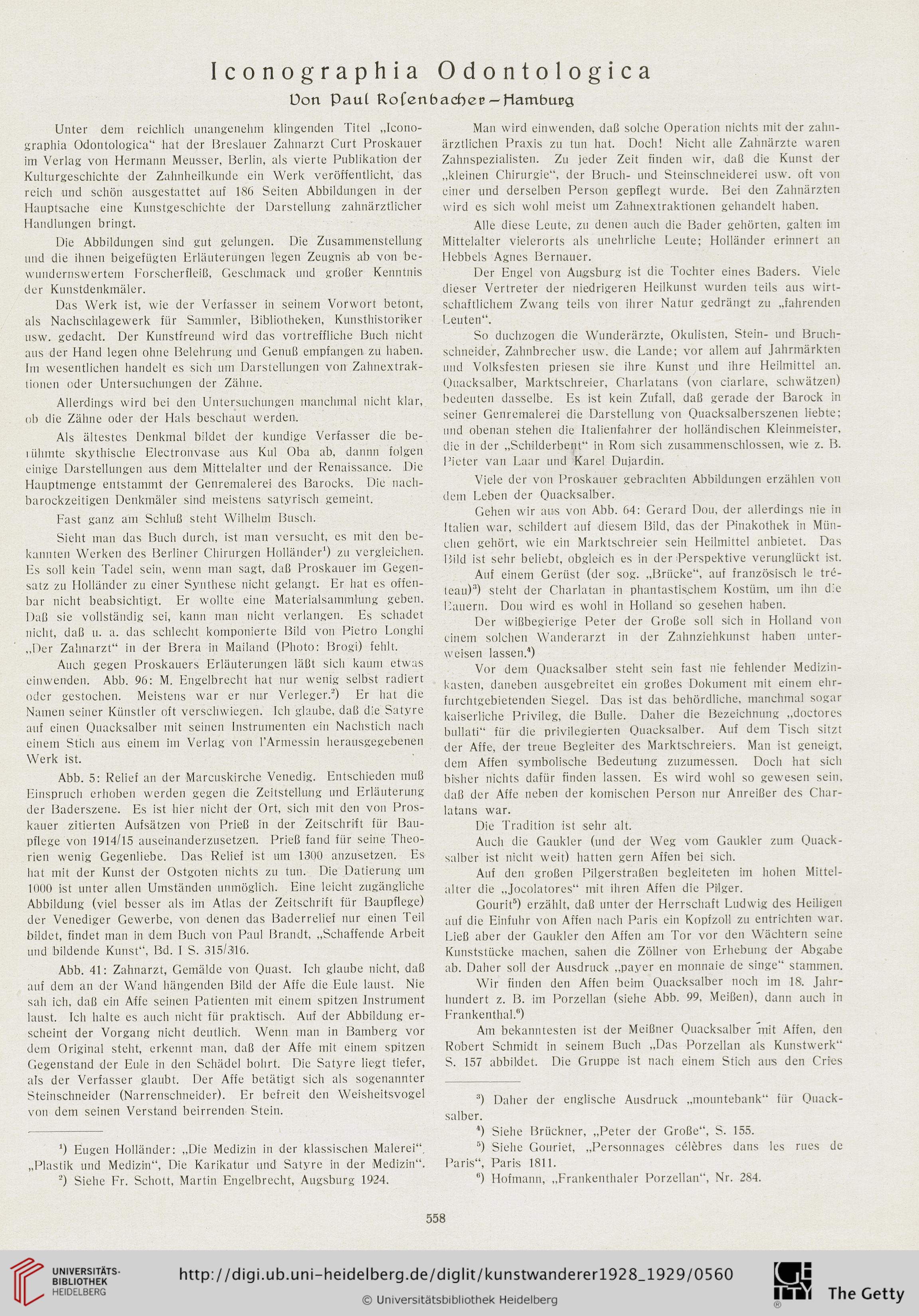Iconographia Odontologica
üon Paut Rofcnbacbet? — Hambucg
Unter dem reichlicli unangenelim klingenden Titel „Icono-
graphia Odontologica“ hat der Breslauer Zahnarzt Ctirt Proskauer
im Verlag von Hermann Meusser, Berlin, als vierte Publikation der
Kulturgeschichte der Zahnheilkunde ein Werk veröffentlicht, das
reich und schön ausgestattet auf 186 Seiten Abbildungen in der
Hauptsache eine Kunstgeschichte der Darstellung zahnärztlicher
Handlungen bringt.
Die Abbildungen sind gut gelungen. Die Zusammenstellung
und die ihnen beigefügten Erläuterungen l'egen Zeugnis ab von be-
wundernswertem Forscherfleiß, Geschmack und großer Kenntnis
der Kunstdenkmäler.
Das Werk ist, wie der Verfasser in seinem Vorwort betont,
als Nachschlagewerk für Sammler, Bibliotheken, Kunsthistoriker
usw. gedacht. Der Kunstfreund wird das vortreffliche Buch nicht
aus der Hand legen ohne Belehrung und Genuß empfangen zu haben.
Irn wesentlichen handelt es sicli um Darstcllungen von Zahnextrak-
tionen oder Untersuchungen der Zähne.
Allerdings wird bei den Untersuchungen manchmal nicht klar,
ob die Zähne oder der Hals beschaut werden.
Als ältestes Denkmal bildet der kundige Verfasser die be-
lühmte skythisclie Electronvase aus Kul Oba ab, dannn folgen
eini'ge Darstellungen aus dem Mittelalter und der Renaissance. Die
Hauptmenge entstammt der Genremalerei des Barocks. Die nacli-
barockzeitigen Denkmäler sind meistens satyrisch gemeint.
Fast ganz am Schluß steht Willielni Busch.
Sielit man das Buclr durch, ist man versucht, es mit den be-
kannten Werken des Berliner Chirurgeu Holländer1) zu vergleiclien.
Es soll kein Tadel sein, wenn man sagt, daß Proskauer im Gegen-
satz zu Holländer zu einer Synthese nicht gelangt. Er hat es offen-
bar nicht beabsichtigt. Er wollte eine Materialsammlung geben.
Daß sie vollständig sei, kann man nicht verlangen. Es schadet
niclit, daß u. a. das schlecht komponierte Bild von Pietro Longhi
,,Der Zalinarzt“ in der Brera in Mailand (Plioto: Brogi) fehlt.
Auch gegen Proskauers Erläuterungen läßt sicli kaum etwas
einwenden. Abb. 96: M. Engelbrecht hat nur wenig selbst radiert
oder gestochen. Meistens war er nur Verleger.2) Er liat die
Namen seiner Künstler oft verschwiegcn. Ich glaube, daß die Satyre
auf einen Quacksalber mit seinen Instrumenten ein Nachstich nach
einem Sticli aus einem im Veriag von l’Armessin herausgegebenen
Werk ist.
Abb. 5: Relief an der Marcuskirche Venedig. Entschieden muß
Einspruch erhoben werden gegen die Zeitstellung und Erläuterung
der Baderszene. Es ist hier nicht der Ort, sich mit den von Pros-
kauer zitierten Aufsätzen von Prieß in der Zeitschrift für Bau-
pflege von 1914/15 auseinanderzusetzen. Prieß fand ftir seine Theo-
rien wenig Gegenliebe. Das Relief ist um 1300 anzusetzen. Es
hat mit der Kunst der Ostgoten nichts zu tun. Die Datierung um
1000 ist unter allen Umständen unmöglich. Eine leicht zugängliche
Abbildung (viel besser als im Atlas der Zeitschrift für Baupflege)
der Venediger Gewerbe, von denen das Baderrelief nur einen Teil
bildet, findet man in 'dem Buch von Paul Brandt, „Schaffende Arbeit
und bildende Kunst“, Bd. I S. 315/316.
Abb. 41: Zahnarzt, Gemälde von Quast. Ich glaube nicht, daß
auf dem an der Wand hängenden Bild der Affe die Eule laust. Nie
sah ich, daß ein Affe seinen Patienten mit einem spitzen Instrument
laust. Ich halte es auch nicht fiir praktisch. Auf der Abbildung er-
scheint der Vorgang nicht deutlich. Wenn man in Bamberg vor
dem Original steht, erkennt man, daß der Affe mit einem spitzen
Gegenstand der Eule in den Schädel bolirt. Die Satyre liegt tiefer,
als der Verfasser glaubt. Der Affe bctätigt sich als sogenannter
Steinschneider (Narrenschneider). Er befreit den Weisheitsvogel
voti dem seinen Verstand beirrenden Stein.
“) Eugen Holländer: „Die Medizin in der klassischen Malerei“.
„Plastik und Medizin“, Die Karikatur und Satyre in der Medizin“.
2) Siehe Fr. Schott, Martin Engelbrecht, Augsburg 1924.
Man wird einwendeni, daß solcbe Operation nichts mit der zahn-
ärztlichen Praxis zu tun hat. Doch! Nicht alle Zahnärzte waren
Zahnspezialisten. Zu jeder Zeit finden wir, daß die Kunst der
„kleinen Chirurgie“, der Bruch- und Steinschneiderei usw. oft von
einer und derselben Person gepflegt wurde. Bei den Zahnärzten
wird es sich wohl meist um Zahnextraktionen gehandelt haben.
Alle diese Leute, zu denen aucli die Bader gehörten, galten. im
Mitteiaitcr vielerorts als unehrliche Leute; Holländer erinnert an
Hebbels Agnes Bernauer.
Der Engel von Augsburg ist die Tochter eines Baders. Viele
dieser Vertreter der niedrigeren Heilkunst wurden teils aus wirt-
schaftlichem Zwang teils voti ilirer Natur gedrängt zu „fahrenden
Leuten“.
So duchzogen die Wunderärzte, Okulisten, Stein- und Bruch-
schneider, Zahnbrecher usw. die Lande; vor allem auf Jahrmärkten
und Volksfesten priesen sie ihre Kunst und ihre Heilmittel an.
Quacksalber, Marktschreier, Charlatans (von ciarlare, schwätzen)
bedeuten dasselbe. Es ist kein Zufall, daß gerade der Barock in
sciner Genremalerei die Darstellung von Quacksalberszenen liebte;
und obenan stehen die Italienfahrer der holländischen Kleinmeister,
die in der „Sch'ilderbent“ in Rom sich zusammenschlossen, wie z. B.
iheter van Laar und Karel Duiardin.
Viele der von Proskauer gebracliten Abbildungen erzählen von
dem Leben der Quacksalber.
Gehen wir auis von Abb. 64: Gerard Dou, der allerdings nie in
italien war, schildert auf diesem Bild, das der Pinakothek in Miin-
chen gehört, wie ein Marktsclireier sein Heilmittel anbietet. Das
Bild ist sehr beliebt, obgleich es in der 'Perspektive vemnglückt ist.
Auf einem Geriist (der sog. „Briicke“, auf französisch le tre-
teau)3) stelit der Charlatan in phantastischem Kostüm, um ihn dle
Bauern. Dou wird es wohl in Holland so gesehen haben.
Der wißbegierige Peter der Große soll sich in Holland vou
cinem solchen Wanderarzt in der Zahnziehkunst haben unter-
weisen lassen.4)
Vor dem Quacksalber steht sein fast nie fehlender Medizin-
kasten, daneben ausgebreitet ein großes Dokument mit einem ehr-
furchtgebietenden Siegel. Das ist das behördliche, manchmal sogar
kaiserliche Privileg, die Bulle. Daher die Bezeichnung „doctores
bullati“ fiir die privilegierten Quacksalber. Auf dem Tisch sitzt
der Affe, der treue Begleiter des Marktschreiers. Man ist geneigt,
dem Affen symbolische Bedeutung zuzumessen. Docli hat sicli
biisher nichts dafür finden lassen. Es wird wohl so gewesen sein,
daß der Affe neben der komischen Person nur Anreißer des Char-
latans war.
Die Tradition ist sehr alt.
Aucli die Gaukler (und der Weg vom Gaukler zum Quack-
salber ist niclit weit) hatten gern Affen bei sich.
Auf den großen Pilgerstraßen begleiteten im hohen Mittel-
alter die „Jocolatores“ mit ihren Affen die Pi'lger.
Gourit5) erzählt, daß unter der Herrschaft Ludwig des Heiligen
auf die Einfuhr von Affen nach Paris ein Kopfzoll zu entrichten war.
Ließ aber der Gawkler den Affen am Tor vor den Wächtern seine
Kunststüeke machen, sahen die Zöllner von Erhebung der Abgabe
ab. Daher soll der Ausdruck „payer en monnaie de singe“ stammen.
Wir finden den Affen beim Quacksalber noch im 18. Jahr-
hundert z. B. im Porzellan (siehe Abb. 99, Meißen), dann auch in
Frankenthal.“)
Am bekanntesten ist der Meißner Quacksalber mit Affen, den
Robert Schmidt in seinem Buch „Das Porzellan als Kunstwerk“
S. 157 abbildet. Die Gruppe ist nach einem Sticli aus den Cries
3) Dalier der englische Ausdruck „mountebank“ für Quack-
salber.
4) Siehe Brückner, „Peter der Große“, S. 155.
5) Siehe Gouriet, „Personnages celebres dans les rues de
I)ariis“, Paris 1811.
“) Hofmann, „Frankenthaler Porzeilan“, Nr. 284.
558
üon Paut Rofcnbacbet? — Hambucg
Unter dem reichlicli unangenelim klingenden Titel „Icono-
graphia Odontologica“ hat der Breslauer Zahnarzt Ctirt Proskauer
im Verlag von Hermann Meusser, Berlin, als vierte Publikation der
Kulturgeschichte der Zahnheilkunde ein Werk veröffentlicht, das
reich und schön ausgestattet auf 186 Seiten Abbildungen in der
Hauptsache eine Kunstgeschichte der Darstellung zahnärztlicher
Handlungen bringt.
Die Abbildungen sind gut gelungen. Die Zusammenstellung
und die ihnen beigefügten Erläuterungen l'egen Zeugnis ab von be-
wundernswertem Forscherfleiß, Geschmack und großer Kenntnis
der Kunstdenkmäler.
Das Werk ist, wie der Verfasser in seinem Vorwort betont,
als Nachschlagewerk für Sammler, Bibliotheken, Kunsthistoriker
usw. gedacht. Der Kunstfreund wird das vortreffliche Buch nicht
aus der Hand legen ohne Belehrung und Genuß empfangen zu haben.
Irn wesentlichen handelt es sicli um Darstcllungen von Zahnextrak-
tionen oder Untersuchungen der Zähne.
Allerdings wird bei den Untersuchungen manchmal nicht klar,
ob die Zähne oder der Hals beschaut werden.
Als ältestes Denkmal bildet der kundige Verfasser die be-
lühmte skythisclie Electronvase aus Kul Oba ab, dannn folgen
eini'ge Darstellungen aus dem Mittelalter und der Renaissance. Die
Hauptmenge entstammt der Genremalerei des Barocks. Die nacli-
barockzeitigen Denkmäler sind meistens satyrisch gemeint.
Fast ganz am Schluß steht Willielni Busch.
Sielit man das Buclr durch, ist man versucht, es mit den be-
kannten Werken des Berliner Chirurgeu Holländer1) zu vergleiclien.
Es soll kein Tadel sein, wenn man sagt, daß Proskauer im Gegen-
satz zu Holländer zu einer Synthese nicht gelangt. Er hat es offen-
bar nicht beabsichtigt. Er wollte eine Materialsammlung geben.
Daß sie vollständig sei, kann man nicht verlangen. Es schadet
niclit, daß u. a. das schlecht komponierte Bild von Pietro Longhi
,,Der Zalinarzt“ in der Brera in Mailand (Plioto: Brogi) fehlt.
Auch gegen Proskauers Erläuterungen läßt sicli kaum etwas
einwenden. Abb. 96: M. Engelbrecht hat nur wenig selbst radiert
oder gestochen. Meistens war er nur Verleger.2) Er liat die
Namen seiner Künstler oft verschwiegcn. Ich glaube, daß die Satyre
auf einen Quacksalber mit seinen Instrumenten ein Nachstich nach
einem Sticli aus einem im Veriag von l’Armessin herausgegebenen
Werk ist.
Abb. 5: Relief an der Marcuskirche Venedig. Entschieden muß
Einspruch erhoben werden gegen die Zeitstellung und Erläuterung
der Baderszene. Es ist hier nicht der Ort, sich mit den von Pros-
kauer zitierten Aufsätzen von Prieß in der Zeitschrift für Bau-
pflege von 1914/15 auseinanderzusetzen. Prieß fand ftir seine Theo-
rien wenig Gegenliebe. Das Relief ist um 1300 anzusetzen. Es
hat mit der Kunst der Ostgoten nichts zu tun. Die Datierung um
1000 ist unter allen Umständen unmöglich. Eine leicht zugängliche
Abbildung (viel besser als im Atlas der Zeitschrift für Baupflege)
der Venediger Gewerbe, von denen das Baderrelief nur einen Teil
bildet, findet man in 'dem Buch von Paul Brandt, „Schaffende Arbeit
und bildende Kunst“, Bd. I S. 315/316.
Abb. 41: Zahnarzt, Gemälde von Quast. Ich glaube nicht, daß
auf dem an der Wand hängenden Bild der Affe die Eule laust. Nie
sah ich, daß ein Affe seinen Patienten mit einem spitzen Instrument
laust. Ich halte es auch nicht fiir praktisch. Auf der Abbildung er-
scheint der Vorgang nicht deutlich. Wenn man in Bamberg vor
dem Original steht, erkennt man, daß der Affe mit einem spitzen
Gegenstand der Eule in den Schädel bolirt. Die Satyre liegt tiefer,
als der Verfasser glaubt. Der Affe bctätigt sich als sogenannter
Steinschneider (Narrenschneider). Er befreit den Weisheitsvogel
voti dem seinen Verstand beirrenden Stein.
“) Eugen Holländer: „Die Medizin in der klassischen Malerei“.
„Plastik und Medizin“, Die Karikatur und Satyre in der Medizin“.
2) Siehe Fr. Schott, Martin Engelbrecht, Augsburg 1924.
Man wird einwendeni, daß solcbe Operation nichts mit der zahn-
ärztlichen Praxis zu tun hat. Doch! Nicht alle Zahnärzte waren
Zahnspezialisten. Zu jeder Zeit finden wir, daß die Kunst der
„kleinen Chirurgie“, der Bruch- und Steinschneiderei usw. oft von
einer und derselben Person gepflegt wurde. Bei den Zahnärzten
wird es sich wohl meist um Zahnextraktionen gehandelt haben.
Alle diese Leute, zu denen aucli die Bader gehörten, galten. im
Mitteiaitcr vielerorts als unehrliche Leute; Holländer erinnert an
Hebbels Agnes Bernauer.
Der Engel von Augsburg ist die Tochter eines Baders. Viele
dieser Vertreter der niedrigeren Heilkunst wurden teils aus wirt-
schaftlichem Zwang teils voti ilirer Natur gedrängt zu „fahrenden
Leuten“.
So duchzogen die Wunderärzte, Okulisten, Stein- und Bruch-
schneider, Zahnbrecher usw. die Lande; vor allem auf Jahrmärkten
und Volksfesten priesen sie ihre Kunst und ihre Heilmittel an.
Quacksalber, Marktschreier, Charlatans (von ciarlare, schwätzen)
bedeuten dasselbe. Es ist kein Zufall, daß gerade der Barock in
sciner Genremalerei die Darstellung von Quacksalberszenen liebte;
und obenan stehen die Italienfahrer der holländischen Kleinmeister,
die in der „Sch'ilderbent“ in Rom sich zusammenschlossen, wie z. B.
iheter van Laar und Karel Duiardin.
Viele der von Proskauer gebracliten Abbildungen erzählen von
dem Leben der Quacksalber.
Gehen wir auis von Abb. 64: Gerard Dou, der allerdings nie in
italien war, schildert auf diesem Bild, das der Pinakothek in Miin-
chen gehört, wie ein Marktsclireier sein Heilmittel anbietet. Das
Bild ist sehr beliebt, obgleich es in der 'Perspektive vemnglückt ist.
Auf einem Geriist (der sog. „Briicke“, auf französisch le tre-
teau)3) stelit der Charlatan in phantastischem Kostüm, um ihn dle
Bauern. Dou wird es wohl in Holland so gesehen haben.
Der wißbegierige Peter der Große soll sich in Holland vou
cinem solchen Wanderarzt in der Zahnziehkunst haben unter-
weisen lassen.4)
Vor dem Quacksalber steht sein fast nie fehlender Medizin-
kasten, daneben ausgebreitet ein großes Dokument mit einem ehr-
furchtgebietenden Siegel. Das ist das behördliche, manchmal sogar
kaiserliche Privileg, die Bulle. Daher die Bezeichnung „doctores
bullati“ fiir die privilegierten Quacksalber. Auf dem Tisch sitzt
der Affe, der treue Begleiter des Marktschreiers. Man ist geneigt,
dem Affen symbolische Bedeutung zuzumessen. Docli hat sicli
biisher nichts dafür finden lassen. Es wird wohl so gewesen sein,
daß der Affe neben der komischen Person nur Anreißer des Char-
latans war.
Die Tradition ist sehr alt.
Aucli die Gaukler (und der Weg vom Gaukler zum Quack-
salber ist niclit weit) hatten gern Affen bei sich.
Auf den großen Pilgerstraßen begleiteten im hohen Mittel-
alter die „Jocolatores“ mit ihren Affen die Pi'lger.
Gourit5) erzählt, daß unter der Herrschaft Ludwig des Heiligen
auf die Einfuhr von Affen nach Paris ein Kopfzoll zu entrichten war.
Ließ aber der Gawkler den Affen am Tor vor den Wächtern seine
Kunststüeke machen, sahen die Zöllner von Erhebung der Abgabe
ab. Daher soll der Ausdruck „payer en monnaie de singe“ stammen.
Wir finden den Affen beim Quacksalber noch im 18. Jahr-
hundert z. B. im Porzellan (siehe Abb. 99, Meißen), dann auch in
Frankenthal.“)
Am bekanntesten ist der Meißner Quacksalber mit Affen, den
Robert Schmidt in seinem Buch „Das Porzellan als Kunstwerk“
S. 157 abbildet. Die Gruppe ist nach einem Sticli aus den Cries
3) Dalier der englische Ausdruck „mountebank“ für Quack-
salber.
4) Siehe Brückner, „Peter der Große“, S. 155.
5) Siehe Gouriet, „Personnages celebres dans les rues de
I)ariis“, Paris 1811.
“) Hofmann, „Frankenthaler Porzeilan“, Nr. 284.
558