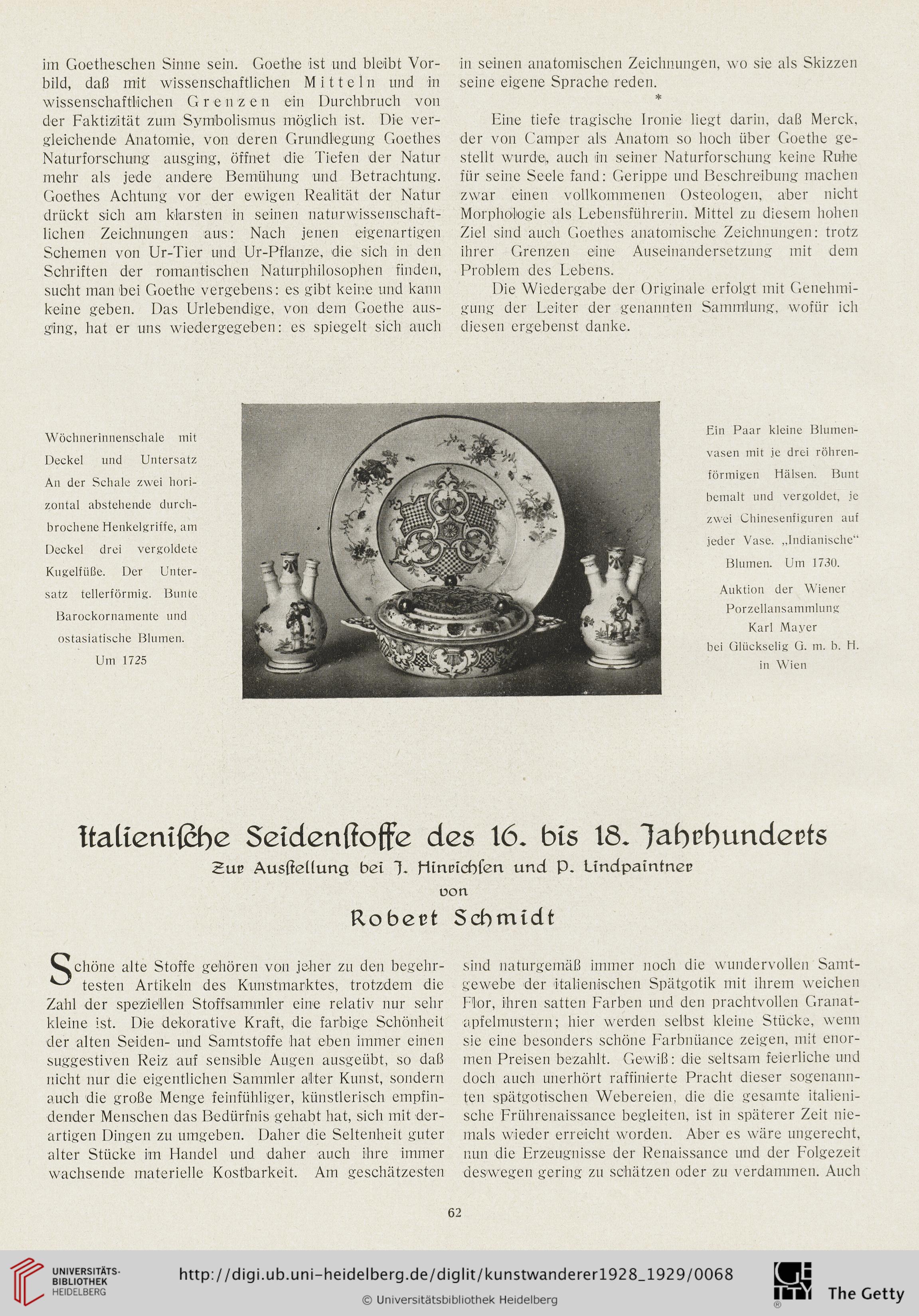Donath, Adolph [Hrsg.]
Der Kunstwanderer: Zeitschrift für alte und neue Kunst, für Kunstmarkt und Sammelwesen
— 10./11.1928/29
Zitieren dieser Seite
Bitte zitieren Sie diese Seite, indem Sie folgende Adresse (URL)/folgende DOI benutzen:
https://doi.org/10.11588/diglit.25877#0068
DOI Heft:
1./2. Oktoberheft
DOI Artikel:Schuster, Julius: Goethe als anatomischer Zeichner
DOI Artikel:Schmidt, Robert: Italienische Seidenstoffe des 16. bis 18. Jahrhunderts: zur Ausstellung bei J. Hinrichsen und P. Lindpainter
DOI Seite / Zitierlink:https://doi.org/10.11588/diglit.25877#0068
iin Goetheschen Sinne sein. Goethe ist und bleibt Vor-
bild, daß mit wissenschaftlichen Mitteln und in
wissenschaftlichen G r e n z e n ein Durchbruch von
der Faktiz'ität zum Symbolismus möglich ist. Die ver-
gleichende Änatomie, von deren Grundlegung Goethes
Naturforschung ausging, öffnet die Tiefen der Natur
mehr als jedc andere Bemühung und Betrachtung.
Goethes Achtung vor der ewigen Reaiität der Natur
drückt sich am kiarsten in seinen naturwissenschaft-
lichen Zeichnungen aus: Nach jenen eigenartigen
Schemen von Ur-Tier und Ur-Pflanze, die sich in den
Schriften der romantischen Naturphilosophen finden,
sucht man bei Goethe vergebens: es gibt keir.e und kann
keine geben. Das Urlebendige, von dem Goethe aus-
ging, hat er uns wiedergegeben: es spiegelt sich auch
in seinen anatomischen Zeiclmungen, wo sie als Skizzen
seine eigene Sprache reden.
*
Hine tiefe tragische Ironie liegt darin, daß Merck,
der von Camper als Anatom so hoch über Goethe ge-
stellt wurde, auch in seiner Naturforschung keine Ruhe
für seine Seele fand: Gerippe und Beschreibung machen
zwar einen vollkommenen Osteologen, aber nicht
Morphotogie als Lebensführerin. Mittel zu diesem hohen
Ziel sind auch Goethes anatomische Zeichnungen: trotz
ihrer Grenzen eine Auseinandersetzung mit dem
Problem des Lebens.
Die Wiedergabe der Originale erfolgt mit Genehmi-
gung der Leiter der genannten Sammiung, wofür ich
diesen ergebenst danke.
Wöchnerinnenschale mit
Deckel und Untersatz
An der Schale zwei hori-
zontal abstehende durch-
brochene Henkelsriffe, am
Deckel drei vergoldete
Kugelfüße. Dcr Unter-
satz tellerförmig. Bunte
Barockornamente und
ostasiatische Blumen.
Um 1725
Ein Paar kleine Blumen-
vasen mit je drei röhren-
förmigen Hälsen. Bunt
bemalt und vergoldet, je
zwei Chinesenfiguren auf
jeder Vase. „Indianische“
Blumen. Um 1730.
Auktion der Wiener
Porzellansammlung
Karl Mayer
bci Glücksclig G. m. b. H.
in Wien
ttalienitebe Seidenffoffe des 16. bis 18. labnbundetds
Hut? Aus(iel(ung bei 1. Hint?icbfen und p. Lindpaintnet?
oon
Ro beüt
^chöne alte Stoffe gehören von jeher zu den begehr-
^ testen Artikeln des Kunstmarktes, trotzdem die
Zahl der spezidilen Stoffsammler eine relativ nur sehr
kleine ist. Die dekorative Kraft, die farbige Schönheit
der alten Seiden- und Samtstoffe hat eben immer einen
suggestiven Reiz auf sensible Augen ausgeübt, so daß
nicht nur die eigentlichen Sammler alter Kunst, sondern
auch die große Menge feinfühiiger, künstlerisch empfin-
dender Menschen das Bedürfmis gehabt hat, sich mit der-
artigen Dingen zu umgeben. Daher die Seltenheit guter
alter Stücke im Handcl und daher auch ihre immer
wachsende materielle Kostbarkeit. Am geschätzesten
Scbmidt
sind naturgemäß inuner nocli die wundervollen Samt-
gewebe der italienischen Spätgotik mit ihrem weichen
Flor, ihren satten Farben und den prachtvollen Granat-
apfelmustern; hier werden selbst kleine Stücke, wenn
sie eine besonders schöne Farbnüance zeigen, mit enor-
men Preisen bezahit. Gewiß: die seltsam feieriiche und
doch auch unerhört raffiuierte Pracht dieser sogenann-
ten spätgotischen Webereien, die die gesamte italieni-
sche Frührenaissance begleiten, ist in späterer Zeit nie-
rnals wieder erreicht worden. Aber es wäre ungerecht,
nun die Erzeugnisse der Renaissance und der Folgezeit
deswegen gering zu schätzen oder zu verdammen. Auch
62
bild, daß mit wissenschaftlichen Mitteln und in
wissenschaftlichen G r e n z e n ein Durchbruch von
der Faktiz'ität zum Symbolismus möglich ist. Die ver-
gleichende Änatomie, von deren Grundlegung Goethes
Naturforschung ausging, öffnet die Tiefen der Natur
mehr als jedc andere Bemühung und Betrachtung.
Goethes Achtung vor der ewigen Reaiität der Natur
drückt sich am kiarsten in seinen naturwissenschaft-
lichen Zeichnungen aus: Nach jenen eigenartigen
Schemen von Ur-Tier und Ur-Pflanze, die sich in den
Schriften der romantischen Naturphilosophen finden,
sucht man bei Goethe vergebens: es gibt keir.e und kann
keine geben. Das Urlebendige, von dem Goethe aus-
ging, hat er uns wiedergegeben: es spiegelt sich auch
in seinen anatomischen Zeiclmungen, wo sie als Skizzen
seine eigene Sprache reden.
*
Hine tiefe tragische Ironie liegt darin, daß Merck,
der von Camper als Anatom so hoch über Goethe ge-
stellt wurde, auch in seiner Naturforschung keine Ruhe
für seine Seele fand: Gerippe und Beschreibung machen
zwar einen vollkommenen Osteologen, aber nicht
Morphotogie als Lebensführerin. Mittel zu diesem hohen
Ziel sind auch Goethes anatomische Zeichnungen: trotz
ihrer Grenzen eine Auseinandersetzung mit dem
Problem des Lebens.
Die Wiedergabe der Originale erfolgt mit Genehmi-
gung der Leiter der genannten Sammiung, wofür ich
diesen ergebenst danke.
Wöchnerinnenschale mit
Deckel und Untersatz
An der Schale zwei hori-
zontal abstehende durch-
brochene Henkelsriffe, am
Deckel drei vergoldete
Kugelfüße. Dcr Unter-
satz tellerförmig. Bunte
Barockornamente und
ostasiatische Blumen.
Um 1725
Ein Paar kleine Blumen-
vasen mit je drei röhren-
förmigen Hälsen. Bunt
bemalt und vergoldet, je
zwei Chinesenfiguren auf
jeder Vase. „Indianische“
Blumen. Um 1730.
Auktion der Wiener
Porzellansammlung
Karl Mayer
bci Glücksclig G. m. b. H.
in Wien
ttalienitebe Seidenffoffe des 16. bis 18. labnbundetds
Hut? Aus(iel(ung bei 1. Hint?icbfen und p. Lindpaintnet?
oon
Ro beüt
^chöne alte Stoffe gehören von jeher zu den begehr-
^ testen Artikeln des Kunstmarktes, trotzdem die
Zahl der spezidilen Stoffsammler eine relativ nur sehr
kleine ist. Die dekorative Kraft, die farbige Schönheit
der alten Seiden- und Samtstoffe hat eben immer einen
suggestiven Reiz auf sensible Augen ausgeübt, so daß
nicht nur die eigentlichen Sammler alter Kunst, sondern
auch die große Menge feinfühiiger, künstlerisch empfin-
dender Menschen das Bedürfmis gehabt hat, sich mit der-
artigen Dingen zu umgeben. Daher die Seltenheit guter
alter Stücke im Handcl und daher auch ihre immer
wachsende materielle Kostbarkeit. Am geschätzesten
Scbmidt
sind naturgemäß inuner nocli die wundervollen Samt-
gewebe der italienischen Spätgotik mit ihrem weichen
Flor, ihren satten Farben und den prachtvollen Granat-
apfelmustern; hier werden selbst kleine Stücke, wenn
sie eine besonders schöne Farbnüance zeigen, mit enor-
men Preisen bezahit. Gewiß: die seltsam feieriiche und
doch auch unerhört raffiuierte Pracht dieser sogenann-
ten spätgotischen Webereien, die die gesamte italieni-
sche Frührenaissance begleiten, ist in späterer Zeit nie-
rnals wieder erreicht worden. Aber es wäre ungerecht,
nun die Erzeugnisse der Renaissance und der Folgezeit
deswegen gering zu schätzen oder zu verdammen. Auch
62