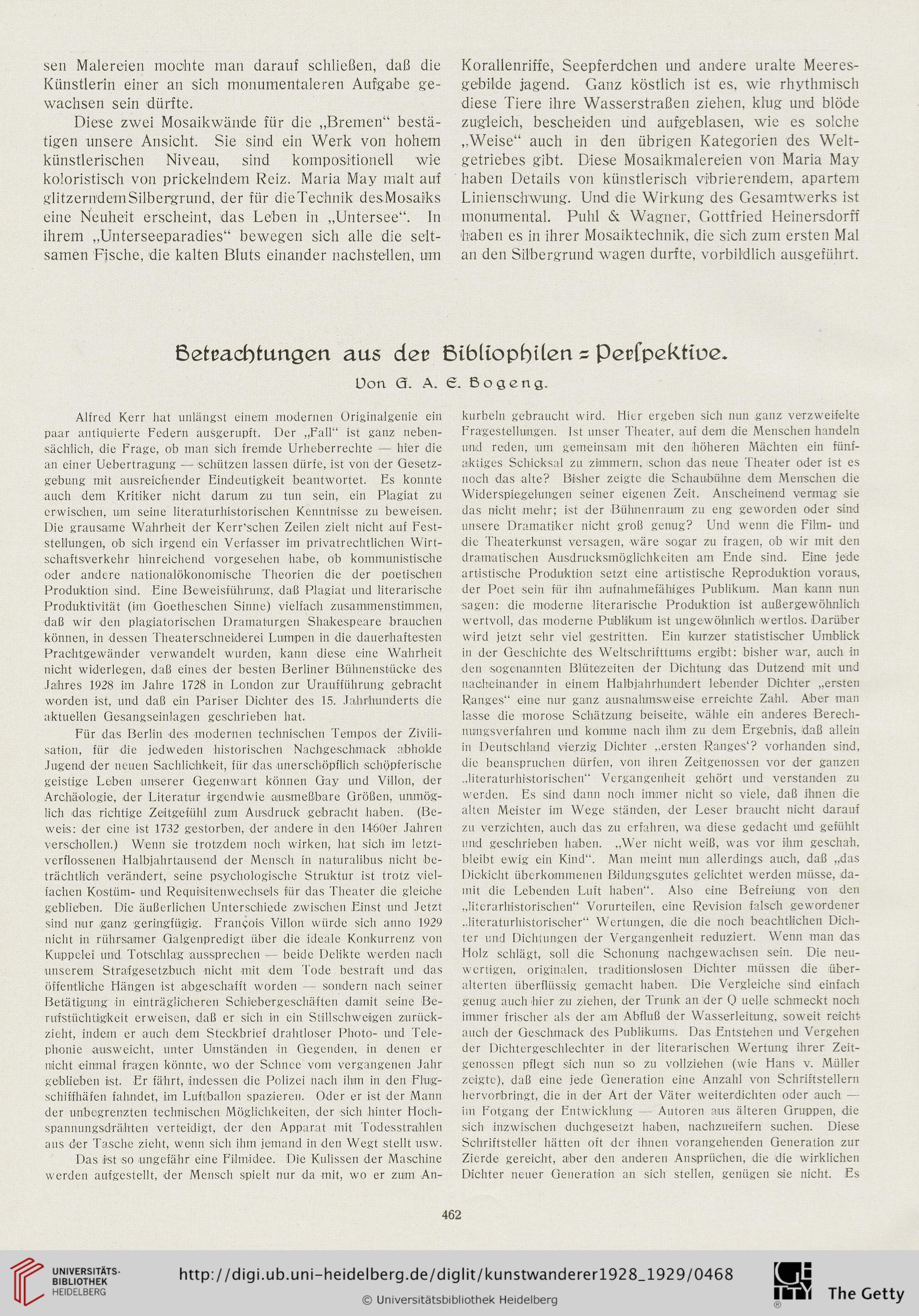sen Malereien mochte man darauf schließen, daß die
Künstlerin einer an sich monumentaleren Aufgabe ge-
wachsen sein dürfte.
Diese zwei Mosaikwände für die „Bremen“ bestä-
tigen nnsere Ansicht. Sie sind ein Werk von hohem
künstlerischen Niveau, sind kompositionell wie
koloristisch von prickelndem Reiz. Maria May malt auf
glitzerndemSilbergrund, der für dieTechnik desMosaiks
eine Neuheit erscheint, das Leben in „Untersee“. In
ihrem „Unterseeparadies“ bewegen sich alle die selt-
samen Fische, die kalten Bluts einander nachstellen, um
Korallenriffe, Seepferdchen und andere uralte Meeres-
gebilde jagend. Ganz köstlich ist es, wie rhythmisch
diese Tiere ihre Wasserstraßen ziehen, klug und blöde
zugleich, bescheiden und aufgeblasen, wie es soiche
„Weise“ auch in den übrigen Kategorien des Welt-
getriebes gibt. Diese Mosaikmalereien von Maria May
haben Details von künstlerisch vfbrierendem, apartem
Linienschwung. Und die Wirkung des Gesamtwerks ist
monumental. Puhl & Wagner, Gottfried Heinersdorff
haben es in ihrer Mosaiktechnik, die sich zum ersten Mal
an den Silbergrund wagen durfte, vorbiidlich ausgeführt.
Betcacbtungen aus det? ßibltopbUen ^ Pecfpektiüe.
Don Q. A. 6. ßogeng.
Alfred Kerr hat unlängst einem modernen Originalgenie ein
paar antiquierte Fcdern ausgerupft. Der „Fall“ ist ganz neben-
sächlich, die Frage, ob man sich fremde Urheberrechte — hier die
an einer Uebertragung — schützcn lassen dürfe, ist von der Qesetz-
gebung mät ausreichender Eindeutigkeit beantwortet. Es konnte
auch dem Kritiker nicht darom zu tun sein, ein Plagiat zu
crwischen, um seine literaturhistorischen Kenntnisse zu beweisen.
Die grausame Wahrheit der Kerr’schen Zeilen zielt nicht auf Fest-
steMungen, oto sich irgend ein Verfasser im privatrechtlichen Wirt-
schaftsverkehr hinreichend vorgesehen habe, ob kommunistische
oder andere nationalökonomische Theorien die der poetischen
Produktion sind. Einc Beweisfiihrunig, daß Rlagiat und literarische
Produktivität (im Qoetheschen Sinne) vielfaah zusammenstimmen,
daß wir den plagiatoriscihen Dramatiurgen Sliakespeare brauchen
können, in dessen Theaterschneiderei Lumpen in die dauerhaftesten
Pradhtgewänder veriwandelt wurden, kann diese eine Wahrheit
nicht widerlegen, daß eines der besten Berliner Bühnenstücke des
Jaihres 1928 im Jahre 1728 in London zur Uraufführung gebracht
woriden ist, und daß ein Pariser Dichter des 15. Jahriiunderts die
aktuellen Gesangseinlagen geschrieben hat.
Für das Berlin des modernen technischen Tempos der Ziviii-
sation, für die jedweden historischen Nachgeschimack aibhoilde
Ju'gend der neuen Sachlichkeit, fiir das unerschöpflich scliöpferische
geistige Leben un-serer Qegenwart können Gay und Villon, der
Archäologie, der I.iteratur irgendwie ausmeßtoare Qrößen, urtmiöig-
lich das richtige Zeitgefühl zum Ausdruck geibraciht haben. (Be-
weiis: der eine ist 1732 gestorben, der andere in den 14‘60er Jahren
verschollen.) Wenn sie trotzdem noch wirken, hat sich im ietzt-
verflossenen Halbjahrtausend der Mensch in naturalibus nicht be-
trächtlich veränidert, seine psycliologische Struiktur ist trotz viel-
tachen Kostüm- wnd Requisitenwechsels für das Theater die gleiche
geblieben. D:ie äußerlichen Unterscihiede .ziwisdhen Einst und Jetzt
sind nur ganz geriiiigfügig. Francois Villon wiirde sicli anno 1929
nicht in rührsamer Qalgenpredigt ii.ber die ideale Konikurrenz von
Kuippelei unid Totschlaig 'aussiprechen — beide Delikte werdeii ri'ach
unserem Strafgesetzbuch nicht mit dem Tode bestraft und das
öffentliiche Hängen ist abgeschafft worden — sond'ern nach seiner
Betätigun.g in einträglioheren Sohietoer.geschäften damit seine Be-
rufstüchtiigkeit erweisen, daß er sich in ein Stillschweiigen zuriick-
zieht, indem er auch dem Steakbrief drahtloser Ptooto- umd Tele-
phonie .ausweicht, unter Umständen in Gegenden, in denen er
nicht einmal fr'a'gen könnte, wo der Schnee vom vergangenen Jahr
geblieiben ist. Er fährt, indessen die Polizei na.ch ihim in den Fling-
schiffhäfen fahndet, im Luftballon spazieren. Odcr er ist dcr Mann
der unbeigremzten technisc-hen Möglichkeiten, dcr sich hinter Hocli-
spannungsd'räihten vertetdigt, dcr den Appar.at mit Tode'SStrahlen
aus dcr Tasche zieht, weinn sich ihm jemand in den Wegt stellt usw.
Das ist iso lungefähr eine Fiilmidiee. Die Kulissen d.er Maschine
werden aufgestellt, der Mensch spielt nur da mit, wo er zum An-
kurbeln gebraucht wird. Hier ergeben sich nun ,ganz veirzweifelte
Fragestellungen. ist un.ser Theater, auf dom die Menschen handeln
und reden, lum gem'einsam mit den höheren Mächten ein fünf-
aktiges Schicksal zu zimmern, schon das neue Theater oder ist es
noch das alte? Bisher zeigte die Schaubühne dem Menschen die
Widerspiegeiunigen sciner eigenen Zeit. Anscheineind vermag sie
das niclit m.eiir; ist der Bühnenraum zu eng g.eworden oder sind
unsere Dramatiker nicht groß genug? Und wenn die Film- und
die Theaterkunst versagen, wäre sogar zu fragen, ob wir mit den
dratmatisehen Aiusdrucksmöglichkeiten am Ende sind. Einie jeide
artistische Produktion setzt eine artistische Reproduktion voraus,
der Poet scin für ihn aufnahm.efähiges Publikum. M.an kann nun
sagen: die in'oderue literariische Produiktion ist außergewöhnlich
wertvoll, 'das moderne Putoliikum ist ungewöhinlich wertlos. Darütoer
wird jetzt sehr viel igestritten. Ein kurzer stiatistisdher Umblick
in der Qeschichte des Weltschrifttums ergibt: bisher war, auch in
den 'S'O.gen'annten Blüteizeiten der Dichtiung idas Dutzend mit un.d
machieinan'der in einem Hatbjahrhund'ert lebender Dichter „ersten
Ranges“ eime nur ganz ausnalimsweise erreichte Zahl. Aber man
la-sse die moro'se Schätzung beiseite, wäble ein anderes Berech-
mnngsvertahren und ko.mnne nach ihm zu dem Ergebnis, d.aß allein
in Deutschland vierzi.g Dichter „ersten Rangeis*? vo'rhanden sind,
die beanspruchen dürfen, von ihren Zeitgenossen vor der ganzen
..literaturhistorischen“ Vergangenheit gehört und verstanden zu
werden. Es sind dann nocli imnner nicht so viele, daß ihnen die
alten Meistcr im Wege ständen, der Leser braucht nicht darauf
zu verzichten, auch das zu erfahren, wa diese gedacht u;nd gefühlt
und geschrieben haben. „Wer nicht weiß, was vor i'hm geschah,
bleibt ewig ein Kind“. Man meint mun allerdings auch, da.ß „das
Diokicht überkammenen Bildungsgutes gelichtet werden müsse, da-
mit die Lcbenideu Luft liaben“. Also e,ine Befreiung von den
„literarhistorischen“ Vorurteilen, eine Revision falsch gewoTdener
.Jiteraturhi'Storisoher“ Wertungen, die die noch beachtliichen Dich-
ter und Dichtiinigen der Vergangenheit reduziert. Wenn man dias
Holz schlägt, soll die Schonung 'nachgewachsen sein. Die neu-
wcrtigen, originalen, traditionslosen Dichter müssen die über-
alterten überflüssig gemacht haben. Die Vergleiche sind einfach
genug auch hier ziu ziehen, der Trunk an ider Q uelle schmeckt noch
immer frischer als der am Abfluß der Wasserleitung, soweit reicht
auch der Qeschmack des Publikums. Das Entstehen und Vergehen
der Dichtergeschlechtcr in der literarischen Wertung ihrer Zeit-
genossen pflegt sich nun so zu vollziehen (wie Hans v. Müller
zeigte), daß eine jede Generation eine Anzahl von Schriftstellern
hervortorirtgt, die in der Art der Väter weiterdichten oder auch —
im Fotgang der Entwicklung — Autoren aius älteren Qruppen, d:ie
sicli inzwischeti duchgesetzt habeti, nachzti'eifern suchen. Diese
Schriftsteiler hätten oft der ihnen vorangehenden Generation zur
Zierde gereicht, aiber den anderen Ansprüchen, die die wirklichen
Dichter neuer Qeneration an sich stellen, genügen si.e nicht. Es
462
Künstlerin einer an sich monumentaleren Aufgabe ge-
wachsen sein dürfte.
Diese zwei Mosaikwände für die „Bremen“ bestä-
tigen nnsere Ansicht. Sie sind ein Werk von hohem
künstlerischen Niveau, sind kompositionell wie
koloristisch von prickelndem Reiz. Maria May malt auf
glitzerndemSilbergrund, der für dieTechnik desMosaiks
eine Neuheit erscheint, das Leben in „Untersee“. In
ihrem „Unterseeparadies“ bewegen sich alle die selt-
samen Fische, die kalten Bluts einander nachstellen, um
Korallenriffe, Seepferdchen und andere uralte Meeres-
gebilde jagend. Ganz köstlich ist es, wie rhythmisch
diese Tiere ihre Wasserstraßen ziehen, klug und blöde
zugleich, bescheiden und aufgeblasen, wie es soiche
„Weise“ auch in den übrigen Kategorien des Welt-
getriebes gibt. Diese Mosaikmalereien von Maria May
haben Details von künstlerisch vfbrierendem, apartem
Linienschwung. Und die Wirkung des Gesamtwerks ist
monumental. Puhl & Wagner, Gottfried Heinersdorff
haben es in ihrer Mosaiktechnik, die sich zum ersten Mal
an den Silbergrund wagen durfte, vorbiidlich ausgeführt.
Betcacbtungen aus det? ßibltopbUen ^ Pecfpektiüe.
Don Q. A. 6. ßogeng.
Alfred Kerr hat unlängst einem modernen Originalgenie ein
paar antiquierte Fcdern ausgerupft. Der „Fall“ ist ganz neben-
sächlich, die Frage, ob man sich fremde Urheberrechte — hier die
an einer Uebertragung — schützcn lassen dürfe, ist von der Qesetz-
gebung mät ausreichender Eindeutigkeit beantwortet. Es konnte
auch dem Kritiker nicht darom zu tun sein, ein Plagiat zu
crwischen, um seine literaturhistorischen Kenntnisse zu beweisen.
Die grausame Wahrheit der Kerr’schen Zeilen zielt nicht auf Fest-
steMungen, oto sich irgend ein Verfasser im privatrechtlichen Wirt-
schaftsverkehr hinreichend vorgesehen habe, ob kommunistische
oder andere nationalökonomische Theorien die der poetischen
Produktion sind. Einc Beweisfiihrunig, daß Rlagiat und literarische
Produktivität (im Qoetheschen Sinne) vielfaah zusammenstimmen,
daß wir den plagiatoriscihen Dramatiurgen Sliakespeare brauchen
können, in dessen Theaterschneiderei Lumpen in die dauerhaftesten
Pradhtgewänder veriwandelt wurden, kann diese eine Wahrheit
nicht widerlegen, daß eines der besten Berliner Bühnenstücke des
Jaihres 1928 im Jahre 1728 in London zur Uraufführung gebracht
woriden ist, und daß ein Pariser Dichter des 15. Jahriiunderts die
aktuellen Gesangseinlagen geschrieben hat.
Für das Berlin des modernen technischen Tempos der Ziviii-
sation, für die jedweden historischen Nachgeschimack aibhoilde
Ju'gend der neuen Sachlichkeit, fiir das unerschöpflich scliöpferische
geistige Leben un-serer Qegenwart können Gay und Villon, der
Archäologie, der I.iteratur irgendwie ausmeßtoare Qrößen, urtmiöig-
lich das richtige Zeitgefühl zum Ausdruck geibraciht haben. (Be-
weiis: der eine ist 1732 gestorben, der andere in den 14‘60er Jahren
verschollen.) Wenn sie trotzdem noch wirken, hat sich im ietzt-
verflossenen Halbjahrtausend der Mensch in naturalibus nicht be-
trächtlich veränidert, seine psycliologische Struiktur ist trotz viel-
tachen Kostüm- wnd Requisitenwechsels für das Theater die gleiche
geblieben. D:ie äußerlichen Unterscihiede .ziwisdhen Einst und Jetzt
sind nur ganz geriiiigfügig. Francois Villon wiirde sicli anno 1929
nicht in rührsamer Qalgenpredigt ii.ber die ideale Konikurrenz von
Kuippelei unid Totschlaig 'aussiprechen — beide Delikte werdeii ri'ach
unserem Strafgesetzbuch nicht mit dem Tode bestraft und das
öffentliiche Hängen ist abgeschafft worden — sond'ern nach seiner
Betätigun.g in einträglioheren Sohietoer.geschäften damit seine Be-
rufstüchtiigkeit erweisen, daß er sich in ein Stillschweiigen zuriick-
zieht, indem er auch dem Steakbrief drahtloser Ptooto- umd Tele-
phonie .ausweicht, unter Umständen in Gegenden, in denen er
nicht einmal fr'a'gen könnte, wo der Schnee vom vergangenen Jahr
geblieiben ist. Er fährt, indessen die Polizei na.ch ihim in den Fling-
schiffhäfen fahndet, im Luftballon spazieren. Odcr er ist dcr Mann
der unbeigremzten technisc-hen Möglichkeiten, dcr sich hinter Hocli-
spannungsd'räihten vertetdigt, dcr den Appar.at mit Tode'SStrahlen
aus dcr Tasche zieht, weinn sich ihm jemand in den Wegt stellt usw.
Das ist iso lungefähr eine Fiilmidiee. Die Kulissen d.er Maschine
werden aufgestellt, der Mensch spielt nur da mit, wo er zum An-
kurbeln gebraucht wird. Hier ergeben sich nun ,ganz veirzweifelte
Fragestellungen. ist un.ser Theater, auf dom die Menschen handeln
und reden, lum gem'einsam mit den höheren Mächten ein fünf-
aktiges Schicksal zu zimmern, schon das neue Theater oder ist es
noch das alte? Bisher zeigte die Schaubühne dem Menschen die
Widerspiegeiunigen sciner eigenen Zeit. Anscheineind vermag sie
das niclit m.eiir; ist der Bühnenraum zu eng g.eworden oder sind
unsere Dramatiker nicht groß genug? Und wenn die Film- und
die Theaterkunst versagen, wäre sogar zu fragen, ob wir mit den
dratmatisehen Aiusdrucksmöglichkeiten am Ende sind. Einie jeide
artistische Produktion setzt eine artistische Reproduktion voraus,
der Poet scin für ihn aufnahm.efähiges Publikum. M.an kann nun
sagen: die in'oderue literariische Produiktion ist außergewöhnlich
wertvoll, 'das moderne Putoliikum ist ungewöhinlich wertlos. Darütoer
wird jetzt sehr viel igestritten. Ein kurzer stiatistisdher Umblick
in der Qeschichte des Weltschrifttums ergibt: bisher war, auch in
den 'S'O.gen'annten Blüteizeiten der Dichtiung idas Dutzend mit un.d
machieinan'der in einem Hatbjahrhund'ert lebender Dichter „ersten
Ranges“ eime nur ganz ausnalimsweise erreichte Zahl. Aber man
la-sse die moro'se Schätzung beiseite, wäble ein anderes Berech-
mnngsvertahren und ko.mnne nach ihm zu dem Ergebnis, d.aß allein
in Deutschland vierzi.g Dichter „ersten Rangeis*? vo'rhanden sind,
die beanspruchen dürfen, von ihren Zeitgenossen vor der ganzen
..literaturhistorischen“ Vergangenheit gehört und verstanden zu
werden. Es sind dann nocli imnner nicht so viele, daß ihnen die
alten Meistcr im Wege ständen, der Leser braucht nicht darauf
zu verzichten, auch das zu erfahren, wa diese gedacht u;nd gefühlt
und geschrieben haben. „Wer nicht weiß, was vor i'hm geschah,
bleibt ewig ein Kind“. Man meint mun allerdings auch, da.ß „das
Diokicht überkammenen Bildungsgutes gelichtet werden müsse, da-
mit die Lcbenideu Luft liaben“. Also e,ine Befreiung von den
„literarhistorischen“ Vorurteilen, eine Revision falsch gewoTdener
.Jiteraturhi'Storisoher“ Wertungen, die die noch beachtliichen Dich-
ter und Dichtiinigen der Vergangenheit reduziert. Wenn man dias
Holz schlägt, soll die Schonung 'nachgewachsen sein. Die neu-
wcrtigen, originalen, traditionslosen Dichter müssen die über-
alterten überflüssig gemacht haben. Die Vergleiche sind einfach
genug auch hier ziu ziehen, der Trunk an ider Q uelle schmeckt noch
immer frischer als der am Abfluß der Wasserleitung, soweit reicht
auch der Qeschmack des Publikums. Das Entstehen und Vergehen
der Dichtergeschlechtcr in der literarischen Wertung ihrer Zeit-
genossen pflegt sich nun so zu vollziehen (wie Hans v. Müller
zeigte), daß eine jede Generation eine Anzahl von Schriftstellern
hervortorirtgt, die in der Art der Väter weiterdichten oder auch —
im Fotgang der Entwicklung — Autoren aius älteren Qruppen, d:ie
sicli inzwischeti duchgesetzt habeti, nachzti'eifern suchen. Diese
Schriftsteiler hätten oft der ihnen vorangehenden Generation zur
Zierde gereicht, aiber den anderen Ansprüchen, die die wirklichen
Dichter neuer Qeneration an sich stellen, genügen si.e nicht. Es
462