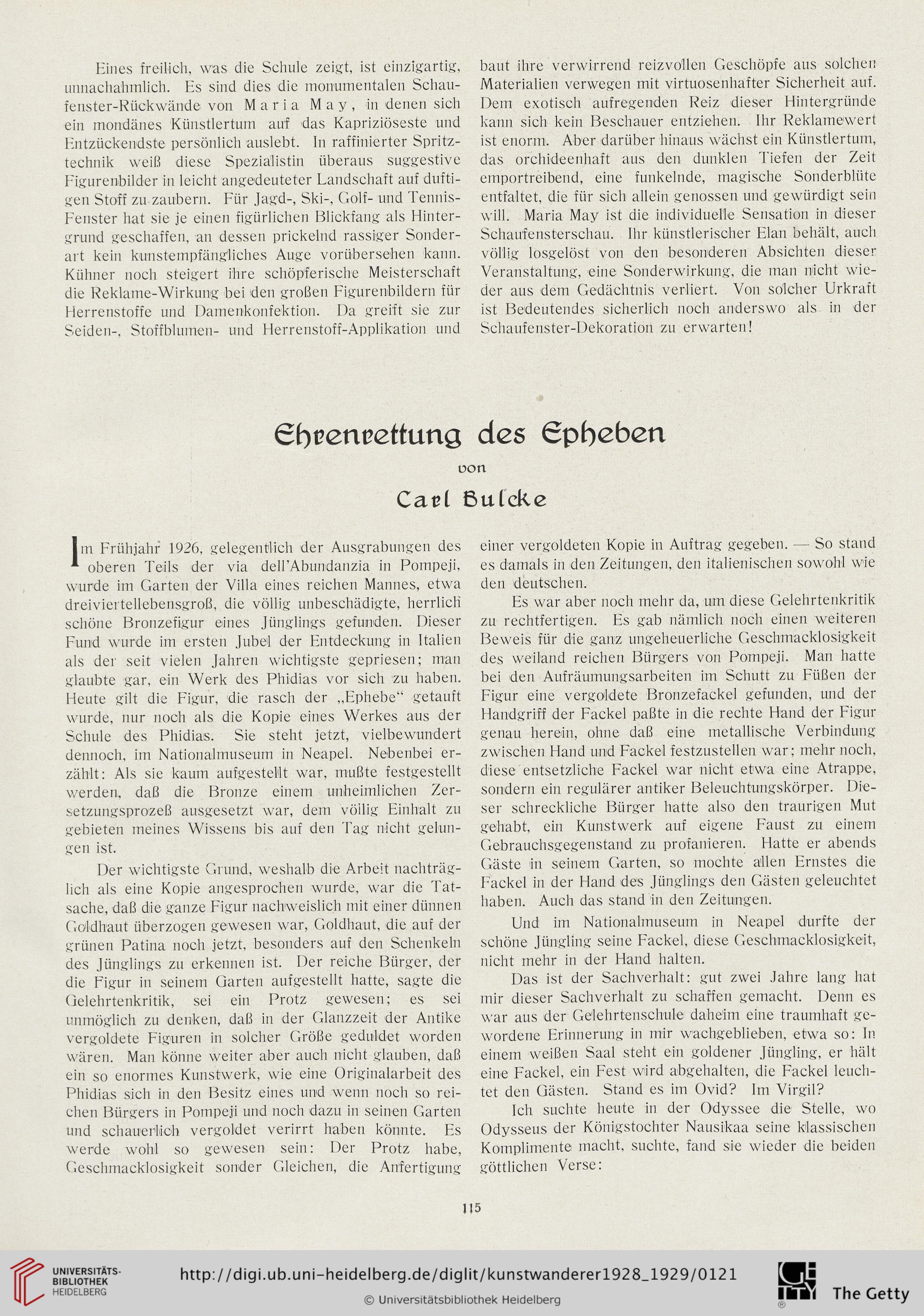Eines freilich, was die Schule zeigt, ist einzigartig,
unnachahmlich. Es sind dies die monumentalen Schau-
fenster-Rückwände von Maria May, in denen sich
ein mondänes Künstlerturn auf das Kapriziöseste und
Entzückendste persönlich auslebt. In raffinierter Spritz-
technik weiß diese Speziälistin überaus suggestive
Figurenbilder in leicht angedeutetcr Landschaft auf dufti-
gen Stoff zu zaubern. Für Jagd-, Ski-, Golf- und Tennis-
Fenster hat sie je einen figürlichen Blickfang als Hinter-
grund geschaffen, an dessen prickelnd rassiger Sonder-
art kein kunstempfängliclies Auge vorübersehen kann.
Küliner noch steigert ihre schöpferische Meisterschaft
die Reklame-Wirkung bei den großen Figurenbildern für
Herrenstoffe und Damenkonfektion. Da greift sie zur
Seiden-, Stoffbiumen- und Herrenstoff-Applikation und
baut ihre verwirrend reizvollen Geschöpfe aus solclien
Materialien verwegen mit virtuosenhafter Sicherheit auf.
Dem exotisch aufregenden Reiz dieser Hintergründe
kann sich kein Beschauer entziehen. Ihr Reklame'wert
ist enorm. Aber darüber hinaus wächst ein Künstlertum,
das orchideenhaft aus den dunklen Tiefen der Zeit
emportreibend, eine funkelnde, magische Sonderblüte
entfaitet, die für sich allein genossen und gewürdigt sein
will. Maria May ist die individuel'le Sensation in dieser
Schaufensterschau. Ihr künstlerischer Elan behält, auch
völ'lig losgelöst von den besonderen Absichten dieser
Veranstaltung, eine Sonderwirkung, die man nicht wie-
der aus dem Gedächtnis veriiert. Von solcher Urkraft
ist Bedeutendes sicherlich noch anderswo als in der
Schaufenster-Dekoration zu erwarten!
6bt?ent?ettung des Spbeben
uon
Cat?l BulcRe
Jm Frühjahr 1926, gelegentlich der Ausgrabungen des
1 oberen Teils der via dell’Abundanzia in Pompeji,
wurde im Garten der Villa eines reichen Mannes, etwa
dreiviertellebensgroß, die völlig unbeschädigte, herrlich
schöne Bronzefigur eines Jünglings gefunden. Dieser
Fund wurde im ersten Jubel der Entdeckung in Italien
als der seit vielen Jahren wichtigste gepriesen; man
glaubte gar, ein Werk des Phidias vor sich zu haberi.
Heute gilt die Figur, die rasch der „Ephebe“ getauft
wurde, nur noch als die Kopie eines Werkes aus der
Schule des Phidias. Sie steht jetzt, vielbewundert
dennoch, im Nationalmuseum in Neapel. Nebenbei er-
zählt: Als sie kaum aufgestel'lt war, mußte festgestellt
v/erden, daß die Bronze einem unheimlichen Zer-
setzungsprozeß ausgesetzt war, dem vöilig Einhalt zu
gebieten meines Wissens bis auf den Tag nicht gelun-
gen ist.
Der wichtigste Grund, weshalb die Arbeit nachträg-
lich als eine Kopie angesprochen wurde, war die Tat-
sache, daß die ganze Figur nachweislich mit einer dünnen
Göldhaut überzogen gewesen war, Goldhaut, die auf der
grünen Patina noch jetzt, besonders auf den Schenkeln
des Jünglings zu erkennen ist. Der reiche Bürger, der
die Figur in seinem Garten aufgestellt hatte, sagte die
Gelehrtenkritik, sei ein Protz gewesen; es sei
unmöglich zu denken, daß in der Glanzzeit der Antike
vergoldete Figuren in solcher Größe geduldet worden
wären. Man könne weiter aber auch nicht glauben, daß
ein so enormes Kunstwerk, wie eine Originalarbeit des
Phidias sich in den Besitz eines und wenn noch so rei-
chen Bürgers in Pompeji und noch dazu in seinen Garten
und schauerlioh vergoldet verirrt habeu könnte. Es
werde wohl so gewesen sein: Der Protz habe,
Geschmacklosigkeit sonder Gleichen, die Anfertigung
einer vergoldeten Kopie in Auftrag gegeben. — So stand
es damals in den Zeitungen, den italienischen sowohi wie
den deutschen.
Es war aber noch mehr da, um diese Gelehrtenkritik
zu rechtfertigen. Es gab nämlich noch einen weiteren
Beweis für die ganz ungeheuerliche Geschmacklosigkeit
des weiland reichen Bürgers von Pompeji. Man hatte
bei den Aufräumungsarbeiten im Schutt zu Füßen der
Figur eine vergoldete Bronzefackel gefunden, und der
Handgriff der Fackel paßte in die rechte Hand der Figur
genau herein, ohne daß eine metallische Verbindung
zwischen Hand und Fackel festzustellen war; tnehr noch,
diese entsetzliche Fackel war nicht etwa eine Atrappe,
sondern ein regulärer antiker Beleuchtungskörper. Die-
ser schreckliche Bürger hatte also den traurigen Mut
gehabt, ein Kunstwerk auf eigene Faust zu einem
Gebrauchsgegenstand zu profanieren. Hatte er abends
Gäste in seinem Garten, so mochte a'llen Ernstes die
Fackel in der Hand des Jünglings den Gästen geleuchtet
haben. Aucli das stand in den Zeitungen.
Und im Nationalmuseum in Neapel durfte der
schöne Jüngling seine Fackel, diese Geschmacklosigkeit,
nicht mehr in der Hand halten.
Das ist der Sachverhalt: gut zwei Jahre lang hat
mir dieser Sachverhalt zu schaffen gemacht. Denn es
war aus der Gelehrtenschule daheim eine traumhaft ge-
wordene Erinnerung in mir wachgeblieben, etwa so: In
einem weißen Saal steht ein goldener Jüngling, er hält
eine Fackel, ein Fest wird abgehalten, die Fackel leuch-
tet den Gästen. Stand es im Ovid? Im Virgil?
Ich suchte heute in der Odyssee die Stelle, wo
Odysseus der Königstochter Nausikaa seine Massischen
Komplimente macht, suchte, fand sie wieder die beiden
göttlichen Verse:
115
unnachahmlich. Es sind dies die monumentalen Schau-
fenster-Rückwände von Maria May, in denen sich
ein mondänes Künstlerturn auf das Kapriziöseste und
Entzückendste persönlich auslebt. In raffinierter Spritz-
technik weiß diese Speziälistin überaus suggestive
Figurenbilder in leicht angedeutetcr Landschaft auf dufti-
gen Stoff zu zaubern. Für Jagd-, Ski-, Golf- und Tennis-
Fenster hat sie je einen figürlichen Blickfang als Hinter-
grund geschaffen, an dessen prickelnd rassiger Sonder-
art kein kunstempfängliclies Auge vorübersehen kann.
Küliner noch steigert ihre schöpferische Meisterschaft
die Reklame-Wirkung bei den großen Figurenbildern für
Herrenstoffe und Damenkonfektion. Da greift sie zur
Seiden-, Stoffbiumen- und Herrenstoff-Applikation und
baut ihre verwirrend reizvollen Geschöpfe aus solclien
Materialien verwegen mit virtuosenhafter Sicherheit auf.
Dem exotisch aufregenden Reiz dieser Hintergründe
kann sich kein Beschauer entziehen. Ihr Reklame'wert
ist enorm. Aber darüber hinaus wächst ein Künstlertum,
das orchideenhaft aus den dunklen Tiefen der Zeit
emportreibend, eine funkelnde, magische Sonderblüte
entfaitet, die für sich allein genossen und gewürdigt sein
will. Maria May ist die individuel'le Sensation in dieser
Schaufensterschau. Ihr künstlerischer Elan behält, auch
völ'lig losgelöst von den besonderen Absichten dieser
Veranstaltung, eine Sonderwirkung, die man nicht wie-
der aus dem Gedächtnis veriiert. Von solcher Urkraft
ist Bedeutendes sicherlich noch anderswo als in der
Schaufenster-Dekoration zu erwarten!
6bt?ent?ettung des Spbeben
uon
Cat?l BulcRe
Jm Frühjahr 1926, gelegentlich der Ausgrabungen des
1 oberen Teils der via dell’Abundanzia in Pompeji,
wurde im Garten der Villa eines reichen Mannes, etwa
dreiviertellebensgroß, die völlig unbeschädigte, herrlich
schöne Bronzefigur eines Jünglings gefunden. Dieser
Fund wurde im ersten Jubel der Entdeckung in Italien
als der seit vielen Jahren wichtigste gepriesen; man
glaubte gar, ein Werk des Phidias vor sich zu haberi.
Heute gilt die Figur, die rasch der „Ephebe“ getauft
wurde, nur noch als die Kopie eines Werkes aus der
Schule des Phidias. Sie steht jetzt, vielbewundert
dennoch, im Nationalmuseum in Neapel. Nebenbei er-
zählt: Als sie kaum aufgestel'lt war, mußte festgestellt
v/erden, daß die Bronze einem unheimlichen Zer-
setzungsprozeß ausgesetzt war, dem vöilig Einhalt zu
gebieten meines Wissens bis auf den Tag nicht gelun-
gen ist.
Der wichtigste Grund, weshalb die Arbeit nachträg-
lich als eine Kopie angesprochen wurde, war die Tat-
sache, daß die ganze Figur nachweislich mit einer dünnen
Göldhaut überzogen gewesen war, Goldhaut, die auf der
grünen Patina noch jetzt, besonders auf den Schenkeln
des Jünglings zu erkennen ist. Der reiche Bürger, der
die Figur in seinem Garten aufgestellt hatte, sagte die
Gelehrtenkritik, sei ein Protz gewesen; es sei
unmöglich zu denken, daß in der Glanzzeit der Antike
vergoldete Figuren in solcher Größe geduldet worden
wären. Man könne weiter aber auch nicht glauben, daß
ein so enormes Kunstwerk, wie eine Originalarbeit des
Phidias sich in den Besitz eines und wenn noch so rei-
chen Bürgers in Pompeji und noch dazu in seinen Garten
und schauerlioh vergoldet verirrt habeu könnte. Es
werde wohl so gewesen sein: Der Protz habe,
Geschmacklosigkeit sonder Gleichen, die Anfertigung
einer vergoldeten Kopie in Auftrag gegeben. — So stand
es damals in den Zeitungen, den italienischen sowohi wie
den deutschen.
Es war aber noch mehr da, um diese Gelehrtenkritik
zu rechtfertigen. Es gab nämlich noch einen weiteren
Beweis für die ganz ungeheuerliche Geschmacklosigkeit
des weiland reichen Bürgers von Pompeji. Man hatte
bei den Aufräumungsarbeiten im Schutt zu Füßen der
Figur eine vergoldete Bronzefackel gefunden, und der
Handgriff der Fackel paßte in die rechte Hand der Figur
genau herein, ohne daß eine metallische Verbindung
zwischen Hand und Fackel festzustellen war; tnehr noch,
diese entsetzliche Fackel war nicht etwa eine Atrappe,
sondern ein regulärer antiker Beleuchtungskörper. Die-
ser schreckliche Bürger hatte also den traurigen Mut
gehabt, ein Kunstwerk auf eigene Faust zu einem
Gebrauchsgegenstand zu profanieren. Hatte er abends
Gäste in seinem Garten, so mochte a'llen Ernstes die
Fackel in der Hand des Jünglings den Gästen geleuchtet
haben. Aucli das stand in den Zeitungen.
Und im Nationalmuseum in Neapel durfte der
schöne Jüngling seine Fackel, diese Geschmacklosigkeit,
nicht mehr in der Hand halten.
Das ist der Sachverhalt: gut zwei Jahre lang hat
mir dieser Sachverhalt zu schaffen gemacht. Denn es
war aus der Gelehrtenschule daheim eine traumhaft ge-
wordene Erinnerung in mir wachgeblieben, etwa so: In
einem weißen Saal steht ein goldener Jüngling, er hält
eine Fackel, ein Fest wird abgehalten, die Fackel leuch-
tet den Gästen. Stand es im Ovid? Im Virgil?
Ich suchte heute in der Odyssee die Stelle, wo
Odysseus der Königstochter Nausikaa seine Massischen
Komplimente macht, suchte, fand sie wieder die beiden
göttlichen Verse:
115