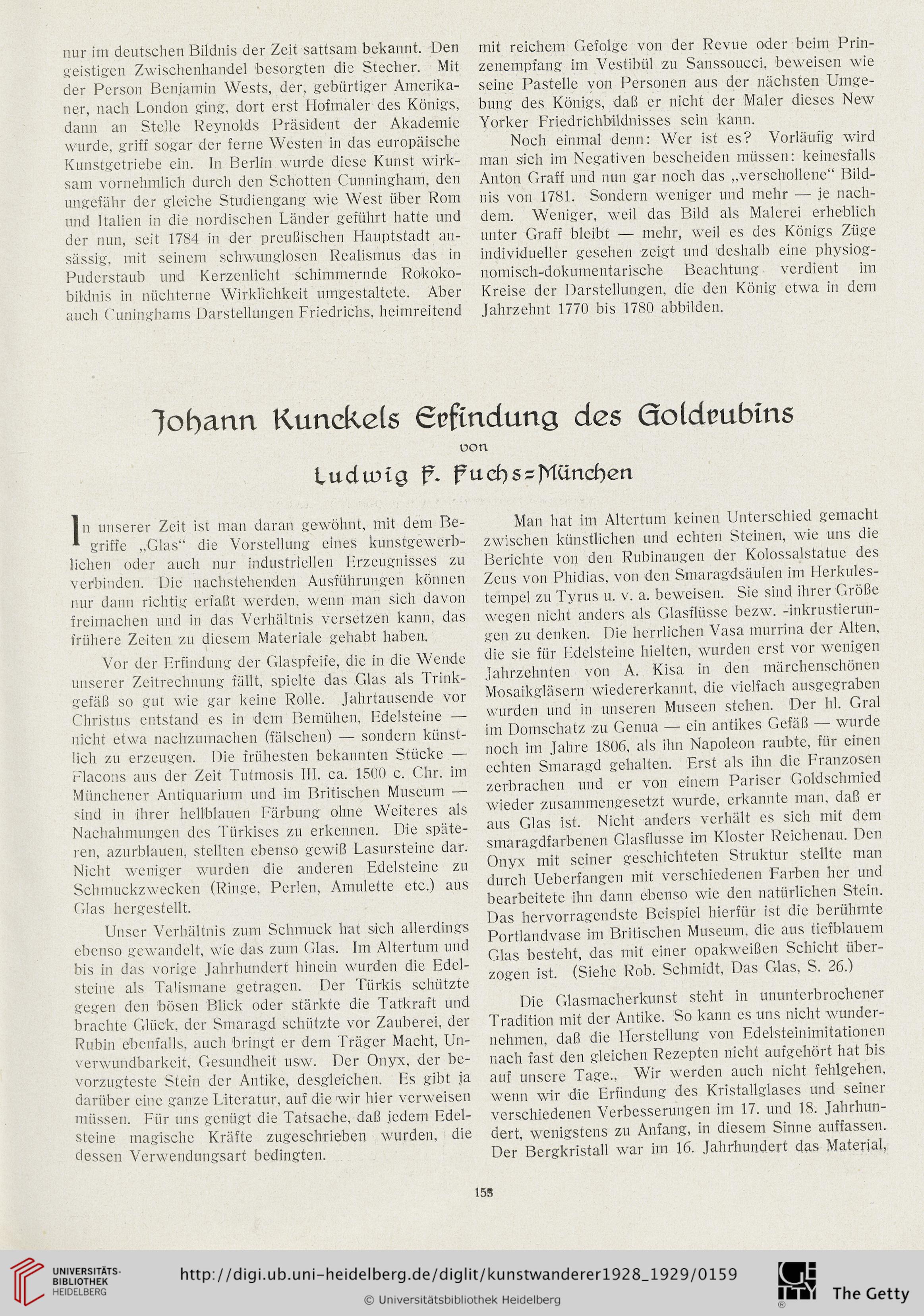nur im deutschen Bildnis der Zeit sattsam bekannt. Den
geistigen Zwischenhandel besorgten die Stecher. Mit
der Person Benjamin Wests, der, gebiirtiger Amerika-
ner, nach London ging, dort erst Hofmaler des Königs,
dann an Stelle Reynolds Präsident der Akademie
wurde, griff sogar der fcrne Westen in das europäische
Kunstgetriebe ein. In Berlin wurdc diese Kunst wirk-
sam vornehmlich durch den Schotten Cunningham, den
ungefähr der gleiche Studiengang wie West tiber Rom
und Italien in die nordischen Länder geführt hatte und
der nun, seit 1784 in der preußischen Hauptstadt an-
sässig, mit seinem schwunglosen Realismus das in
Puderstaub und Kerzenlicht schimmernde Rokoko-
bildnis in nüchterne Wirklichkeit umgestaltete. Aber
auch Cuninghams Darstellungen Friedrichs, heimreitend
mit reichem Gefolge von der Revue oder beim Prin-
zenempfang im Vestibül zu Sanssoucci, beweisen wie
seine Pastelle von Personen aus der nächsten Umge-
bung des Königs, daß er nicht der Maler dieses New
Yorker Friedrichbildnisses sein kann.
Noch einmal denn: Wer ist es? Vorläufig wird
man sich im Negativen bescheiden müssen: keinesfalls
Anton Graff und nun gar noch das „verschollene“ Bild-
nis von 1781. Sondern weniger und mehr — je nach-
dem. Weniger, weil das Bild als Malerei erheblich
unter Graff bleibt — mehr, weil es des Königs Züge
individueller gesehen zeigt und deshalb eine physiog-
nomisch-'dokumentarische Beaclitung verdient im
Kreise der Darstellungen, die den König etwa in dem
Jahrzchnt 1770 bis 1780 abbilden.
lof)ann KuncRels 6t?ftndung dcs Qolcbubins
oon
tadiüig f. fuct)s^Münct)en
I n unserer Zeit ist man daran gewöhnt, mit dem Be-
1 griffe „Glas“ die Vorstellung eines kunstgewerb-
lichen oder aucli nur industriellen Frzeugnisses zu
verbindeu. Die nachstehenden Ausführungen können
nur dann richtig erfaßt wcrden, weun man sich davon
freimachen und in das Verhältnis versetzen kann, das
frühere Zeiten zu diesem Materiale gehabt haben.
Vor der Erfindung der Glaspfeife, die in die Wende
unserer Zeitrechnung fällt, spielte das Glas als Trink-
gefäß so gut wie gar keine Rolle. Jahrtausende vor
Christus entstand es in dem Bemühen, Edelsteine —
nicht etwa nachzumachen (fälschen) —- sondern künst-
lich zu crzcugen. Die frühesten bekannten Stücke —
Flacons aus der Zeit Tutmosis III. ca. 1500 c. Ghr. im
Münchener Antiquarium und im Britischen Museum —
sind in ihrer hellblauen Färbung ohne Weiteres als
Nachahmungen dcs Türkises zu erkennen. Dic spätc-
ren, azurblauen, stellten ebenso gewiß Lasursteine dar.
Nicht weniger wurden dic anderen Edelsteine zu
Schmuckzwecken (Ringe, Perlen, Amulette etc.) aus
Glas hergestellt.
Unser Verhältnis zum Schmuck hat sich allerdings
ebenso gewandelt, wie das zum Glas. Im Altertum und
bis in das vorige Jahrhundert hinein wurden die Edel-
steine als Talismanc getragen. Der Türkis schützte
gegen den bösen Blick oder stärkte die Tatkraft und
brachte Glüc’k, dcr Smaragd schützte vor Zauberei, der
Rubin ebenfalls, auch bringt er dem Träger Macht. Un-
verwundbarkeit, Gesundheit usw. Der Onyx, der be-
vorzugteste Stein der Antike, desgleichen. Es gibt ja
darüber eine ganzc Literatur, auf die wir hier verweisen
müssen. Für uns genügt die Tatsache, daß jedem Edel-
steine magische Kräfte zugeschrieben wurden, die
dessen Verwendungsart bedingten.
Man hat im Altertum keinen Unterschied gcmacht
zwischen künstlichen und echten Stcinen, wie uns die
Berichte von den Rubinaugen der Kolossalstatue des
Zeus von Phidias, von den Smaragdsäulen im Herkules-
tempel zu Tyrus u. v. a. beweisen. Sie sind ihrer Größe
wegen nicht anders als Glasflüssc bezw. -inkrustierun-
gen zu denken. Die herrlichen Vasa murrina der Alten,
die sie für Edelsteine hielten, wurden erst vor wenigen
Jahrzehnten von A. Kisa in den märchenschönen
Mosaikgläsern wiedererkannt, die vielfach ausgegraben
wurden und in unseren Museen stehen. Der hl. Gral
im Domschatz zu Genua — ein antikes Gefäß — wurde
noch im Jahre 1806, als ihn Napoleon raubte, für einen
echten Smaragd gehalten. Erst als ihn die Franzosen
zefbrachen und er von einem Pariser Goldschmied
wieder zusammengesetzt wurde, erkannte man, daß er
aus Cdas ist. Nicht anders verhält es sich mit dem
smaragdfarbenen Glasflusse im Klostcr Reichenau. Den
Onyx mit seiner geschichteten Struktur stellte man
durch Ueberfangen mit verschiedenen Farben her und
bearbeitete ihn dann ebenso wie den natürlichen Stein.
Das hervorragendste Bcispiel hierfiir ist die berühmte
Portlandvase im Britischen Museum, die aus tiefblauem
Glas besteht, das mit einer opakwcißen Schicht über-
zogen ist. (Siehe Rob. Schmidt, Das Glas, S. 26.)
Die Glasmaclierkunst steht in ununterbrochener
Tradition mit der Antike. So kann es uns nicht wunder-
nehmen, daß die Herstellung von Edelsteinimitationen
nach fast den gleichen Rezcpten nicht aufgehört hat bis
auf unsere Tage., Wir werden auch nicht fehlgehen.
wenn wir die Erfindung des Kristallglases und seiner
verschiedenen Verbesserungen im 17. und 18. Jahrhun-
dert, wenigstens zu Anfang, in diesem Sinne auffassen.
Der Bergkristall war im 16. Jahrhundert das Material,
153
geistigen Zwischenhandel besorgten die Stecher. Mit
der Person Benjamin Wests, der, gebiirtiger Amerika-
ner, nach London ging, dort erst Hofmaler des Königs,
dann an Stelle Reynolds Präsident der Akademie
wurde, griff sogar der fcrne Westen in das europäische
Kunstgetriebe ein. In Berlin wurdc diese Kunst wirk-
sam vornehmlich durch den Schotten Cunningham, den
ungefähr der gleiche Studiengang wie West tiber Rom
und Italien in die nordischen Länder geführt hatte und
der nun, seit 1784 in der preußischen Hauptstadt an-
sässig, mit seinem schwunglosen Realismus das in
Puderstaub und Kerzenlicht schimmernde Rokoko-
bildnis in nüchterne Wirklichkeit umgestaltete. Aber
auch Cuninghams Darstellungen Friedrichs, heimreitend
mit reichem Gefolge von der Revue oder beim Prin-
zenempfang im Vestibül zu Sanssoucci, beweisen wie
seine Pastelle von Personen aus der nächsten Umge-
bung des Königs, daß er nicht der Maler dieses New
Yorker Friedrichbildnisses sein kann.
Noch einmal denn: Wer ist es? Vorläufig wird
man sich im Negativen bescheiden müssen: keinesfalls
Anton Graff und nun gar noch das „verschollene“ Bild-
nis von 1781. Sondern weniger und mehr — je nach-
dem. Weniger, weil das Bild als Malerei erheblich
unter Graff bleibt — mehr, weil es des Königs Züge
individueller gesehen zeigt und deshalb eine physiog-
nomisch-'dokumentarische Beaclitung verdient im
Kreise der Darstellungen, die den König etwa in dem
Jahrzchnt 1770 bis 1780 abbilden.
lof)ann KuncRels 6t?ftndung dcs Qolcbubins
oon
tadiüig f. fuct)s^Münct)en
I n unserer Zeit ist man daran gewöhnt, mit dem Be-
1 griffe „Glas“ die Vorstellung eines kunstgewerb-
lichen oder aucli nur industriellen Frzeugnisses zu
verbindeu. Die nachstehenden Ausführungen können
nur dann richtig erfaßt wcrden, weun man sich davon
freimachen und in das Verhältnis versetzen kann, das
frühere Zeiten zu diesem Materiale gehabt haben.
Vor der Erfindung der Glaspfeife, die in die Wende
unserer Zeitrechnung fällt, spielte das Glas als Trink-
gefäß so gut wie gar keine Rolle. Jahrtausende vor
Christus entstand es in dem Bemühen, Edelsteine —
nicht etwa nachzumachen (fälschen) —- sondern künst-
lich zu crzcugen. Die frühesten bekannten Stücke —
Flacons aus der Zeit Tutmosis III. ca. 1500 c. Ghr. im
Münchener Antiquarium und im Britischen Museum —
sind in ihrer hellblauen Färbung ohne Weiteres als
Nachahmungen dcs Türkises zu erkennen. Dic spätc-
ren, azurblauen, stellten ebenso gewiß Lasursteine dar.
Nicht weniger wurden dic anderen Edelsteine zu
Schmuckzwecken (Ringe, Perlen, Amulette etc.) aus
Glas hergestellt.
Unser Verhältnis zum Schmuck hat sich allerdings
ebenso gewandelt, wie das zum Glas. Im Altertum und
bis in das vorige Jahrhundert hinein wurden die Edel-
steine als Talismanc getragen. Der Türkis schützte
gegen den bösen Blick oder stärkte die Tatkraft und
brachte Glüc’k, dcr Smaragd schützte vor Zauberei, der
Rubin ebenfalls, auch bringt er dem Träger Macht. Un-
verwundbarkeit, Gesundheit usw. Der Onyx, der be-
vorzugteste Stein der Antike, desgleichen. Es gibt ja
darüber eine ganzc Literatur, auf die wir hier verweisen
müssen. Für uns genügt die Tatsache, daß jedem Edel-
steine magische Kräfte zugeschrieben wurden, die
dessen Verwendungsart bedingten.
Man hat im Altertum keinen Unterschied gcmacht
zwischen künstlichen und echten Stcinen, wie uns die
Berichte von den Rubinaugen der Kolossalstatue des
Zeus von Phidias, von den Smaragdsäulen im Herkules-
tempel zu Tyrus u. v. a. beweisen. Sie sind ihrer Größe
wegen nicht anders als Glasflüssc bezw. -inkrustierun-
gen zu denken. Die herrlichen Vasa murrina der Alten,
die sie für Edelsteine hielten, wurden erst vor wenigen
Jahrzehnten von A. Kisa in den märchenschönen
Mosaikgläsern wiedererkannt, die vielfach ausgegraben
wurden und in unseren Museen stehen. Der hl. Gral
im Domschatz zu Genua — ein antikes Gefäß — wurde
noch im Jahre 1806, als ihn Napoleon raubte, für einen
echten Smaragd gehalten. Erst als ihn die Franzosen
zefbrachen und er von einem Pariser Goldschmied
wieder zusammengesetzt wurde, erkannte man, daß er
aus Cdas ist. Nicht anders verhält es sich mit dem
smaragdfarbenen Glasflusse im Klostcr Reichenau. Den
Onyx mit seiner geschichteten Struktur stellte man
durch Ueberfangen mit verschiedenen Farben her und
bearbeitete ihn dann ebenso wie den natürlichen Stein.
Das hervorragendste Bcispiel hierfiir ist die berühmte
Portlandvase im Britischen Museum, die aus tiefblauem
Glas besteht, das mit einer opakwcißen Schicht über-
zogen ist. (Siehe Rob. Schmidt, Das Glas, S. 26.)
Die Glasmaclierkunst steht in ununterbrochener
Tradition mit der Antike. So kann es uns nicht wunder-
nehmen, daß die Herstellung von Edelsteinimitationen
nach fast den gleichen Rezcpten nicht aufgehört hat bis
auf unsere Tage., Wir werden auch nicht fehlgehen.
wenn wir die Erfindung des Kristallglases und seiner
verschiedenen Verbesserungen im 17. und 18. Jahrhun-
dert, wenigstens zu Anfang, in diesem Sinne auffassen.
Der Bergkristall war im 16. Jahrhundert das Material,
153