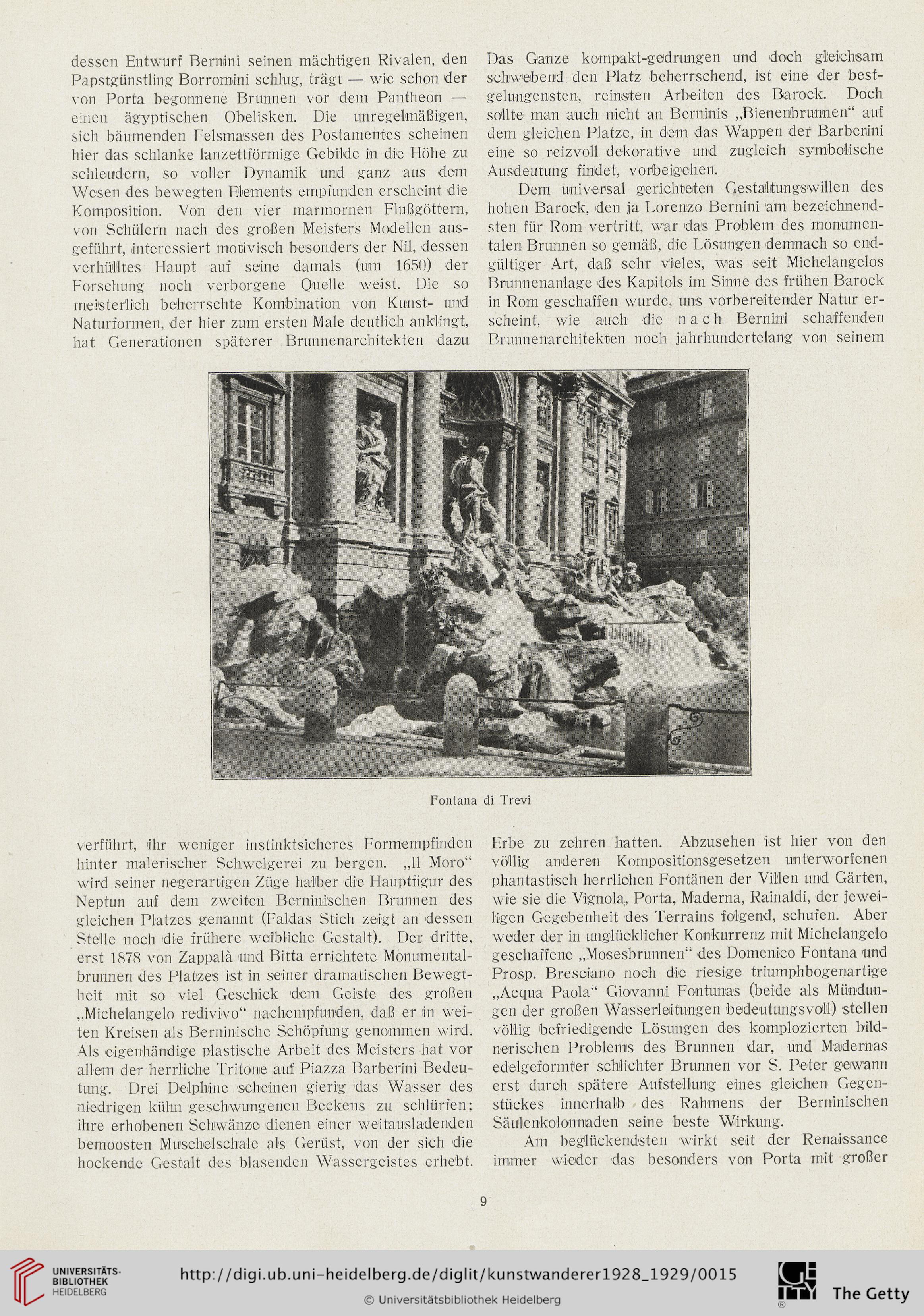dessen Entwurf Bernini seinen mächtlgen Rivalen, den
Papstgünstling Borromini schlug, trägt — wie schon der
von Porta begonnene Brunnen vor dem Pantheon —
einen ägyptischen Obelisken. Die unregeimäßigen,
sich bäumenden Felsmassen des Postamentes scheinen
hier das schlanke ianzettförmige Gebilde in die Höhe zu
sclüeudern, so volier Dynamik umd ganz aus dem
Wesen des bewegten Eiements empfunden erscheint die
Komposition. Von den vier marmornen Flußgöttern,
von Schülern nach des großen Meisters Modellen aus-
geführt, interessiert motivisch besonders der Nil, dessen
verhüiltes Haupt auf seine damals (um 1650) der
Forschung noch verborgene Ouelle weist. Die so
mei'ster'lich beberrschte Kombination von Kunst- und
Naturformen, der hier zum ersten Male deutlich anklingt,
hat Generationen späterer Brunnenarchitekten dazu
Das Ganze kompakt-gedrungen und doch gteichsam
schwebend den Platz beherrschend, ist eine der best-
gelungenisten, reinsten Arbeiten des Barock. Doch
sollte man auch nicht an Berninis „Bieneobrunnen“ auf
dem gleichen Platze, in dem das Wappen der Barberini
eine so reizvoll dekorative und zugleich symbolische
Ausdeutung findet, vorbeigehen.
Dem universal gerichteten Gestaltungswillen des
hohen Barock, den ja Lorenzo Bernini am bezeichnend-
sten für Rom vertritt, war das Problem des monumen-
talen Brunnen so gemäß, die Lösungen demnach so end-
gültiger Art, daß sehr vieles, was seit Michelangelos
Brunnenanlage des Kapitols im Sinne des frühen Barock
in Rom geschaffen wurde, uns vorbereitender Natur er-
scheint, wie auch die n a c h Bernini schaffenden
Brunnenarchitekten nocli jahrhundertelang von seinem
Fontana di Trevi
verführt, ihr weniger instinktsicheres Formempfinden
hinter malerischer Schwelgerei zu bergen. „II Moro“
wird seiner negerartigen Züge halber die Hauptfigur des
Neptun auf dem zweiten Berninischen Brunnen des
gleichen Platzes genannt (Faldas Stich zeigt an dessen
Stelle noch die friihere weibliche Gestalt). Der dritte,
erst 1878 von Zappalä und Bitta errichtete Monumental-
brunnen des Platzes ist in seiner dramatischen Bewegt-
heit mit so viel Geschiick dem Geiste des großen
„Michelangelo redivivo“ nachempfunden, daß er in wei-
ten Kreisen a'ls Berninische Schöpfung genommen wird.
Als eigenhändige plastische Arbeit des Meisters hat vor
allem der herrliche Tritone auf Piazza Barberini Bedeu-
tung. Drei Delpbine scheincn gierig das Was'ser des
niedrigen kühn geschwungencn Beckens zu schlürfen;
ihre erhobenen Scliwänze dienen einer weitausladenden
bemoosten Muschelschale als Gerüst, von der sich die
hockende Gestalt des blasenden Wassergeistes erhebt.
Erbe zu zehren hatten. Abzusehen ist hier von den
völlig anderen Kompositionsgesetzen unterworfenen
phantastisch herrlichen Fontänen der Villen und Gärten,
wie sie die Vignola, Porta, Maderna, Rainaldi, der jewei-
ligen Gegebenheit des Terrains folgend, schufen. Aber
weder der in unglücklicher Konkurrenz mit Michelangelo
geschaffene „Mosesbrunnen“ des Domenico Fontaua und
Prosp. Bresoiano noch die riesige triumphbogeniartige
„Acqua Paola“ Giovanni Fontunas (beide als Mündun-
gen der großen Wasserleitungen bedeutungsvoli) stellen
völlig befriedigende Lösungen des komplozierten bild-
nerischen Problems dcs Brunnen dar, und Madernas
edelgeformter schlichter Brunnen vor S. Peter gewann
erst durch spätere Aufstellung eines gleichen Gegen-
stückes innerhalb des Rahmens der Berninischen
Säulenkolonnaden seine bcstc Wirkung.
Am beglückendsten wirkt seit der Renaissance
immer wieder das besonders von Porta mit großer
9
Papstgünstling Borromini schlug, trägt — wie schon der
von Porta begonnene Brunnen vor dem Pantheon —
einen ägyptischen Obelisken. Die unregeimäßigen,
sich bäumenden Felsmassen des Postamentes scheinen
hier das schlanke ianzettförmige Gebilde in die Höhe zu
sclüeudern, so volier Dynamik umd ganz aus dem
Wesen des bewegten Eiements empfunden erscheint die
Komposition. Von den vier marmornen Flußgöttern,
von Schülern nach des großen Meisters Modellen aus-
geführt, interessiert motivisch besonders der Nil, dessen
verhüiltes Haupt auf seine damals (um 1650) der
Forschung noch verborgene Ouelle weist. Die so
mei'ster'lich beberrschte Kombination von Kunst- und
Naturformen, der hier zum ersten Male deutlich anklingt,
hat Generationen späterer Brunnenarchitekten dazu
Das Ganze kompakt-gedrungen und doch gteichsam
schwebend den Platz beherrschend, ist eine der best-
gelungenisten, reinsten Arbeiten des Barock. Doch
sollte man auch nicht an Berninis „Bieneobrunnen“ auf
dem gleichen Platze, in dem das Wappen der Barberini
eine so reizvoll dekorative und zugleich symbolische
Ausdeutung findet, vorbeigehen.
Dem universal gerichteten Gestaltungswillen des
hohen Barock, den ja Lorenzo Bernini am bezeichnend-
sten für Rom vertritt, war das Problem des monumen-
talen Brunnen so gemäß, die Lösungen demnach so end-
gültiger Art, daß sehr vieles, was seit Michelangelos
Brunnenanlage des Kapitols im Sinne des frühen Barock
in Rom geschaffen wurde, uns vorbereitender Natur er-
scheint, wie auch die n a c h Bernini schaffenden
Brunnenarchitekten nocli jahrhundertelang von seinem
Fontana di Trevi
verführt, ihr weniger instinktsicheres Formempfinden
hinter malerischer Schwelgerei zu bergen. „II Moro“
wird seiner negerartigen Züge halber die Hauptfigur des
Neptun auf dem zweiten Berninischen Brunnen des
gleichen Platzes genannt (Faldas Stich zeigt an dessen
Stelle noch die friihere weibliche Gestalt). Der dritte,
erst 1878 von Zappalä und Bitta errichtete Monumental-
brunnen des Platzes ist in seiner dramatischen Bewegt-
heit mit so viel Geschiick dem Geiste des großen
„Michelangelo redivivo“ nachempfunden, daß er in wei-
ten Kreisen a'ls Berninische Schöpfung genommen wird.
Als eigenhändige plastische Arbeit des Meisters hat vor
allem der herrliche Tritone auf Piazza Barberini Bedeu-
tung. Drei Delpbine scheincn gierig das Was'ser des
niedrigen kühn geschwungencn Beckens zu schlürfen;
ihre erhobenen Scliwänze dienen einer weitausladenden
bemoosten Muschelschale als Gerüst, von der sich die
hockende Gestalt des blasenden Wassergeistes erhebt.
Erbe zu zehren hatten. Abzusehen ist hier von den
völlig anderen Kompositionsgesetzen unterworfenen
phantastisch herrlichen Fontänen der Villen und Gärten,
wie sie die Vignola, Porta, Maderna, Rainaldi, der jewei-
ligen Gegebenheit des Terrains folgend, schufen. Aber
weder der in unglücklicher Konkurrenz mit Michelangelo
geschaffene „Mosesbrunnen“ des Domenico Fontaua und
Prosp. Bresoiano noch die riesige triumphbogeniartige
„Acqua Paola“ Giovanni Fontunas (beide als Mündun-
gen der großen Wasserleitungen bedeutungsvoli) stellen
völlig befriedigende Lösungen des komplozierten bild-
nerischen Problems dcs Brunnen dar, und Madernas
edelgeformter schlichter Brunnen vor S. Peter gewann
erst durch spätere Aufstellung eines gleichen Gegen-
stückes innerhalb des Rahmens der Berninischen
Säulenkolonnaden seine bcstc Wirkung.
Am beglückendsten wirkt seit der Renaissance
immer wieder das besonders von Porta mit großer
9